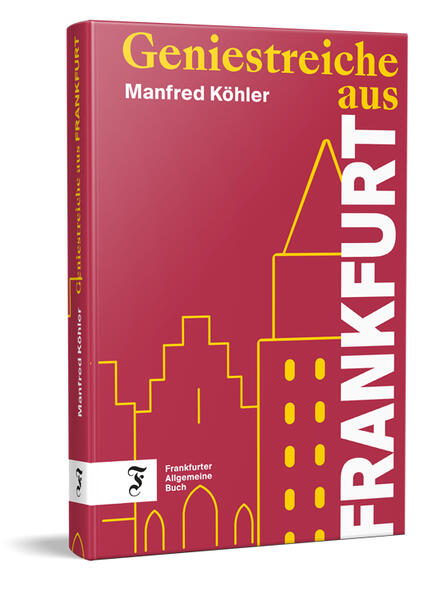Besprechung vom 24.10.2025
Besprechung vom 24.10.2025
Geniestreiche aus Frankfurt
FRANKFURT In der 1200 Jahre währenden Geschichte Frankfurts war an innovativen Frauen und Männern kein Mangel. Manfred Köhler hat sich in einem neuen Buch mit elf großen Frankfurtern und ihren Geniestreichen befasst, von Maria Sybilla Merian bis Hilmar Hoffmann. Wir präsentieren die gekürzte Einleitung des soeben erschienenen Bandes.
Dieses Buch möchte am Beispiel von sechs Frauen und fünf Männern die Bandbreite des Herausragenden andeuten, das sich in dieser Stadt ereignet hat oder jedenfalls in einem Bezug zu ihr steht. Der Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann hat mit dem "Struwwelpeter" das Kinderbuch des 19. und 20. Jahrhunderts schlechthin verfasst. Die nur fünf Jahre in der Stadt tätige Wienerin Margarete Schütte-Lihotzky hat die Frankfurter Küche und damit die Mutter aller Einbauküchen ausgetüftelt. Der aus Würzburg zugereiste Unternehmer Josef Neckermann hat mit seinem Versandhaus zur Demokratisierung des Konsums nach dem Zweiten Weltkrieg beigetragen, vor allem aber den Westdeutschen die Pauschalreise beschert, mit der sie andere Länder und Kontinente entdecken konnten. Liesel Christ trug mit ihrer Rolle in der Fernsehserie "Die Hesselbachs" den Frankfurter Geist und den der Hessen ins ganze Land hinaus.
Geniestreiche aus Frankfurt, das zeigen schon diese Beispiele, haben viel mit Mobilität zu tun. Manchmal führte sie aus Frankfurt weg; den an der Töngesgasse geborenen Heinrich Nestle zog es nach einer Apothekerlehre unweit der Alten Brücke in die Ferne, und so legte er mit der von ihm entwickelten Kindernahrung nicht in Frankfurt, sondern am Genfer See den Grundstein für den Konzern, der noch heute seinen Namen trägt. Die Klaviervirtuosin Clara Schumann wiederum fand erst nach vielen anderen Stationen nach Frankfurt, wo sich ihr Leben abrundete; beim Umzug von Berlin in eine Villa im Westend ging sie schon auf die Sechzig zu. Der Zoodirektor Bernhard Grzimek, ein Zugereister auch er, brach von Frankfurt aus immer wieder nach Afrika auf. Sein Leben wird überhaupt erst verständlich, wenn man sich ihn an zwei Orten gleichermaßen vorstellt, in der Serengeti wie auch in dem Tierpark im Osten der Mainmetropole.
Der enge Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Genie zeigt sich sinnfällig bei Josef Neckermann und bei Heinrich Nestle, aus dem erst im schweizerischen Vevey Henri Nestlé wurde, aber er ist auch bei anderen präsent. Man muss nur einmal um die Ecke denken. Das Museumsufer, mit dem Hilmar Hoffmann der Stadt ein neues Image gab, wäre nicht möglich gewesen ohne das beachtliche Steueraufkommen, das in den Banken und der Industrie am Ort erwirtschaftet wurde. Ähnlich sind die Zusammenhänge beim in diesem Fall lange vom Land Hessen getragenen Sigmund-Freud-Institut, Wirkungsstätte von Margarete Mitscherlich. Franziska Speyer wiederum schuf mit einer riesigen Spende, die lediglich durch die erfolgreichen Geschäfte des familiären Bankhauses möglich wurde, das nach ihrem Mann benannte Georg-Speyer-Haus, in dem Paul Ehrlich Forschungen vorantreiben sollte, die ihn zum Nobelpreisträger machen sollten. Selbst Maria Sibylla Merian konnte ihre berühmten Zeichnungen, das Raupenbuch etwa, nur anfertigen, weil sie mit ihren künstlerischen Fähigkeiten zunächst zum Familieneinkommen beitrug, indem sie etwa Unterricht gab in Blumenmalerei.
Zur Mobilität und zum wirtschaftlichen Erfolg als Voraussetzungen für Innovationen gesellte sich die sprichwörtliche Frankfurter Liberalität. Heinrich Hoffmann engagierte sich als Liberaler zu Zeiten der Nationalversammlung 1848, das "Neue Frankfurt" mit den May-Siedlungen, zu denen Margarete Schütte-Lihotzky die Kücheneinrichtung beisteuerte, wäre ohne den liberal denkenden Oberbürgermeister Ludwig Landmann nicht möglich gewesen. Margarete Mitscherlich wiederum fand sich in Frankfurt in das Umfeld der Frankfurter Schule eingebettet, die ihrerseits Teil des freiheitlichen Aufbruchs der Sechzigerjahre in der Bundesrepublik war.
Auch das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg und der Aufschwung, den Frankfurt in diesen und den folgenden Jahrzehnten nahm - dies alles war nur möglich dank der liberalen Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik, zu deren geistigen Vätern Ludwig Erhard zählte und die in Frankfurt ihre gedankliche Heimstatt fand. Nirgendwo war und ist die Wechselbeziehung zwischen Mobilität, Liberalität und wirtschaftlichem Erfolg besser zu studieren als in Frankfurt, seit Jahrzehnten die kapitalistische Stadt in der Bundesrepublik schlechthin.
Gute Rahmenbedingungen schaffen den Raum für Genies und ihre Streiche, garantieren sie aber keineswegs. Es bedarf stets auch eines Moments des Zufalls, der Fügung - dass jemand zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und den richtigen Gedanken hat. Dass also zum Beispiel das Talent eines Mädchens für die Musik durch einen Vater auch wirklich entdeckt und gefördert wird wie im Falle Clara Schumanns. Dass es im Frühjahr 1945 einen Zoologen namens Bernhard Grzimek auf der Suche nach dem Redakteur, der einmal seine Aufsätze gedruckt hatte, nach Frankfurt verschlägt, dieser Redakteur seit ein paar Tagen Oberbürgermeister ist und der Platz des Zoodirektors zugleich verwaist, sodass der auf einem lädierten Fahrrad angereiste Wissenschaftler mit dem Redakteur im Rücken nach dem Posten des Zoodirektors greifen kann. Dass eine Frau, die mit dem Kochen nichts am Hut hat, trotzdem den Auftrag annimmt, eine moderne Küche zu entwickeln und Margarete Schütte-Lihotzky diese auf den ersten Blick wahrlich nicht besonders interessante Aufgabe mit einer Ernsthaftigkeit und Präzision angeht, als wolle sie eine Mondrakete bauen.
Im 20. Jahrhundert war Frankfurt immer wieder Avantgarde. Das fing schon mit dem "Neuen Frankfurt" an. In der Studentenrevolte und an der gesellschaftskritischen Frankfurter Schule um Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas wurden beispielhafte Debatten geführt. Aber auch die bürgerliche Gegenbewegung unter dem 1977 gewählten Oberbürgermeister Walter Wallmann (CDU) nahm hier früh einen Anfang - Jahre, bevor Helmut Kohl Bundeskanzler werden sollte. Die Porträts von elf Frankfurterinnen und Frankfurtern deuten die Bandbreite dessen an, was möglich war, ob im 17. oder im 20. Jahrhundert, ob in der Politik, Wirtschaft oder Kultur. Also: Vorhang auf für elf Genies und ihre Streiche!
Geniestreiche aus Frankfurt. Manfred Köhler, Frankfurter Allgemeine Buch, Frankfurt 2025, 184 Seiten, 20 Euro.
Maria Sibylla Merian (1) Universitätsbibliothek J. C. Senckenberg Zentralbibliothek, Bockenheimer Landstraße 134-138 Eine Künstlerin schafft im 17. und 18. Jahrhundert einen neuen Blick auf die Natur: Das OEuvre Maria Sibylla Merians war zwar wiederholt Gegenstand von Ausstellungen in Frankfurt, aber in keinem Museum sind Werke von ihr dauerhaft zu sehen. Die Zentralbibliothek der Goethe-Universität verfügt jedoch sowohl über das Raupenbuch von 1683 als auch über den Bericht von ihrer Suriname-Reise aus dem Jahr 1705. Das Städel Museum besitzt Zeichnungen von Merian. Sammlungsstücke der Suriname-Reise sind im Museum Wiesbaden zu bestaunen.
Heinrich Hoffmann (2) Struwwelpeter Museum, Hinter dem Lämmchen 2-4 Der Arzt und Kinderbuchautor Heinrich Hoffmann schuf mit dem "Struwwelpeter" das Kinderbuch schlechthin des 19. und 20. Jahrhunderts. Seinem wichtigsten Werk ist in Frankfurt ein eigenes Museum in der neu erbauten Altstadt gewidmet. Es erinnert mit Porträts, Briefen, Skizzen und Erstausgaben an den erstaunlich vielseitigen Frankfurter aus dem 19. Jahrhundert sowie an die Rezeption des Buchs in den vergangenen Jahrzehnten.
Heinrich Nestle (3) Nestlé Deutschland, Baseler Straße 46 Heinrich Nestle wuchs in Frankfurt auf, begann aber in der Schweiz mit der Produktion innovativer Kindernahrung, die zur Senkung der Säuglingssterblichkeit betrug. Wer sich dem von dem Unternehmer begründeten Weltkonzern in dieser Stadt nähern will, hat nur die Chance, sich die neue Deutschland-Zentrale am Baseler Platz anzusehen. Man kann sogar hineingehen, weil sich im Erdgeschoss ein kleines Ladengeschäft befindet, in dem natürlich Nestlé-Artikel verkauft werden.
Clara Schumann (4) Ehemaliges Wohnhaus, Myliusstraße 32 Die Klaviervirtuosin Clara Schumann verbrachte die letzten zwei Jahrzehnte ihres Lebens in Frankfurt und wohnte in der Myliusstraße 32. Am Eingang des Gebäudes hängt eine Gedenk-tafel. Es ist aber nicht zugänglich. Der 1888 eröffnete Bau des Hoch'schen Konservatoriums an der Eschersheimer Landstraße steht nicht mehr, er wurde bei einem Luftangriff 1943 zerstört. Die Musikakademie befindet sich heute an der Sonnemannstraße. An Clara Schumann erinnert ein kurzer Weg am Riedberg, der ihren Namen trägt, außerdem das nach ihr benannte Foyer in der Alten Oper. Auch die Frankfurter Robert-Schumann-Gesellschaft hält die Erinnerung an die Klaviervirtuosin und Komponistin wach.
Margarete Schütte-Lihotzky (6) Mayhaus, Im Burgfeld 136 Ein "Schütte-Lihotzky-Haus" sucht man in Frankfurt vergeblich, aber nach Ernst May, ihrem Chef in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts, ist ein Haus in einer der damals erbauten Siedlungen benannt, das die Ernst-May-Gesellschaft denkmalgerecht rekonstruiert hat. Das Mayhaus gehört zur Siedlung Römerstadt und kann besichtigt werden. Zum Interieur zählt eine Frankfurter Küche, wie sie Margarete Schütte-Lihotzky entworfen hatte. Eine Frankfurter Küche ist in der Stadt außerdem in der Dauerausstellung des Historischen Museums zu sehen, eine weitere im Museum Angewandte Kunst, ebenfalls in der Dauerausstellung.
Franziska Speyer (5) Georg-Speyer-Haus, Paul-Ehrlich-Straße 42-44 Das Georg-Speyer-Haus, dessen Bau Franziska Speyer mit ihrer Spende ermöglicht hat, ist bis heute erhalten, als Gebäude wie als Forschungseinrichtung. An die Anfänge erinnern eine Ausstellung und ein historisches Labor aus der Anfangszeit, in dem damals an dem neuen Medikament Salvarsan gearbeitet wurde. In einem weiteren Raum wird an Paul Ehrlich erinnert. Die historischen Räume können nach Voranmeldung besichtigt werden, das Georg-Speyer-Haus bietet aber auch regelmäßig Führungen an.
Bernhard Grzimek (7) Zoo Frankfurt, Bernhard-Grzimek-Allee 1 Der Frankfurter Zoo zählt zu den großen in Deutschland, er zeigt mehr als 5000 Tiere aus 450 Arten. Nicht nur die Straße vor der Anlage trägt den Namen Bernhard Grzimeks, sondern auch das Nachttierhaus, in dem Tiere untergebracht sind, die die Dunkelheit besonders lieben. Mit dem Bau des Gebäudes war noch während der bis 1974 währenden Amtszeit Grzimeks als Zoodirektor begonnen worden, fertiggestellt wurde es 1978. Auch eine Büste Grzimeks findet sich dort. Ein "Grzimek-Camp" auf dem Gelände des Zoos erinnert an die prägendste Person in der Geschichte der Anlage, einschließlich eines Landrovers mit Zebrastreifen und eines genauso lackierten Flugzeugs von der Art, wie sie Bernhard Grzimek und sein Sohn Michael für die Reise nach Afrika und die dortigen Flüge über die Serengeti nutzten.
Josef Neckermann (8) Ehemaliges Neckermann-Versandzentrum, Hanauer Landstraße 360 Der Gebäudekomplex ist ein Denkmal für das rasche Wachstum des Versandhandels von Josef Neckermann in den Fünfziger- und Sechzigerjahren wie auch für das beachtliche Selbstbewusstsein seines Eigentümers. Das Versandzentrum war von Egon Eiermann entworfen worden, der auch Architekt des Neubaus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin und des "Langen Eugen", des Abgeordnetenhauses in Bonn, war. Die Gebäude an der Hanauer Landstraße blieben bis zum Ende im Jahr 2012 der Sitz von Neckermann, jetzt werden dort Rechenzentren untergebracht, weshalb eine Besichtigung nicht möglich ist.
Margarete Mitscherlich (9) Mitscherlichplatz Es ist schwierig geworden, verdiente Frankfurter mit der Benennung von Straßen und Plätzen zu ehren, weil diese ja schon alle einen Namen haben und es auch nicht immer die beste Lösung ist, ein Sträßchen in einem abgelegenen Neubaugebiet zu wählen. Im Falle von Margarete und Alexander Mitscherlich war ein Ort im Westend zwingend, denn dort, in der Myliusstraße 20, war und ist das Sigmund-Freud-Institut beheimatet, und nachdem sie zunächst in Höchst gelebt hatten, wohnten sie beide später auch in der Nähe. Die Wahl fiel schließlich 2015 auf eine Fläche an der Ecke des Grüneburgwegs und der Fürstenbergerstraße. Dass der Platz in einem erbarmungswürdigen Zustand ist, hat den zuständigen Ortsbeirat 2024 zu dem Vorschlag bewogen, ihn in "Platz der Unwirtlichkeit unserer Städte" umzubenennen, eine Anspielung auf eines der erfolgreichsten Bücher Alexander Mitscherlichs. Der Magistrat wies das zurück, weil Straßennamen maximal 25 Zeichen haben sollten.
Liesel Christ (10) Fliegende Volksbühne Frankfurt Rhein-Main, Großer Hirschgraben 15 Wer sich in Frankfurt auf die Spuren von Liesel Christ begibt, kann die nach ihr benannte Grünanlage hinter der Alten Oper aufsuchen oder die Koselstraße 42, dort wurde sie geboren, worauf eine Gedenktafel am Gebäude hinweist. Ertragreicher ist es aber wohl, eine Aufführung der Fliegenden Volksbühne von Michael Quast zu besuchen. Dieses Theater spielt seit 2020 am Großen Hirschgraben - dort, wo sich auch das Volkstheater Liesel Christs befand.
Hilmar Hoffmann (11) DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Schaumainkai 41 Wer sich in Frankfurt auf die Spuren Hilmar Hoffmanns begeben will, hat es ganz einfach: Man schaut sich das Museumsufer an, und am besten besucht man die Museen auch. Anfangen lässt sich beispielsweise mit dem Filmmuseum - in diese alte, damals verfallene Villa hatte Hoffmann seinerzeit den neuen Oberbürgermeister Walter Wallmann geschleppt, um ihn von seiner Idee zu überzeugen.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.