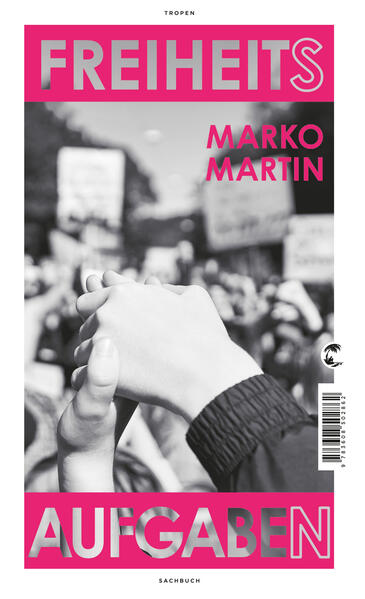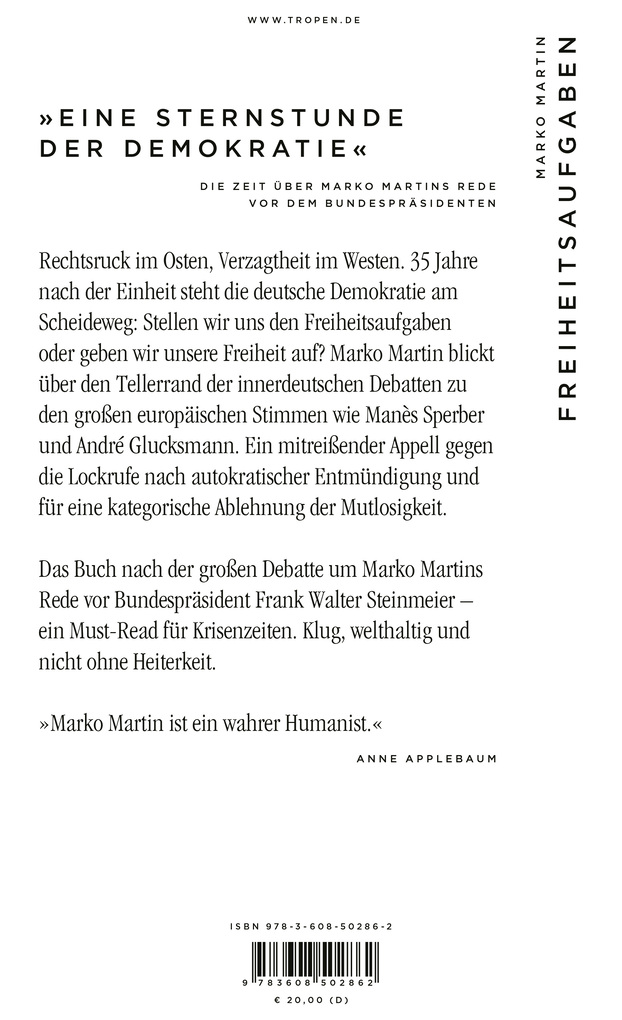Besprechung vom 07.10.2025
Besprechung vom 07.10.2025
Kein letztes Gefecht
Marko Martin entwirft ein Freiheitsprogramm
Das verdrängte Offensichtliche sichtbar zu machen, so lautet das Projekt des Essayisten Marko Martin. Seine Rede anlässlich des Jahrestags des Mauerfalls wurde wiederholt als Eklat apostrophiert. Martin hatte den Bundespräsidenten in Schloss Bellevue für dessen Russlandpolitik kritisiert und die erinnerungskulturelle Marginalisierung von antitotalitären Akteuren, insbesondere Solidarnosc, mit Nachdruck missbilligt. Nun legt er mit "Freiheitsaufgaben" einen Essay vor, den der Verlag als Buch zur Debatte bewirbt - der aber zum Glück doch mehr ist als das.
Der 1970 in der DDR geborene Kriegsdienstverweigerer, der mit seiner Familie noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs in den Westen immigrierte, umreißt hier anekdotisch Stationen seines Lebens sowie für ihn prägende Lektüren und Begegnungen. Martin geht es zuallererst darum, die Komplizenschaft der Deutschen im Osten und Westen hinsichtlich der Verdrängung ihrer schuldhaften Verstrickung in die "braune und die rote Diktatur" zu benennen. Zugleich erscheint der Text als Hommage ans antitotalitäre Dissidententum. Im Rekurs auf Aktivisten und Denker der Freiheit, wie den Publizisten Adam Michnik und den Autor Manès Sperber, sowie auf Worte und Taten seiner väterlichen Freunde André Glucksmann und Ralph Giordano, entwirft Marko Martin sein Freiheitsprogramm. Ähnlich wie Camus im "L'Homme révolté" plädiert er für die Freiheit als ewiges Stückwerk und verwirft jede Aussicht auf ein letztes Gefecht. Gegen die zum Totalitarismus tendierenden großen Begriffe und Befreiungsmodelle setzt er das konkrete Handeln für das Gute, das bei Glucksmann und Giordano eben augenfällig sei. Beide waren laut Martin als säkulare Juden am jüdischen Ethos Tikkun Olam, der "Reparatur der Welt", orientiert.
Nun ist Martins Text ein labyrinthisches Gewirr, sprung- und anekdotenhaft, assoziativ. Der Autor feiert seine Hemdsärmeligkeit, gefällt sich spürbar in der Klartexter-Rolle, als formverachtender Nonkonformist. Dies sowie die hin und wieder fehlende Fairness gegenüber manchen Gegnern, das immer wieder zotige Runtergeputze des Juste milieu der Entspannungspolitik, gestalten die Lektüre mitunter etwas anstrengend.
Und doch ist der Versuch durch anekdotisches Erzählen mit fortgesetzten Wahrnehmungsfehlern aufzuräumen für heutige Debatten ein großer Gewinn. Auch wenn man Martin vielleicht vorwerfen könnte, dass er die sozialen und symbolischen Verluste der Ostdeutschen im Kontext der Systemtransformation ein bisschen zu nonchalant übergeht, die Enttäuschungspotentiale "der Freiheit" nicht bedenken will, spricht er dennoch Entscheidendes an: Zum Ersten die geistigen Kontinuitäten, die lebensweltlicher Brüche zum Trotz über '45 und '90 hinaus in West- und Ostdeutschland fortexistieren - und ferner auch die falsche pädagogische Nachsicht für Putin- oder AfD-Sympathien. Zum Zweiten das in Deutschland verbreitete Bedürfnis, die Aggression der Täter und die Gegenwehr der Opfer im Brei abstrakter Gewalt zu verrühren und im Rahmen konturloser Friedensrhetorik konkrete Verantwortlichkeiten zu verwischen - nicht nur mit Blick auf den russischen Krieg, sondern auch auf den arabisch-israelischen Konflikt. Während die Opfer von Holocaust und Holodomor aus der Geschichte ein "Nie wieder Vernichtung" destillieren, lautet das revisionistische Motto vieler Nachfahren der Täter: "Nie wieder Krieg." Dass sich hinter dem Ruf nach Frieden, wie Paul Spiegel einmal sagte, oft die Mörder verschanzen, macht Martins Essay eindringlich klar.
So zeigt er zum Dritten, dass ein nachhaltiger Frieden leider notfalls auch mit Waffen verteidigt werden muss; und dass die liberale Demokratie, ihrer Aufhebungstendenzen zum Trotz, auch die Grundlage sozialer Verbesserung darstellt und ein zivilisatorischer Fortschritt unvergleichlichen Ausmaßes ist; dass es negative Freiheit durchaus wertzuschätzen gilt und jede vulgärlinke Äquidistanz zwischen Autoritarismus und Liberalismus eine kaltschnäuzig-vermessene Dummheit bedeutet. Auch wer die Bürgerfreiheit bloß für die halbe Miete hält, tut doch gut daran, für sie zu strei- ten. CHRISTOPH DAVID PIORKOWSKI
Marko Martin: "Freiheitsaufgaben".
Tropen Verlag,
Stuttgart 2025. 176 S.,
geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.