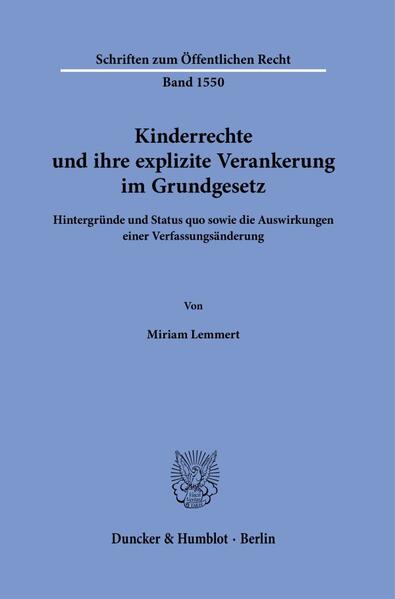
Inhaltsverzeichnis
1. Grundlagen
Begriffsklärung Rechtsgeschichtliche Betrachtungen: Kinderrechte und die deutsche Verfassung
Die Verankerung von Kinderrechten als Emanzipationsdebatte
2. Der Status quo der Kindheit im Recht
Internationales und supranationales Recht Verfassungsrecht Einfaches Recht Fazit: Das Kind im mehrpoligen Verhältnis zu Eltern und Staat auszufüllende Regelungslücken?
3. Die Debatte um die Aufnahme expliziter Kinderrechte in das Grundgesetz und deren Auswirkungen
Das »Ob«: Argumente pro und contra eine Verfassungsänderung Das »Wie«: Varianten einer (Neu-)Gestaltung Die Auswirkungen einer Verfassungsänderung (zugleich: Zusammenführung der Ergebnisse von »Ob« und »Wie«)
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 14.01.2025
Besprechung vom 14.01.2025
Kinderrechte ins Grundgesetz?
Im deutschen Recht würden Kinder oft nur als Anhängsel ihrer Eltern behandelt. Deshalb sei eine Änderung der Verfassung nötig, meint Miriam Lemmert.
Wer sich die Zeit nimmt und das Grundgesetz einmal von Anfang bis Ende durchliest, wundert sich vielleicht, wie selten es darin um Kinder geht. Wörtlich tauchen "Kinder" zwar an sieben Stellen auf, das geschieht jedoch überwiegend dort, wo es inhaltlich um die Rechte von Eltern geht. Wer nach speziellen Kinderrechten sucht, wird keine finden. Dass Kinder aber in besonderem Maß hilf- und schutzbedürftig sind, wird niemand ernsthaft bezweifeln. Zuletzt hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass es für Kinder oft schwierig ist, mit ihren Belangen im öffentlichen Diskurs durchzudringen. Die Aufnahme von Kinderrechten in die Verfassung könnte, so die Hoffnung der Befürworter, eine stärkere Berücksichtigung der Kinderperspektive durch Behörden und Gerichte zur Folge haben. Weil Kinder aber auch ohne eine solche explizite Verankerung jetzt schon Träger aller Grundrechte sind, sehen Kritiker in dem Vorhaben vor allem eins: Symbolpolitik.
Die Debatte ist nicht neu. Seit Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention im Jahr 1992 wird darüber diskutiert, die dort formulierten Prinzipien in das Grundgesetz zu schreiben. Viele haben in den letzten knapp dreißig Jahren versucht, die Verfassung entsprechend zu ändern. Ebenso viele sind an dem ambitionierten Vorhaben, das eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat erfordert, gescheitert. Zuletzt im Jahr 2021, als die Fraktionen zunächst darüber stritten, ob die Interessen von Kindern "vorrangig", "wesentlich" oder "angemessen" berücksichtigt werden sollen, und sich schließlich nicht einigen konnten, ob neben einem Kindergrundrecht auch noch ein Staatsziel in der Verfassung stehen soll.
Angesichts der anhaltenden öffentlichen Debatte ist es nachvollziehbar, dass die Juristin Miriam Lemmert zu dem Vorhaben eine Dissertation geschrieben hat. Da bereits eine Vielzahl rechtswissenschaftlicher Monographien zu dem Thema existieren, wäre hierfür allerdings keine 863 Seiten umfassende Arbeit nötig gewesen.
Im ersten, rechtshistorischen Kapitel zeichnet Lemmert die Rolle von Kindern in der Gesellschaft von der Antike bis zur Gegenwart nach. Sie resümiert, dass eine Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung historisch wie politisch ein "logischer nächster Schritt" eines allmählichen "Wandels des Kindes vom Objekt zum Subjekt" sei. Die Autorin trägt dann alle Grundgesetzänderungsinitiativen zusammen, die es seit 1992 gab. Da viele Argumente in der heutigen Debatte auf historische Vorbilder zurückgehen, ist daran nichts auszusetzen. Allerdings hätte der Lesefluss der Arbeit erheblich davon profitiert, wenn die Autorin nicht jeden Entwurf im Wortlaut wiedergegeben hätte. Eine systematische Zusammenfassung wäre wünschenswert gewesen, um diesen Teil der Arbeit zu straffen.
Im zweiten Kapitel zeichnet Lemmert den Status quo von Kindern in der deutschen Rechtsordnung nach. Zwar erweise sich das Grundgesetz in Bezug auf niedergeschriebene Kinderrechte als "recht karg". Weil das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung aber die Wertungen der UN-Kinderrechtskonvention berücksichtige, seien die Rechte von Kindern jedenfalls auf verfassungsrechtlicher Ebene umfassend gewährleistet.
Im Gegensatz zu den meisten anderen juristischen Publikationen zu dem Thema, die, wie die Autorin selbst schreibt, einer Grundgesetzänderung eher skeptisch gegenüberstehen, beschränkt Lemmert ihre Analyse nicht auf das Verfassungsrecht. Die Autorin prüft auch, ob die verfassungsrechtlichen Gewährleistungen auf der Ebene des einfachen Rechts richtig angewendet und umgesetzt werden. Die Untersuchung führt die Autorin zu der Erkenntnis, dass Kinder in einigen Gesetzen nach wie vor fremdbestimmt und oft als bloßes Anhängsel der Eltern adressiert würden. Dies zeige sich etwa bei medizinischen Behandlungen. Weil das einfache Recht insofern unter den Gewährleistungen des Verfassungsrechts bleibe, weise es ein "Anwendungs- und Umsetzungsdefizit" auf.
Zur Behebung dieses Defizits schlägt die Autorin im dritten und letzten Kapitel dann eine Änderung des Grundgesetzes vor. Weil die Verfassung unsere höchste Werteordnung darstelle, sei dieses Vorgehen weitaus effektiver als viele kleine Änderungen im einfachen Recht. Dafür, dass ihre Dissertation den Titel "Kinderrechte und ihre explizite Verankerung im Grundgesetz" trägt, ist ihr abschließender Vorschlag dann aber überraschend unexplizit.
Die Autorin schreibt, der Artikel solle subjektivrechtliche Formulierungen enthalten und den schon bisher unstreitigen Schutzaspekt nicht über Gebühr betonen. Hinsichtlich des Standorts erscheint ihr eine Platzierung in einem neuen Artikel 2a vorzugswürdig, da hierdurch die Eigenständigkeit der Persönlichkeit des Kindes gegenüber den Eltern, deren Rechte Artikel 6 regelt, räumlich sichtbar würde. Einen konkreten Formulierungsvorschlag unterbreitet sie dem Leser leider nicht.
Dass die Dissertation vom Umfang letztlich eher einer Habilitationsschrift gleicht, ist auf die vielen Wiederholungen und Querverweise zurückführen, die sich durch die gesamte Arbeit ziehen und den Fortschritt der Analyse verlangsamen. Auffällig ist auch, dass die Autorin an mehreren Stellen die Analyseebenen vermischt. Entgegen ihrer Ankündigung, im zweiten Kapitel nur den "Status quo" untersuchen zu wollen, unterbreitet sie Vorschläge, um Defizite zu beheben. Zur Lösung von Konflikten zwischen Eltern und Kind schlägt sie etwa die Einführung eines Schlichtungsverfahrens vor. Sie lässt jedoch offen, wie ein solches Verfahren aussehen und sich in die bestehende Rechtsordnung einfügen soll. Ratsam wäre gewesen, auf solche unausgereiften Vorschläge zu verzichten. Auch deshalb dürfte der Mehrwert der Arbeit in der Diskussion um Kinderrechte im Grundgesetz insgesamt eher überschaubar bleiben. FINN HOHENSCHWERT
Miriam Lemmert: Kinderrechte und ihre explizite Verankerung im Grundgesetz. Hintergründe und Status quo sowie die Auswirkungen einer Verfassungsänderung.
Duncker & Humblot, Berlin 2024. 863 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Kinderrechte und ihre explizite Verankerung im Grundgesetz" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









