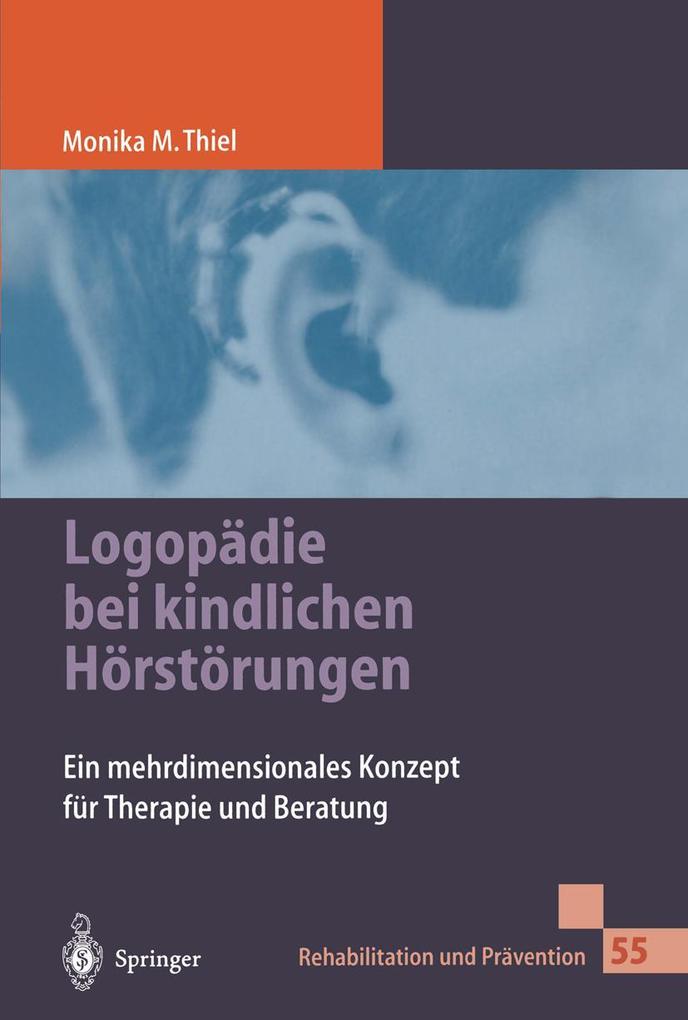" Das Buch ist gut lesbar und übersichtlich gestaltet. Tabellen, Zusammenfassungen, Übersichten und andere Gestaltungsparameter lassen es zu, dass man schnell noch einmal nachschlagen kann. Der Anamnese- und Diagnostikbogen und die diesbezüglichen Anregungen haben sich bereits in der Praxis bewähren können. . . Der therapeutische Ansatz ist anhand von Beispielen von Therapiesitzungen lebendig und vorstellbar. . . " (Forum Logopädie)
" . . . Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich das Buch durch seine übersichtliche und ansprechende Gliederung (jedes Kapitel beginnt mit einem Überblick über den Inhalt, wichtige Merksätze sind besonders hervorgehoben, am Ende jeden Kapitels findet sich eine kurze Zusammenfassung) sehr gut lesen lässt. Es ist ein Buch aus der Praxis für die Praxis, vernachlässigt dabei aber nicht den theoretischen Hintergrund. Es stellt meines Erachtens das Basiswissen für die logopädische Behandlung hörgestörter Kinder dar und wird sicher bald eines der Standardbücher in der Logopädie werden. " (Katja Meffert, Lehrlogopädin unter www. logopaedie. de)