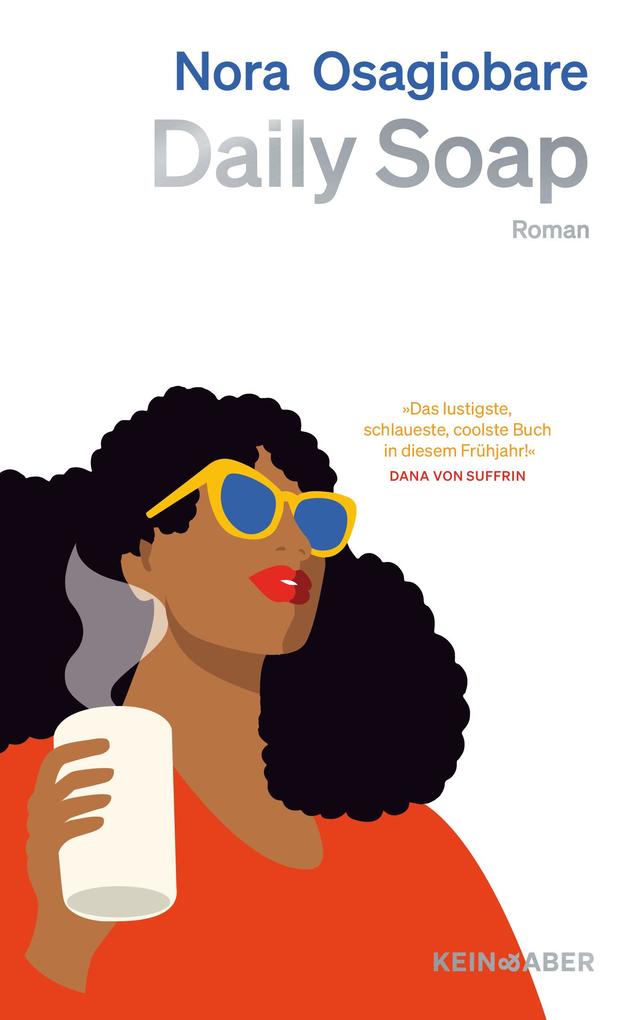»Anders als so viele zur Selbstprovinzialisierung neigende, aber in städtischen Altbauwohnungen lebende Schriftsteller ihrer Generation, verkriecht sie sich erzählerisch nicht in irgendwelchen Berglandschaften. Solcherlei Betulichkeit wird in Osagiobares Daily Soap pointensicher entlarvt. « Timo Posselt, DIE ZEIT, 30. 11. 2025 Die ZEIT
»Sprachlich virtuos und politisch furchtlos fegt Osagiobare in 'Daily Soap' über die diskursiven Problemzonen der Gegenwart hinweg. . . In der deutschsprachigen Literatur hat noch niemand so souverän über Rassismus geschrieben. « Sieglinde Geisel, FAZ, 22. 10. 2025 FAZ
»Mit Wortwitz überrrascht Osagiobare auf jeder Seite, eröffnet neue Kapitel und folgt ihren Figuren auf Schritt und Tritt, die wiederum anderen folgen. . . Wie nebenbei verhandelt sie Themen wie Sucht, Kunst und Pornografie sowie Migration. « Antonia Barboric, Die Presse am Sonntag, 08. 06. 2025 Die Presse
»Dieser Debütroman erzählt rasant Themen wie Rassismus, Affären und Medienmechanismen. Nora Osagiobares 'Daily Soap' ist einfallsreich, hat Biss und ist ein wildes Lesevergnügen. « Nina Wolf, SWR 2 Lesenswert Magazin, 18. 04. 2025 Nina Wolf, SWR 2 lesenswert Magazin
»Fulminant, knallhart und komisch. Eine raffinierte Satire über Alltagsrassismus, Sexismus, Alkoholismus und die ganze Heuchelei drum herum Klug und erfindungsreich entlarvt Osagiobare die Zürcher Gesellschaft, die universalgültig ist für die weiße, spätkapitalistische Welt. Fußnoten und absurde erfundene Institutionen wie das BARACK entfalten einen Witz, der oft im Halse stecken bleibt, genial! « 3sat Kulturzeit von der Leipziger Buchmesse, 28. 03. 2025 3sat Kulturzeit
»Ein packender Mix aus Humor, Realismus und scharfer Gesellschaftskritik. Toll! « Johanna von Festenberg, ELLE, 27. 03. 2025 ELLE
»Wie eine Wundertüte - da knallt's! 'Daily Soap' macht einen nachdenklich und ist gleichzeitig unterhaltsam - das ist eigentlich das Optimum von einem Buch. « Katja Schönherr, SRF 1 Buchzeichen, 11. 03. 2025 SRF Buchzeichen
»Ein überraschendes, satirisch-witziges Debüt über Alltagsrassismus, Privilegien und sexuelle Anziehung. So lässig wie furchtlos schreibt Nora Osagiobare über Herkunftshürden und gescheiterte Beziehungen. Für Leserinnen, die mehr wollen, als nur ein bisschen ausspannen. « Claudia Ten Hoevel, emotion Buchspezial, März 2025 emotion
»Ungeheuer leichtfüssig (. . .) Die wohl aufregendste Neuerscheinung, die der Schweizer Buchmarkt derzeit anbietet (. . .) Es handelt sich um Nora Osagiobares Debütroman. Und, wie gesagt, er knallt. « Thomas Studer, CH Media, 03. 03. 2025 CH Media
»Nora Osagiobare nutzt das Format der Seifenoper, um unsere Gegenwart zu sezieren und zu kommentieren (. . .) Arm und Reich, schwarz und weiss, Klischee und Racial Profiling prallen mit viel Humor aufeinander. « Philine Erni, Bluewin, Swissinfo, Südostschweiz, 28. 02. 2025 Bluewin
»In ihrem klugen und fulminanten Debüt 'Daily Soap' verpackt die Züricher Autorin Nora Osagiobare ihre Kritik an der Schweizer Gesellschaft in den Look-and-Feel einer Seifenoper. Arm und Reich, schwarz und weiss, Klischee und Racial Profiling prallen darin mit viel Humor aufeinander. « Philine Erni, SDA, 23. 02. 2025 sda
»Nora Osagiobares Debütroman 'Daily Soap' ist eine satirische Gesellschaftskritik erster Güte. Osagiobare bricht nicht nur mit literarischen Normen, sie ummantelt ihre eigenen Erfahrungen mit entwaffnender Selbstironie. Ein Buch, das man im Gymnasium lesen sollte - und sonst sowieso. « Laszlo Schneider, SonntagsBlick, 23. 03. 2025 SonntagsBlick
»Osagiobare wiederum treibt ihren Text 'Daily Soap' gekonnt an die Ränder hin zum Aberwitz, nahe dem Klamauk. « M. Stegmayr, Kronen Zeitung, 03. 11. 2025 Kronen Zeitung
»Ein bemerkenswerter Roman. . . ein humorvoller und heiterer Text, der gleichzeitig auch anspruchsvolle Wortkunst ist. « Ernst W. Koelnsperger, Studiosus Bücherschau, 01. 11. 2025 Ernst W. Koelnsperger, Studiosus Reisen München GmbH
»'Daily Soap' schafft die Gratwanderung zwischen literarischem Werk und Komödie. « Leo Schreyer, Coucou, Oktober 2025 Leo Schreyer, Coucou Kulturmagazin Winterthur
»Nora schreibt witzig, klug und fängt die Schweizer Seele auf eine fesselnde Art und Weise ein. « Lea Schlenker, Journal B, 04. 09. 2025 Lea Schlenker, Journal B
»Eine ironisch-pointierte Auseinandersetzung mit Rassismus und Identität. « Siegessäule, 03. 09. 2025 Siegessäule
»Ein gelungenes Debüt. « NZZ, 31. 07. 2025 NZZ
»So entschädigt während der Dauer der Lektüre kolossales Vergnügen für das Leiden an einer Wirklichkeit, deren Absurdität unter dem Brennglas der Satire bestechend präzise offengelegt wird. Mehr kann man von einer Daily Soap wirklich nicht erwarten. « Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung, 24. 07. 2025 Stuttgarter Zeitung
»'Daily Soap' ist lustig zu lesen. . . und gleichzeitig himmeltraurig. « Tim Wirth, Tages-Anzeiger, 15. 07. 2025 Tim Wirth, Tages-Anzeiger
»Mit viel schwarzem Humor schafft Osagiobare einen Text, der sich aller Mittel der Vorabendserie bedient - und genau darin die Gegenwart spiegelt . . . aufrichtig lustig. « Monika Rathmann, SZ, 14. 07. 2025 Monika Rathmann, Süddeutsche Zeitung
»Osagiobare setzt satirische Spitzen und trifft an den entscheidenden Stellen einen ernsten Ton. . . eine der aufregendsten Stimmen der Schweizer Gegenwartsliteratur. « Céline Burget, Republik, 04. 07. 2025 Céline Burget, Republik
»Die Schweizer Autorin Nora Osagiobare nimmt in ihrem Debütroman die alltäglichen Formen der Diskriminierung in der eidgenössischen Gesellschaft auf tragikomische Art und Weise auf die Schippe. « Stefan Kunzmann, Luxemburger Tageblatt, 30. 06. 2025 Stefan Kunzmann, Luxemburger Tageblatt
»Nora Osagiobares Debütroman 'Daily Soap' arbeitet mit Satire und Ironie gegen strukturellen Rassismus und nutzt Humor bewusst als Gegenstrategie zu Opfernarrativen. « Noemi Hüsser, Bluewin, 23. 06. 2025 Noemi Hüsser, Bluewin
»Nora Osagiobare schneidet mit einem Skalpellmesser einmal durch die Schichten, dekonstruiert alle Ressentiments und Bequemlichkeiten. « Samira El Oussail, SRF Literaturclub, 31. 05. 2025 SRF Literaturclub
»'Daily Soap' ist ein literarisches Feuerwerk. Dieser starke Debütroman brachte mich gleichzeitig zum Lachen und zum Nachdenken - pure Sprachkunst! « Marika Korponay, SRF Bestenliste, 30. 05. 2025 Marika Korponay, SRF Kultur
»Herrlich überdreht. « Kieler Nachrichten, 22. 05. 2025 Kieler Nachrichten
»Nora Osagiobare kritisiert in ihrem Roman 'Daily Soap', wie sich die Mehrheitsgesellschaft gegenüber Minderheiten verhält. Nur schon ein solches Gefälle sorgt für Dringlichkeit. « sda, 20. 05. 2025 sda
»Mit ihrem Debütroman landet sie einen Volltreffer. « Vanessa Nyfeler, Schweizer Illustrierte, 04. 05. 2025 Vanessa Nyfeler, Schweizer Illustrierte
»'Daily Soap' ist ein literarisches Feuerwerk, das mich in eine Schweiz voller Alltagsrassismus und in eine wilde Welt komplexer Beziehungen entführt hat. Dieser starke Debütroman brachte mich gleichzeitig zum Lachen und zum Nachdenken - pure Sprachkunst. « Marika Korponay, SRF Bestenliste, Mai 2025 Marika Korponay, SRF
»Innerhalb weniger Sätze gelingt Osagiobare der Sprung von der Metaebene hinab unter die Gürtellinie und zurück. Ein Gelingen ist das nicht nur, weil Osagiobare treffsicher auf verschiedensten Ebenen landet. Sie erweist sich auch als böse und akkurate Beobachterin. «Daily Soap» ist witzig, weil so viel Wahrheit in den fett über die Ränder hinausgemalten Karikaturen steckt. « Nadine Brügger, NZZ, 24. 04. 2025 Nadine Brügger, NZZ
»'Daily Soap' gehört zu den besonderen Neuerscheinungen dieses Frühlings. « Nina Hurni, Republik Magazin, 15. 04. 2025 Nina Hurni, Republik
»Ein wahnsinnig witziges Buch. . . einer der originellsten Romane jetzt im Frühling, sowohl was die Handlung als auch die Sprache und die Form betrifft. « Katja Schönherr, SRF Zwei mit Buch Podcast, 04. 04. 2025 SRF 2
»Das klingt verrückt? Ist es. Aber dabei doch so lustig und spritzig erzählt, dass man den Roman einfach lieben muss. . . lässt nichts aus, was in den Eintopf einer erfolgreichen und schmackhaften Daily Soap gehört. « Birgit Kawohl, Cruiser, April 2025 Cruiser-Magazin
»Ein bitter-lustiger Roman. « WDR Cosmo, 31. 03. 2025 WDR Cosmo
»Geballte satirische Gesellschaftskritik. . . Osagiobare schreibt rasant und sehr witzig über Alltagsrassismus, Privilegien, Klischees und sexuelle Neigungen. « Sohra Nadjibi, Frizz Magazin, 31. 03. 2025 Frizz Magazin Frankfurt
»'Daily Soap' ist ein literarisches Feuerwerk. Dieser starke Debütroman brachte mich gleichzeitig zum Lachen und zum Nachdenken pure Sprachkunst! « Marika Korponay, SRF Bestenliste April, 28. 03. 2025 SRF Kultur
»Man weiß nie, was der Autorin als nächstes einfällt. . . originell, witzig. . . Osagiobare schafft es, mit einer gewissen Leichtigkeit und mit Tiefgang über das sehr emotionale Thema des Alltagsrassismus zu schreiben. « Britta Spichiger, SRF Bestenliste April, 28. 03. 2025 SRF Kultur
»Eine Komödie im Turbosound. . . eine rasante Geschichte voller Intrigen, Benzos, Verschwörungstheorien und Plot-Twists. « Anne-Christine Schindler, WOZ Die Wochenzeitung, 27. 03. 2025 Die Wochenzeitung WOZ
»Eine einzigartige Mischung aus Satire und Soap-Drama geschaffen, die nicht nur unterhält, sondern auch schwerwiegende gesellschaftliche Themen gekonnt unter die Lupe nimmt. « IN Magazin, April 2025 IN MAGAZIN (Forum der Kulturen)
»'Daily Soap' von Nora Osagiobare ist eine bissige Gesellschaftssatire. « Babina Cathomen, Kulturtipp, 26. 03. 2025 kulturtipp
»Cooles Debüt, so lässig wie bissig. « Angela Wittmann, Brigitte, 26. 03. 2025 Brigitte
»Seelenbalsam. « Jolie, 25. 03. 2025 Jolie
»Sie macht die Seifenoper zum literarischen Konzept, um durchaus humorvoll die Zustände in der Schweizer Gesellschaft zu kritisieren, beispielsweise den alltäglichen Rassismus. « sda, 19. 03. 2025 sda
»Osagiobare reichert das Normcore-Genre intersektional an, vor allem aber verkehrt sie die platte Heiterkeit solcher Formate in eine hochtourig drehende Ironie. . . so klug wie präzise. « Valentin Wölflmaier, DLF, 19. 03. 2025 Deutschlandfunk
»Das Debüt schafft es, tiefgründige Themen leichtfüßig zu erzählen, man amüsiert sich und fühlt sich mitunter ertappt. Hoffentlich liest man von der Autorin bald mehr. Sehr gern empfohlen. « Regine Mitternacht, ekz, 19. 03. 2025 Regine Mitternacht, ekz Bibliotheksservice
»Zürich ist der perfekte Schauplatz für eine Seifenoper. Das beweist Nora Osagiobare mit ihrem ersten Roman 'Daily Soap'. « Tim Wirth, Tagesanzeiger, 24. 02. 2025 Tages-Anzeiger
»Nora Osagiobare erfindet die Soap zweiter Ordnung, in der die Realität selbst bereits Farce ist. Sie zeigt, wie mutig Satire sein kann. « Deniz Utlu
»Dieser Roman ist eine trügerische schwarz-weiße Komödie im Turbosound, die auf Sexistinnen, Modisten, Drogisti und andere Klischees zielt aus der niemand als derselbe herauskommt, als der er hineingezogen wurde. « Julia Franck
»Nora Osagiobare ist genau die Autorin, die wir gerade brauchen: Schon lange hat niemand mehr so lässig das Gewirr, das wir Gesellschaft nennen, bloßgelegt. Das lustigste, schlaueste, coolste Buch in diesem Frühjahr! « Dana von Suffrin