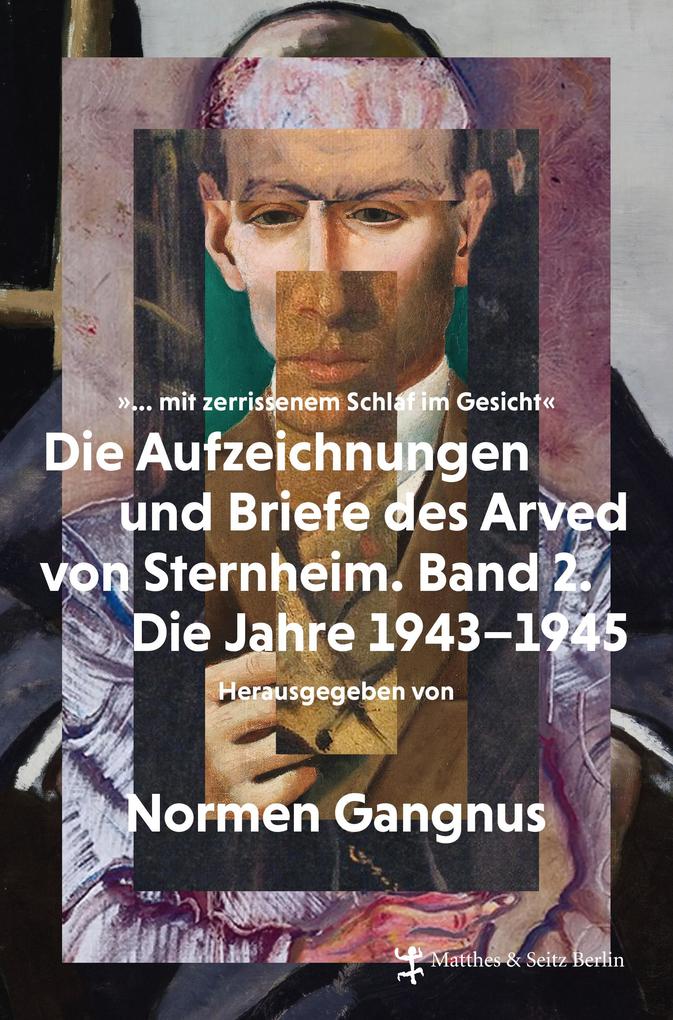
Zustellung: Do, 10.07. - Sa, 12.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Mit seinem monumentalen Roman ». . . mit zerrissenem Schlaf im Gesicht«. Die Aufzeichnungen und Briefe des Arved von Sternheim. Band 2. Die Jahre 1943 bis 1945 erschafft Normen Gangnus Wirklichkeit - nicht indem er die Geschichte umschreibt, sondern indem er sie über den Umweg der Fiktion vollends zur Geltung bringt.
Lückenhaft ist die Geschichte der NS-Raubkunst. Für immer verloren haben sich die Spuren etlicher geraubter Kunstwerke in den Wirren des Nachkriegs, in den Bürokratien des geteilten Deutschland, in den über Verbleib und Zerstörung Bescheid wissenden Köpfen der Verantwortlichen - zumindest scheinbar. Denn kurz nach Veröffentlichung der Briefe des unter bis heute ungeklärten Umständen verschollenen Kunsthändlers Arved von Sternheim werden dem Herausgeber Normen Gangnus weitere zufällig in den Archivbeständen des Ministeriums für Staatssicherheit entdeckte Aufzeichnungen zugespielt. Darin eröffnen sich nicht nur der Alltag, die Sehnsüchte, Ab- und Beweggründe jenes Mannes, der zwar außerhalb des Geschehens zu stehen glaubte, als Hermann Görings Kunstsammler jedoch unmittelbar mit der »Verwertung« von als »entartet« klassifizierter Kunst betraut war. Vielmehr tritt ebenjene bis in die Gegenwart ragende Geschichte über Verbrechen und Verluste, Fallstricke und Fälschungen zutage, die so wahr ist, dass es Gangnus' Grenzen sprengender literarischer Erfindung von Arved von Sternheim bedarf, um sie erzählen zu können.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
20. März 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
792
Autor/Autorin
Normen Gangnus
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
1023 g
Größe (L/B/H)
221/152/57 mm
ISBN
9783751810180
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Die ganz große Illusion
Literarisches Versteckspiel von höchsten Gnaden: Normen Gangnus gibt die von ihm fingierten Aufzeichnungen und Briefe eines im Dritten Reich wirkenden Kunsthistorikers heraus.
Von Andreas Platthaus
Von Andreas Platthaus
Suchen Sie gar nicht erst nach dem ersten Band. Obwohl es Sie während der Lektüre des zweiten immer mehr danach verlangen wird, auch die früheren Dokumente aus dem Leben des Kunsthistorikers Arved von Sternheim (1901 bis 1945) kennenzulernen, zumal Normen Gangnus so verheißungsvoll daraus zitiert. Gleich auf der ersten Seite seines in dieser Woche erschienenen Buchs ". . . mit zerrissenem Schlaf im Gesicht", das laut Untertitel Sternheims Aufzeichnungen und Briefe aus dessen beiden letzten Lebensjahren versammelt, erfahren wir, dass es einen Vorgängerband mit den Dokumenten der Jahre 1920 bis 1929 gab, der, obzwar erst 2019 publiziert, derzeit nicht lieferbar ist. Aber Verlag und Herausgeber seien zuversichtlich, dass er es bald wieder sein wird - und dann sogar aktualisiert. Was auch bitter nötig wäre, denn die nun von Gangnus vorgelegten späteren Sternheim-Papiere waren zuvor alle unbekannt, da sie unbeachtet in den Stasi-Archiven lagen: in einem Konvolut, das Unterlagen zur Drangsalierung privater Kunsteigentümer in der DDR versammelte, die man um ihre Schätze bringen wollte, um sie gegen Devisen ins kapitalistische Ausland zu verkaufen.
Was wie eine gigantische Räuberpistole klingt, ist tatsächlich eine, aber die geschicktest inszenierte, die man sich denken kann. Der fast achthundert Seiten umfassende Band, als dessen Herausgeber Gangnus zeichnet, ist von vorne bis hinten fiktiv, aber keinesfalls gelogen. Dafür sind zu viele Tatsachen in ihn eingeflossen: die Realia des Lebens in Krieg und Diktatur. Der Protagonist Arved von Sternheim tritt vor uns als hyperrealistisches Porträt eines feinsinnigen Opportunisten - eines Mannes, wie wir uns schon immer vorgestellt haben, dass es ihn gegeben haben muss. Denn wie wäre sonst das, was dieses Buch erzählt, möglich gewesen? Und es war ja nicht nur möglich, es ist passiert.
Als die in Gangnus' Buch enthaltenen Lebenszeugnisse einsetzen, ist Sternheim als Berater für Hermann Göring tätig, der nicht erst seit Kriegsbeginn damit beschäftigt ist, sich eine gigantische Kunstsammlung zu ergaunern - in unmittelbarer Konkurrenz zu der des von Adolf Hitler geplanten "Führermuseums". Allerdings sollte die aus dem ganzen besetzten Europa nach Carinhall, Görings Anwesen in der Schorfheide, verbrachte Kollektion privat bleiben - der Reichsmarschall als Renaissancemensch. So weit, so wahr. Vieles aus den für ihn zusammengeraubten Beständen wurde nach 1945 restituiert, einiges ging aber auch verloren. Unter anderem von diesen vermissten Kunstwerken erzählt Gangnus' Buch.
Die Idee dazu entstand, als ihm ein Freund vor knapp anderthalb Jahrzehnten von einem Besuch in der Schorfheide berichtete. Gar nicht einmal bei den Überresten des auf Görings Geheiß kurz vor Kriegsende zerstörten Carinhalls, aber der Name "Schorfheide" genügte schon, um die Phantasie zu zünden: Weil Gangnus sich schon seit der Kindheit intensiv mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs befasst hatte - "mehr, als es womöglich gut war", wie er heute sagt -, stand ihm sofort das Anwesen vor Augen, Und das, was ehedem dort aufbewahrt worden war.
Gangnus, damals Student am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, wusste fortan, wovon er erzählen wollte. Und er wusste auch, wie: als große Simulation eines Quellenbestands, der das Leben eines Mannes dokumentiert, dessen Spur sich mit dem Ende des Dritten Reiches verlieren sollte.
Was über dieses Projekt indes ebenfalls zwischenzeitlich verloren ging, war der Schriftsteller Normen Gangnus. Seine letzte literarische Spur vor der nunmehrigen Publikation seines Großwerks findet sich in einem dreizehn Jahre alten Sammelband: der zwölften Ausgabe von "Tippgemeinschaft", der studentischen Jahresanthologie des Deutschen Literaturinstituts. Seine darin enthaltene Erzählung "Jurmala" widmete sich der Umsiedlung der baltendeutschen Bevölkerung aus Lettland im Dezember 1939, nachdem die Sowjetunion den zuvor unabhängigen Staat mit deutscher Billigung besetzt und annektiert hatte. Gangnus, 1978 in Aschersleben geboren, bediente sich dafür bei der eigenen Familiengeschichte. Seine erwähnte frühe Faszination für die Zeit des Zweiten Weltkriegs aber resultierte aus einer Lektüre. Als Achtjähriger hatte er Bruno Apitz' "Nackt unter Wölfen" gelesen. In der DDR galt dieser 1958 veröffentlichte Roman als repräsentative Darstellung des NS-Lagersystems; sein Manuskript hatte Apitz in Abstimmung mit staatlichen Stellen erarbeitet. Dem jungen Normen Gangnus aber wurde das Buch zum Ausgangpunkt für eine fortdauernde literarische Beschäftigung mit der Nazizeit, die dann von Landsergeschichten bis zur zeitgeschichtlichen Forschung reichte.
Dennoch war der Weg zur eigenen Auseinandersetzung mit dieser Epoche kein geradliniger. In der "Tippgemeinschaft" des Jahrgangs 2011 und in der Berliner Wochenzeitung "Freitag" hatte Gangnus zuvor konkrete Poesie veröffentlicht - "Jugendsünden" nennt er das heute. Nun ist er ganz ein Mann des Romans geworden, auch wenn diese Bezeichnung für sein eigenes Buch lediglich auf der Rückseite des Schutzumschlags gebraucht wird. Der Text selbst behält die Quellenfiktion konsequent bei, aber dass sein Untertitel den Gedanken an den Roman "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" nahelegen soll, kann man sich denken, noch bevor man im Buch liest, dass Rilke der Lieblingsautor Sternheims ist - und im Gespräch mit Gangnus erfährt, dass er mit seinem Protagonisten die besondere Liebe zu Rilkes "Cornet" teilt. Auch diese Erzählung ist ja eine Quellenfiktion.
Für die seine hat Gangnus über ein Dutzend Jahre hinweg Material gesammelt, ohne dass er seine Handlungsorte realiter recherchiert hätte. So war er nie in der Schorfheide, und auch Sternheims Familienanwesen im pommerschen Alt Damerow (heute Stara Dabrowa in Polen) hat er nur auf der Landkarte als Schauplatz ausgewählt: der Ortsinitialen A. D. wegen, die sowohl "anno domini" als auch die Abschiedsfloskel "Ade" anklingen lassen. "Mehr aber nicht zu solchen Elementen im Buch", sagt Gangnus, "es gibt viel davon." Auch sein kleiner Konkrete-Poesie-Zyklus in der "Tippgemeinschaft" Nummer 11 spielte bereits mit dem Wort "Ade". So berührungsfrei sind der Lyriker und der Romancier Normen Gangnus also doch nicht.
Sein Buch ist denn auch ein großes poetisches Kunstwerk, weil es neben dem Thema der Raubkunst im Zweiten Weltkrieg noch ein zeitlos literarisches bietet: die lebenslange Liebe Arved von Sternheims zu der in Frankreich lebenden Exilrussin Anna Besdoma. Diese Beziehung wird von Gangnus durch einen subtil simulierten Briefwechsel mit zahlreichen Überlieferungslücken vorgestellt (und durch die schon erwähnten Verweise auf den angeblichen Vorgängerband, in dem die Korrespondenz der Zwanzigerjahre stehen soll). Kennengelernt haben sich beide 1919 im Pariser Atelier von Amadeo Modigliani, als die Russin dem Italiener Modell stand, und im ersten Brief, den Sternheim im Jahr 1945 an Besdoma schreibt, erinnert er sich bezeichnenderweise paraliptisch an diese Begegnung: "Also kein Wort davon, wie ich mich vor 26 Jahren in der Tür irre, oder davon, wie verärgert Amadeo auf die Störung durch mich reagiert, während Sie nur kurz Ihre amüsanten Augenbrauen tanzen lassen, aber ansonsten ganz gelassen und anscheinend überhaupt nicht überrascht einfach liegen bleiben, sodass ich nicht nicht hinschauen kann." Das Verschweigen ist das größte Thema in Gangnus' Buch.
Denn es ist dessen moralische Kernfrage, nicht der Kunstdiebstahl und auch nicht die seltsame Liebesbeziehung, die vonseiten Sternheims bewusst - mit einer bezeichnenden Ausnahme vom Sommer 1944 - das Du vermeidet: "Anna, ach, Anna, Sie wissen doch, das 'Sie' ist die letzte Bastion, die mich davor beschützt, Ihnen endgültig und dann selbstverständlich zu verfallen." Die genannte Ausnahme ist ein Brief, in dem Sternheim sich einmal als glücklich beschreibt - ohne dass er Anna mitteilt, warum. Er hat sich in die Verlobte seines gefallenen älteren Bruders verliebt.
Schuldig in der Liebe, schuldig im Wissen um die Verbrechen des Dritten Reichs - Arved von Sternheim ist ein Repräsentant der Roman- und der Realgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. Einen Monat vor seinem Verschwinden in den Berliner Wirren des Kriegsendes schreibt er an Besdoma den zentralen Satz des ganzen Buchs: "Sie wissen ja: Wenn ich es nicht aufschreibe, ist es für mich nicht geschehen." In seinen Aufzeichnungen und Briefen sind eigene Kriegserlebnisse und -beobachtungen ausgespart; sie bekommen aber ihren Platz durch Begegnungen mit einem alten Studienfreund namens Joachim Fellauer, der als SS-Mann an den Blutbädern im Osten beteiligt ist und Sternheim mit dem konfrontiert, was der Schöngeist gar nicht wissen will. Und dementsprechend nicht aufschreibt. Was Normen Gangnus dadurch konterkariert, dass er diese Lücken des Berichteten ausstellt und gerade dadurch mit Inhalt füllt. Man muss sich gar nicht so intensiv wie dieser Autor mit dem Dritten Reich befasst haben, um bei der Lektüre von Sternheims Hinterlassenschaft zu bemerken, was darin fehlt. Gangnus erzählt elliptisch und trotzdem überdeutlich. Und mit moralischem Impetus.
Das unterscheidet sein Buch von einem anderen, an das man denken könnte, weil es auch einen höchst ambivalenten Protagonisten aus jener Zeit hat: Jonathan Littells Roman "Die Wohlgesinnten", die literarische Sensation (und auch der literarische Skandal) des Jahres 2008. Littell setzt von Beginn an einen zynischen Grundton, wenn er seinen Ich-Erzähler, den SS-Offizier Maximilian Aue, in dessen Bericht mit der Beschwörungsformel "Ihr Menschenbrüder" anheben lässt, womit "O vous, frères humains" von Albert Cohen zitiert wird, ein 1972 erschienenes und seitdem für Frankreich zentral gewordenes Erinnerungsbuch an antisemitische Erlebnisse seines Verfassers. Nichts von solcher Frivolität findet sich im literarischen Spiel von Gangnus. Er umwebt seine fingierten Quellentexte mit einem Gespinst aus mehr als 1200 Fußnoten (die mindestens so wichtig fürs Erzählte sind wie die Sternheim-Dokumente) und ergänzt sie um ein ausgiebiges Vorwort, das die Herausgeberfiktion zementiert, und ein angeblich siebzig Jahre nach den geschilderten Ereignissen geführtes Gespräch mit einem Vertrauten von Anna Besdoma. Die letzten 35 Seiten schließlich bieten einen Bilderkatalog von Sternheims eigener Kunstsammlung im Jahr 1944 mit 134 Positionen, darunter ein van Gogh, der sich ehedem in Görings Sammlung befand und seit Kriegsende verschollen ist. Hier mischen sich Fakten und Fiktion noch einmal in buchstäblich unnachahmlicher Weise. Eine derart brillant erzählte Fleißarbeit ist ohne Vorbild - ein Buch, wie es noch keines gegeben hat.
Und auch nicht wieder geben wird, denn Normen Gangnus will uns, wie er sagt, nicht die Genugtuung verschaffen, doch noch den vielfach in Band 2 zitierten Band 1 nachzuliefern. Allerdings wird er seine Hauptfiguren noch einmal auftreten lassen: "Ich will die Sicherheit, in der sich meine Leser jetzt wähnen könnten, zerstören. Ich werde also weiterschreiben, aber mit der Axt in der Hand." Kriegsliteratur, auch gegen die eigenen Figuren. Große Literatur.
". . . mit zerrissenem Schlaf im Gesicht". Die Aufzeichnungen und Briefe des Arved von Sternheim. Band 2. Die Jahre 1943-1945. Hrsg. von Normen Gangnus.
Matthes & Seitz, Berlin 2025. 794 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "'... mit zerrissenem Schlaf im Gesicht'" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









