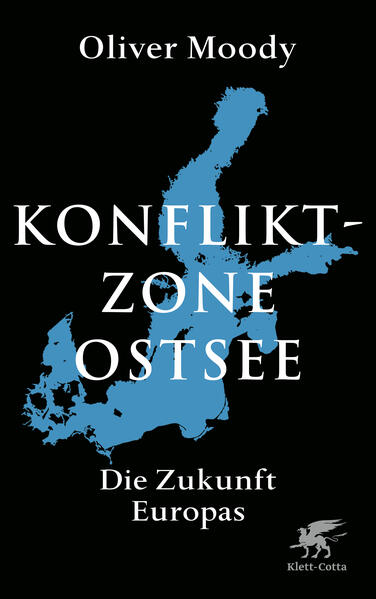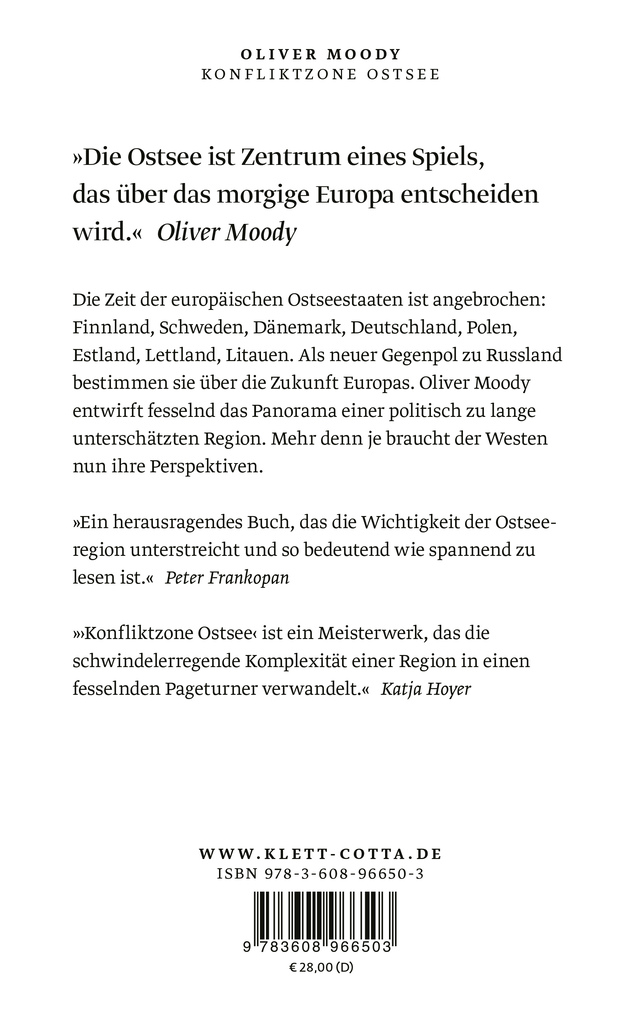Besprechung vom 04.09.2025
Besprechung vom 04.09.2025
Wo man sich mit Geschick als nationale Marke präsentiert
Annäherung an eine geostrategisch für Europa überaus wichtige Konfliktzone: Oliver Moody macht mit Besonderheiten der Anrainerstaaten der Ostsee bekannt
Die Ostsee ist ein brenzliges Meer. Russlands Schattenflotte beschädigt gezielt die Infrastruktur der EU-Anrainerstaaten, seine Luftwaffe provoziert die NATO-Flugabwehr täglich, und das nicht erst seit 2022. Sebastian Bruns, Sicherheitsexperte der Universität Kiel, brachte es vor drei Monaten in einem Interview auf die Formel: "Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind nicht mehr im Frieden."
Oliver Moodys Buch "Konfliktzone Ostsee" stellt sich dieser Situation. Es ist ein ehrgeiziges Unterfangen, will Verständnis für die Ostsee als Zentralzone eines bevorstehenden Krieges wecken und die politische Situation der Ostseeanrainer in all ihren Besonderheiten beschreiben. Diese Zielsetzung des britischen Autors bekommt es mit drei Herausforderungen zu tun: Dem Leser ist zu vermitteln, wie unterschiedlich die Geschichte der jeweiligen Länder ist; es gilt, der westlichen Gewohnheit entgegenzuwirken, sich beim Verständnis Europas noch immer auf das antike Rom und das Mittelmeer zu beziehen und die Ostsee als Peripheriezone zu betrachten; den Leser mit fester Hand zu führen und die Unmenge an Fakten, die alle für die Argumentation wichtig sind, nicht über Bord gehen zu lassen.
Der Autor bemüht sich, die Besonderheiten der Ostseeanrainerstaaten zu verstehen. Jedes Land bekommt ein stattliches Kapitel, in dem auf seine Geschichte eingegangen wird, um heute wirksamen politischen Motiven auf die Spur zu kommen. Moody geht hier weiter als die meisten anderen Autoren - und verfängt sich unterwegs doch.
Dass sich Ostseeländer mit großem Geschick als Marke positionieren, wird vom Westen kaum bemerkt. Diese Markenbildung bedeutet auch, dass ein großer Teil der tatsächlichen Zustände in den Staaten unter den Teppich gekehrt wird und der Fokus auf Symbolen liegt, die das Image des Landes prägen sollen. Moody ist sich dieser Strategien der Selbstpräsentation deutlicher als andere Autoren bewusst und beschreibt sogar einschlägige finnische Bemühungen wie Getränkeangebote und Saunaabende, doch völlig immun ist er gegen diese Strategien nicht.
Sie ebnen den Weg für populistische Parteien, die in allen Ostseeländern große Resonanz gefunden haben. Leider werden sie im Buch ausgeklammert, und man könnte bei der Lektüre sogar den Eindruck gewinnen, es mit einer Region zu tun zu haben, in der hehren Idee und Prinzipien den Ton angeben. Auch der Umstand, dass das offensive Branding eine der Schwachstellen der Ostseeländer ist, an denen der russische Geheimdienst ansetzt, um gesellschaftliche Spaltungen voranzutreiben, bleibt unterbelichtet.
Estland spielt eine wichtige Rolle bei Moody. Der Autor hegt Sympathie für dieses Land. Gleichzeitig ist klar, dass seine Quellen größtenteils Funktionäre des politischen Brandings sind, unter dessen Oberfläche er deshalb nicht dringt. Seine Beschreibung der heutigen EU-Außenbeauftragten und vormaligen estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas als Leidtragende einer nach Sibirien deportierten Familie ist bemerkenswert. Das trifft nämlich nur für den mütterlichen Teil von Kallas' Familie zu, woraus Kallas selbst freilich überall Kapital zu schlagen sucht. Der Autor hat jedoch nie davon gehört, dass die Familie ihres Vaters während der Sowjetzeit zur hohen Nomenklatur des kommunistischen Finanzapparates gehörte und die Teenagerin Kaja Kallas als "rote Prinzessin" mit Vorteilen aufwuchs, wie sie nur wenige hatten. Ein Umstand, der sich noch heute in Kallas' politischen Usancen sowohl in Brüssel als auch in Tallinn ablesen lässt: Etwa als sie dem Staatspräsidenten an den Kopf warf, sie sei weder ihm noch dem estnischen Parlament Rechenschaft über die Geschäftspraktiken ihres Mannes schuldig - obwohl der weiter Handel mit Russland machte. Auch in Brüssel heißt es über Kallas, sie führe ihre Behörde ohne diplomatische Abstimmung mit den Mitgliedstaaten im selbstherrlichen Alleingang.
Moodys Buch singt auch eine lange Hymne auf das oft beschworene Wunder der Digitalisierung Estlands. Ehrlicherweise muss man anmerken, dass am Ende des Kapitels immerhin erwähnt wird, dass auch Digi-Estland Probleme hat. Der Autor übersieht jedoch, dass dieses Wunder einer Digitalisierung fast aller Lebensbereiche nur in einer Gesellschaft möglich ist, die in Bezug auf Einkommen und genutzten Technologien ziemlich homogen ist, sodass sich der Zugang zu Software wie Firmware bei allen Mitgliedern im gleichen Tempo entwickeln kann. Zudem unterschätzt er, dass dieses System durchaus anfällig ist, beispielsweise als 2019 Lücken in der Cybersicherheit der damaligen Präsidentin Kaljulaid aufgedeckt wurden. Davon ist bei Moody nichts zu lesen.
Ganz zu schweigen davon, dass das Buch, das sich auf die Sicherheit der baltischen Staaten und der westlichen Gesellschaft angesichts einer wahrscheinlichen russischen Aggression konzentriert, auf die Bedrohung durch hybride Kriegsführung im Cyberspace, gegen die auch die estnische Gesellschaft schwach ist, nicht eingeht. Später wird behauptet, der Cyberspace sei unwichtig, wenn der Krieg tatsächlich begonnen habe - doch in Gesellschaften, die sich auf den Krieg zubewegen, ist gerade er brisant.
Moodys Wille, die Welt nicht durch die rosarote Brille zu sehen, zahlt sich besonders im Kapitel über Lettland aus, das die Schwachstellen der baltischen Staaten und letztlich auch die geostrategischen Schwachstellen überhaupt hervorhebt: die hohe Abwanderung aus den Ländern und die verborgene Loyalität der russischsprachigen Bevölkerung gegenüber Moskau. Tatsächlich agieren die Letten im internationalen Kontext viel realistischer als ihre Nachbarn und sind stärker an Problemlösungen als an einem nation branding interessiert.
Erfrischend ehrlich stellt Moody fest, dass Finnland kein guter außenpolitischer Partner sei. So habe es überhaupt nicht zur Befreiung des Baltikums beigetragen, weil es von seiner eigenen Angst vor Russland gelähmt war. Die Russland-Sympathien der vormaligen finnischen Präsidentin Tarja Halonen oder die Geschäftstüchtigkeit der Finnen, die riesige Landflächen russischen Bürgern mit zwielichtigem Hintergrund überließ, hätten dabei einen noch größeren Platz im Buch verdient. Denn genau diese Unbesonnenheiten, von denen alle anderen Länder auch nicht frei waren, sind der Grund, warum das Ostseegebiet durch Russland so verwundbar ist.
Gar nicht geht Moody auf Fragen von Religion und Religionsgeschichte ein, die in den Ostseeländern eine zentrale Rolle spielen. Erfreulicherweise erwähnt zumindest das polnische Kapitel den Messianismus der Nation und dessen Verquickung mit der katholischen Kirche. Ebenso wichtig wäre es jedoch, die Ideen Putins und seines Kreises als den von der Moskauer Orthodoxie inspirierten Wunsch nach Wiederherstellung eines neuen Konstantinopels zu erkennen.
Moody versteht sehr gut, Informationen zu filtern, verlässt sich aber zu oft auf offizielle Apparate. Erfreulich wäre eine tiefere Einsicht in die jeweilige innenpolitische Situation der Länder gewesen. Doch das erfordert genauere Sprachkenntnis und längere Aufenthalte vor Ort. Trotzdem ist das Buch eine willkommene Abwechslung zu den Bildpostkarten, die das deutsche Fernsehen zeigt, und kann helfen, die Ostsee als den geostrategisch zentralen Krisenherd Europas zu begreifen. JÜRI REINVERE
Oliver Moody: "Konfliktzone Ostsee". Die Zukunft Europas.
Aus dem Englischen von T. Gabel, E. Heinemann und J. Pinnow. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2025.
528 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.