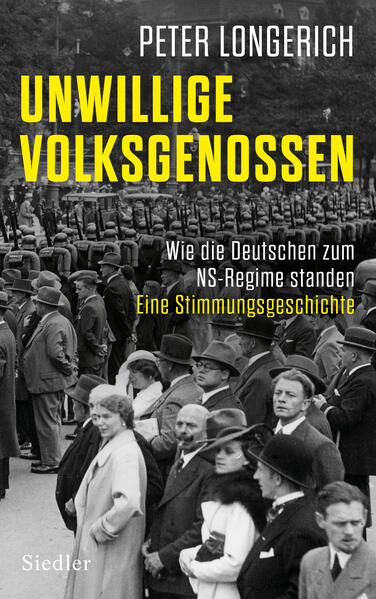Besprechung vom 04.06.2025
Besprechung vom 04.06.2025
Opportunismus und Furcht konnten reichen
Stand nach Hitlers außenpolitischen Erfolgen und der Stabilisierung der Wirtschaft eine erdrückende Mehrheit der Deutschen ohne Vorbehalte hinter dem Regime? Peter Longerich zieht diese unter Historikern zum Konsens gewordene These in seinem neuen Buch in Zweifel.
In seiner Ausgabe vom 3. März 1933, zwei Tage vor den ersten Reichstagswahlen seit Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, gab der "Völkische Beobachter" geneigten Lesern "Zwölf Gebote für den Tag der erwachenden Nation" an die Hand. Im Kern ging es bei allen zwölf Geboten um das Gleiche: Alle national gesinnten Deutschen müssten vor den Wahlen Geschlossenheit demonstrieren, Unentschlossene hingegen sollten durch propagandistische Dauerbeschallung dazu gebracht werden, für die NSDAP zu stimmen: "Wer einen Lautsprecher besitzt, öffne weit seine Fenster und (...) lasse den Appell Adolf Hitlers an die Nation auf die Straße schallen, damit auch die letzten Schläfer erwachen."
Die Eroberung des öffentlichen Raumes durch die Nationalsozialisten war zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortgeschritten, der Druck auf die Opposition gewaltig. Dennoch zeigten die am 5. März stattfindenden Wahlen, dass die Deutschen nur sehr unvollständig "erwacht" waren. Bei einer hohen Wahlbeteiligung von 88,7 Prozent und trotz massiver Beeinträchtigungen und Einschüchterung der Oppositionsparteien erhielt die NSDAP 43,9 Prozent der Stimmen - das beste Ergebnis ihrer Geschichte, aber deutlich weniger als die erhoffte absolute Mehrheit.
In den folgenden Jahren sollte die Zustimmung zum Regime deutlich anwachsen. Dass dies so war, lag zum Teil am Ende der Weltwirtschaftskrise und der Überwindung der Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. Noch mehr aber trugen Hitlers außenpolitische Erfolge der Jahre 1933 bis 1940 - die vollständige Revision des als "Schandfrieden" wahrgenommenen Versailler Vertrags, der Anschluss Österreichs und der militärische Sieg über Frankreich - zur Popularität Hitlers bei. Der Doyen der deutschen Gesellschaftsgeschichte, Hans-Ulrich Wehler, schätzte gar, dass 1940 "mindestens 95 Prozent" der Deutschen hinter Hitler gestanden hätten.
In seinem neuen Buch zieht der ausgewiesene NS-Experte Peter Longerich diese in den letzten Jahren zum Konsens gewordene These zum Verhältnis der Deutschen zum NS-Regime in Zweifel: Von "einer durchgehenden 'Nazifizierung' der deutschen Gesellschaft" könne "keine Rede" sein. Auch wenn die Zustimmung zum Regime zwischenzeitlich hoch gewesen sei, sei spätestens nach der deutschen Niederlage in Stalingrad jeder Restglaube an die NS-Propaganda verschwunden, in den letzten Monaten des Krieges hätten Standgerichte alle Hände voll zu tun gehabt.
Longerich, dessen Gesamtdarstellung zur nationalsozialistischen Judenverfolgung, "Politik der Vernichtung", zu den Standardwerken der NS-Literatur zählt, bestreitet zwar nicht, dass eine große Mehrheit der Deutschen das Regime Hitlers auch dann mittrug, als die Verbrechen des Nationalsozialismus zunehmend sichtbar wurden. Er argumentiert allerdings, dass die Bereitschaft zum Mitmachen vielfach auch ein Zeichen von Gefügigkeit oder von Furcht vor Repression war. Auch opportunistische Anpassung an die Vorgaben des Regimes sei ein verbreitetes Phänomen gewesen. Damit argumentiert er ähnlich wie Richard Evans, in dessen Trilogie zur Geschichte des Dritten Reiches die Bedeutung von Terror und williger Mitarbeit am Regime als gleichberechtigte Stützen des Regimes betont wurden.
Weder bei Evans noch bei Longerich dient dieses Argument zur Entlastung der deutschen Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus, denn viele hätten sich ja arrangiert und trotz Zweifeln nicht aufbegehrt. Longerichs zentraler und auch für den Titel gewählter Begriff der "unwilligen Volksgenossen" beschreibt somit beides: eine zumindest in Teilen unwillige Gefolgschaft, aber auch den fehlenden Willen, gegen Verbrechen aufzubegehren.
Er widerspricht mit diesem Verdikt nicht nur Wehler, sondern auch Zeithistorikern wie Frank Bajohr und Götz Aly, die im Hinblick auf das nationalsozialistische Deutschland von einer "Zustimmungsdiktatur" gesprochen haben - in bewusster Abkehr vom Mythos der unmittelbaren Nachkriegszeit, als alle Deutschen vorgaben, von den Verbrechen des Regimes nichts gewusst zu haben und schon immer Gegner des Nationalsozialismus gewesen zu sein. Demgegenüber betonten Aly und Bajohr, zuletzt aber auch andere Historiker wie Michael Wildt oder Norbert Frei, dass die Zustimmung zu einigen wesentlichen Politikzielen Hitlers weit verbreitet gewesen sei. In anderen Fällen habe das Regime die Zustimmung von Deutschen schlicht erkauft, so etwa durch die sogenannte Arisierung von jüdischem Eigentum, deren Profiteure nicht zwangsläufig Antisemiten oder glühende Anhänger des Gedankens der Volksgemeinschaft sein mussten, durch die Akzeptanz wirtschaftlicher Privilegien aber zu Unterstützern des Regimes wurden.
Longerich stützt sich bei seinem Befund auf die offiziellen Stimmungsberichte aus den Jahren 1933 bis 1945, insbesondere die nahezu vollständig überlieferten Berichte von Regierungspräsidenten, Sicherheitsdienst (SD), Gestapo, Justiz und NSDAP, aber auch Einschätzungen von Oppositionsgruppen aus dem Ausland, insbesondere den Deutschland-Berichten der Sopade (Sozialdemokratische Partei Deutschlands im Exil). Diese Quellen sind nicht wirklich neu - Historiker wie Ian Kershaw legten sie schon vor Jahren eigenen Studien zugrunde. Allerdings wertet Longerich die Zehntausende von Dokumenten systematisch aus.
Die politisch stark eingefärbten Berichte sind mit moderner Demoskopie nicht vergleichbar, bei aller Schönfärberei verweisen sie aber auch auf wiederkehrende Probleme: Mängel bei der Versorgung, Klagen über hohe Preise und die Verwerfungen der Kriegswirtschaft, Kritik an der Kirchenpolitik oder dem Euthanasieprogramm, aber auch an lokalen Parteibonzen, ihren Privilegien und ihrem Machtmissbrauch.
Die schiere Anzahl der periodisch angefertigten Stimmungsberichte verschiedener Partei- und Staatsorgane reflektierte die Furcht des NS-Regimes vor dem Volkswillen und Stimmungsschwankungen - ein Erbe des Ersten Weltkriegs, der in der Selbstwahrnehmung führender Nationalsozialisten nicht auf dem Schlachtfeld verloren wurde, sondern dem "Verrat" einer kriegsmüden deutschen Öffentlichkeit geschuldet war, die der heroisch kämpfenden Truppe mit der Novemberrevolution von 1918 einen "Dolchstoß" versetzt habe.
Kurioserweise beschränkt sich Longerich bei seiner Analyse der Stimmungsberichte auch für die Zeit nach 1939 auf die zivile Bevölkerung innerhalb der Reichsgrenzen. Das ist insoweit verwunderlich, als es die Aussagekraft seiner Thesen untergräbt. Schließlich standen nach Kriegsausbruch Millionen deutscher Männer im Feld, wo die Zustimmung zum Regime eng an den Kriegsverlauf geknüpft war. Ab 1941 waren viele dieser Soldaten unmittelbar am Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion beteiligt, spätestens ab 1942/43 begann der lange, zehrende Rückmarsch in die Niederlage. Der Abgleich mit den Stimmungsschwankungen der Wehrmachtssoldaten (etwa durch Feldpostbriefe) hätte sich auch deshalb gelohnt, weil gerade Soldaten auf Heimaturlaub die Wahrnehmung des Kriegsverlaufs an der Heimatfront entscheidend mitprägten.
Die Diskussion über das Verhältnis der deutschen Bevölkerung zur NS-Diktatur dürfte mit Longerichs Buch kaum zum Abschluss kommen, sondern eher in die nächste Runde gehen. Das liegt weniger an der selektiven Quellenbasis als daran, dass sich die revisionistischen Deutungen Longerichs explizit gegen die Vertreter der These der "Zustimmungsdiktatur" richten, zu denen Longerich selbst einmal gehörte. ROBERT GERWARTH
Peter Longerich: "Unwillige Volksgenossen". Wie die Deutschen zum NS-Regime standen. Eine Stimmungsgeschichte.
Siedler Verlag, München 2025.
640 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.