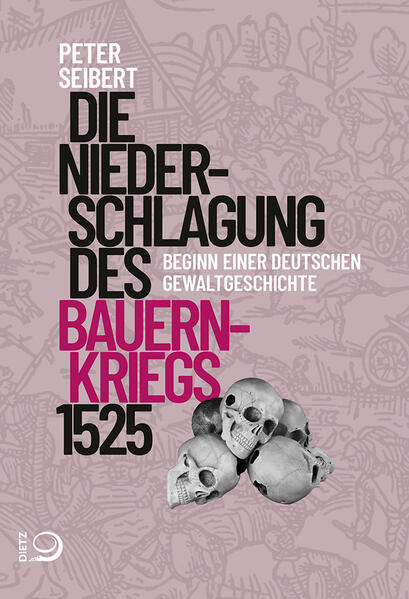
Zustellung: Sa, 19.07. - Di, 22.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die brutale Niederschlagung des Bauernkriegs war der Anfang einer langen Geschichte rücksichtsloser Gewalt der deutschen Obrigkeiten: von den autoritären Feudalstaaten der frühen Neuzeit über Preußen bis in die NS-Diktatur. 1525 begann Deutschlands Weg in die Untertanengesellschaft, woran auch Martin Luther seinen Anteil hatte. Die entfesselte Gewalt deutscher Herren gegen ihre Untertanen und gegen frühe Forderungen demokratischer Teilhabe legte den Keim für eine Tradition der Unfreiheit und Unterdrückung. Der Volksaufstand im Jahr 1525 wollte einer gerechteren und freieren Gesellschaft den Weg bereiten. In »Zwölf Artikeln« formulierten Angehörige der unteren Schichten, was sie von ihrer Herrschaft erwarteten. Die Antwort war blutig. Massaker, Straf- und Rachefeldzüge des Adels beendeten jede Hoffnung auf Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse und löschten die Aufständischen und ihre Familien regelrecht aus. Peter Seibert, Literaturhistoriker und Medienwissenschaftler, rückt erstmals auch die Rolle der Frauen in diesem Krieg in den Fokus und schildert das bedrückende Ausmaß der ersten Erfahrung von Flucht und Exil in der frühen deutschen Neuzeit.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
10. März 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
303
Autor/Autorin
Peter Seibert
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
15 s/w-Abbildungen
Gewicht
454 g
Größe (L/B/H)
207/143/27 mm
ISBN
9783801206918
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 27.06.2025
Besprechung vom 27.06.2025
Wie Helden aus der Nähe aussehen
Facetten der Revolte: Über drei Bücher zum Bauernkrieg vor fünfhundert Jahren und die öffentliche Erinnerung an ihn.
Historische Jubiläen dienen seit Langem nur vorgeblich der Erinnerung. Sie sind religiös grundiert, und das liegt nicht nur am Wort selbst, dem Schuldenerlass aus der Bibel. Das Feiern einer runden Jahreszahl wurde von der Papstkirche in Anspruch genommen, als sie 1300 zum "heiligen Jahr" erklärte, Sonderangebote in Sachen Sündenablass inklusive. Die Einteilung in Jahrhunderte wiederum war eine spätere Erfindung reformierter Historiker. Als die 1617 den hundertsten Jahrestag von Luthers Thesenanschlag feierten, war die Sache der Reformation alles andere als siegreich, das katholische Roll-back hatte längst begonnen. Jubiläen sollen Erlösung aus der Vergangenheit organisieren, als große Reparatur.
Fünfhundert Jahre deutscher Bauernkrieg hat es als Datum also gleich mehrfach in sich. Der erste Schub von Büchern kam pünktlich zum Jahrestag der erfolgreichen ersten Aufstände 1524 auf den Markt. Darunter waren so spektakulär gelungene Synthesen wie Lyndal Ropers "Für die Freiheit", in der sie die Revolten als religiös und sozial inspirierte Ökobewegung würdigte und den weiblichen Anteilen der angeblichen "Revolution des gemeinen Mannes" nachspürte, und Gerd Schwerhoffs "Bauernkrieg 1525: Eine wilde Handlung" (F.A.Z. vom 12. 10. 2024). Schwerhoff hob die (gescheiterten) Verhandlungsstrategien der Rebellen hervor. Nicht alle von ihnen waren Revolutionäre und ziemlich viele auch nicht ganz freiwillig mit dabei.
Beide Bücher unterstrichen die begrenzte und eher regionale Bedeutung der Revolte. Der "große deutsche Bauernkrieg" war nach den gescheiterten Revolutionen von 1849 und 1919 von links und rechts zum nationalen Gesamtereignis stilisiert worden. Seither hat jeder in den Rebellen von 1524 und 1525 seine gewünschten heroischen Vorbilder gefunden, von Friedrich Engels und den selbst ernannten Revolutionären des Nationalsozialismus bis zur DDR und den Bundespräsidenten der BRD der Siebzigerjahre, die sie als Vorkämpfer der "freiheitlich-demokratischen Grundordnung" feierten.
In Wirklichkeit war die Revolte nie gesamtdeutsch, sondern auf vergleichsweise wenige Regionen begrenzt. Im Frühsommer 1525 ging sie mit riesigen Massakern an den militärisch unterlegenen Aufständischen zu Ende. Diese Niederschlagung stellt Peter Seibert in seinem neuen Buch ins Zentrum, als exklusiv "deutsche Gewaltgeschichte" und starker Identifikation in der ersten Person Plural. "Nie wieder haben wir in der deutschen Geschichte etwas Ähnliches erlebt, nie wieder eine solche gesellschaftliche Kreativität und Kraft."
Heraus kommt so etwas wie schwarze Heimatgeschichte, materialreich und mit beeindruckenden Quellenbelegen, aber gerahmt von dramatischen moralischen Superlativen. Das zwangsläufige Ergebnis der Niederlage von 1525 ist für Seibert "der Untertanenstaat schlimmster Prägung", der direkt in die Katastrophe des Nationalsozialismus geführt habe - das sind die letzten Worte des Buchs. Neu ist das nicht. Auch die Alternativ- und Protestbewegungen der Siebziger- und Achtzigerjahre haben sich oft und gerne auf den Bauernkrieg als historisches Vorbild einer gescheiterten moralischen Wende berufen. "Wir sind", sang die populäre linke Rockband "Schröder Roadshow" 1979 (und die meinten es ganz ernst), "die Brüder der romantischen Verlierer."
Eine solche Darstellung vermittelt einem im Lesesessel schöne Gefühle nachträglicher Bestätigung; die historischen Ereignisse selbst sind leider um einiges widersprüchlicher. Als "Bauern" traten während der Revolten sehr unterschiedliche Gruppen auf, neben ländlichen Unterschichten auch Handwerker, Bergwerksknappen und Grundbesitzer mit eigenen Gewerbebetrieben. Ebenso komplex ist, was vor fünfhundert Jahren mit "Freiheit" und "Glauben" gemeint war. Die Flugschriften der Aufständischen nannten ihre Gegner "widerchristen", die mit dem Teufel paktierten und den Untertanen den Zugang zum Evangelium verweigerten. Ihre Forderung nach der Wahl der Pfarrer durch die Gemeinde hatte nicht nur religiöse, sondern vor allem ökonomische Gründe. Aufruhr, schrieb Luther dagegen, sei mit Sicherheit teuflischen Ursprungs, und Philipp Melanchthon ergänzte 1525, "das ein solch wild, ungezogen volck" wie die Deutschen nicht mehr, sondern weniger Freiheit brauche.
Der Bauernkrieg fand aber nicht nur in Deutschland statt, sondern auch in Nord- und Südtirol, Salzburg und der Steiermark. In den großen deutschen Darstellungen zum Gedenkjahr kommen diese Aufstände gewöhnlich nur im Epilog vor, wenn überhaupt, oder in den Fußnoten. Aber sie brachen los, als die Revolten in Südwest- und Mitteldeutschland schon niedergeschlagen waren, nämlich im Frühsommer 1525, und waren anfangs um einiges erfolgreicher, wie Robert Rebitsch und Ralf Höller in ihren neuen Büchern zeigen. Tirol war ein moderner Verwaltungsstaat im Zentrum des globalen Habsburgerreichs, der fast zwei Drittel des europäischen Silbers produzierte. Die Aufständischen plünderten Schlösser und Klöster (und jüdische Geschäftsleute). Sie forderten scharfe Maßnahmen gegen ausländische Gewerbetreibende und strengere Strafen gegen Unzucht, Gotteslästerung und Ehebruch. Sie schlugen, einzigartig im Bauernkrieg, ein Söldnerheer und zwangen den Landesherren an den Verhandlungstisch.
Dabei ging es theatralisch zu: Als dort die Vertreter der revoltierenden unteren Stände ihre Forderungen mit lautem Schreien bekräftigten, fiel die junge Ehefrau des Landesfürsten demonstrativ in aller Öffentlichkeit in Ohnmacht. Das hinderte sie nicht, etwas später die Gegenseite zum Weiterführen der Verhandlungen zu überreden. Angeführt wurden die Aufständischen von Michael Gaismair, einem früheren Sekretär des Bischofs von Brixen, Juristen und Söldnerführer. Nach seiner Ernennung zum Hauptmann hatte der als eine seiner ersten Amtshandlungen zweihundert Berufssoldaten als interne "security" engagiert. Das hatte gute Gründe: Sein Nachfolger im zweiten Aufstand im Jahr darauf - übrigens sein Schwager - wurde nach der erfolglosen Belagerung von Radstadt von den eigenen Leuten umgebracht.
Auch sonst bietet Rebitschs Buch vieles, das in das übliche Drehbuch vom revolutionären Heldenepos nicht so recht passt; etwa Nachrichten über die zahlreichen Spione, die sich den Bauernhaufen anschlossen und der Regierung über ihre Bewegungen und Pläne berichteten - Gastwirte, aber auch Priester, Metzger und Schulmeister. Der militärische Anführer der Salzburger Aufständischen, der 1525 eine Söldnerarmee besiegt hatte, wechselte die Seite und kommandierte beim zweiten Aufstand im Jahr darauf - auch das einzigartig bei deutschen Revolten - Truppen der Regierung.
Die drastischen Vergeltungsaktionen, die Seiberts Buch in einem langen, in modernes Deutsch übertragenen Quellenanhang in grausiger Eindringlichkeit beschreibt, hielten sich in den habsburgischen Gebieten nach dem endgültigen Sieg der Obrigkeit 1526 in relativ engen Grenzen - nicht aber im benachbarten Erzbistum Trient, wo sich zahlreiche Italienischsprachige dem Aufstand angeschlossen hatten und auf Befehl des Kirchenfürsten in der Öffentlichkeit verstümmelt wurden. Von den 96 Beschwerdeartikeln der Aufständischen wurde etwa ein Drittel sogar in die ein Jahr später erlassene Tiroler Landesordnung aufgenommen: der Aufstand diente der Verwaltungsinnovation. In den Jahren nach 1526 waren ehemalige Aufständische als gewalttätige Schuldeneintreiber - Inkasso-Spezialisten - ebenso belegt wie als Söldner in ausländischen Armeen. In den italienischen Kriegen von 1526 und 1527 standen ehemalige Rebellen aus den Bauernkriegen etwa bei der Belagerung von Cremona einander aufseiten der Angreifer wie der Verteidiger gegenüber. Der Rebellenführer Gaismair, mittlerweile erfolgreicher condottiere in venezianischen Diensten, ließ 1527 einen Geistlichen, der zwölf seiner Soldaten zur Desertion überreden wollte, ohne Gerichtsverfahren aufhängen. So sehen Helden aus der Nähe aus.
Das vertraute dramatische Geschichtsbild des Bauernkriegs in der Einzahl als "groß", deutsch und einzigartiger moralischer politischer Sündenfall der Reformation bekommt deutliche Sprünge, wenn man es in eine größere Perspektive rückt. Nach dem erfolgreichen Sturm auf Schlösser und Burgen im Namen des "alten Rechts" und der Wiederherstellung einer göttlichen Ordnung wurden bereits 1514 und 1515 (und abermals 1525 und 1526) die abgeschlagenen Köpfe der adeligen Verteidiger öffentlich zur Schau gestellt und Klöster geplündert. Die Rebellen sprachen aber nicht nur Deutsch, sondern auch Slowenisch, Serbisch und Ungarisch, wie die Zehntausenden der Gefolgsleute des Bauernführers (und Söldnerhauptmanns) György Dosza Szekely. Er war 1515 nach seiner Niederlage öffentlich gefoltert und in einer so ausgefeilt grausigen Zeremonie hingerichtet worden, dass sie Paolo Giovio noch eine Generation später in seiner weit gelesenen "Historiarum sui temporis" als besonders schauriges Exempel adeliger Grausamkeit diente.
Was lässt sich daraus lernen? Die Massaker und sadistischen öffentlichen Spektakel der Bestrafung Aufständischer, die bei Seibert so eingehend geschildert werden, waren nicht spezifisch deutsch, ebenso wenig wie die Gewalt der siegreichen Söldnerarmeen unter ihren reformierten und katholischen Befehlshabern. Erpressung durch möglichst spektakuläre Gewalt an Wehrlosen war ihr Geschäftsmodell. Das praktizierten sie nicht nur bei den Strafaktionen gegen die Aufständischen im Sommer 1525: Bei der Plünderung Roms durch deutsche Söldner zwei Jahre später gab es ebenfalls viele Tausend Tote.
Nur passt das nicht zum Gedenken als nationale Geschichtssynchronisation. Die öffentliche Erinnerung an den deutschen Bauernkrieg 1525 ist als religiös unterfütterte Dramaturgie von richtiger gottgefälliger (oder revolutionärer) versus teuflischer falscher Gewalt organisiert. Das Jubiläum des schreienden Unrechts an den Märtyrern für Freiheit und Gleichheit vor fünfhundert Jahren wird zum Beleg für die eigene Überzeugung. Deswegen die heimliche Lust an Märtyrern und Niederlage: Geschichte als Opfer-Porno, geschildert in eindringlichen Details.
Verbunden wird das mit der Beschwörung eines emphatischen und bezeichnend unscharfen "Wir" als selbst ernannte Erbinnen und Erben der Rebellen von damals. "Der" deutsche Bauernkrieg in der Einzahl, so lässt sich aus den Neuerscheinungen zum Jubiläumsjahr lernen, ist eine nationale Gefühlsmaschine; aber nicht aus dem sechzehnten, sondern aus dem zwanzigsten Jahrhundert. Der mythisch überhöhte "schwarze Haufen" aufständischer Bauern unter dem Kommando des Söldnerführers Florian Geyer hat dabei eine besonders reiche Wirkungsgeschichte, von Gerhart Hauptmanns Drama über eine nach ihm benannte SS-Division bis zu einem Roman aus der linken Gegenkultur von 1987. Am liebsten in der ersten Person Plural: "Wir sind des Geyers schwarzer Haufen" sangen ab 1920 linke und rechte Gruppierungen. In Liederbüchern der SS war das gleichnamige Lied ebenso vertreten wie bei der Nationalen Volksarmee und späteren Heavy-Metal-Bands. Textprobe? "Des Edelmannes Kinderlein / die schicken wir in die Höll' hinein. Des Edelmannes Töchterlein / soll heute uns're Buhle sein, heia hoho."
Die letzte Strophe des Liedes ist, gewöhnlich ohne Quellenangabe, in den allgemeinen Sprachgebrauch gewandert. "Geschlagen ziehen wir nach Haus' / die Enkel fechten's besser aus." Jubiläen sind Kostümdramen. Sie handeln aber nicht von der Vergangenheit, sondern von der Selbstinszenierung als letztlich siegreiche Zukunft, mit Personal und Skript von ganz früher. VALENTIN GROEBNER
Peter Seibert: "Die Niederschlagung des Bauernkriegs". Beginn einer deutschen Gewaltgeschichte.
Verlag J.H.W. Dietz Nachf., Bonn 2025. 304 S., geb., 26,- Euro.
Ralf Höller: "Die Bauernkriege 1525/26". Vom Kampf gegen Unterdrückung zum Traum einer Republik.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2024. 266 S., Abb., br., 27,- Euro.
Robert Rebitsch: "Rebellion 1525". Michael Gaismair und der Aufstand der Tiroler Bauern.
Tyrolia Verlag, Innsbruck 2024. 376 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Niederschlagung des Bauernkriegs 1525" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









