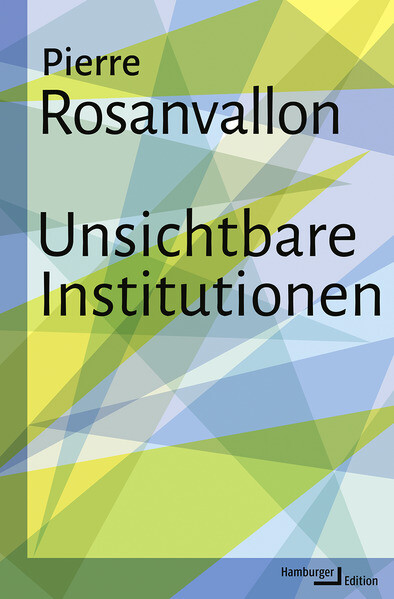
Zustellung: Fr, 22.08. - Mo, 25.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Nie zuvor schienen westliche Regierungen so unfähig, die Gesellschaft zu steuern und zu reformieren. Es ist von »unregierbaren Demokratien«, »Misstrauensgesellschaft« und »öffentlicher Ohnmacht« die Rede, Schlagworte, die den resignierten Fatalismus nähren, in dessen Schatten der Populismus gedeiht.
Um die Grundlagen für eine Erneuerung zu schaffen, konzentriert sich der renommierte Demokratietheoretiker Pierre Rosanvallon auf die Konzepte Vertrauen, Autorität und Legitimität. Diese Konzepte, die auf das Innere der Gesellschaft verweisen, bezeichnet er als unsichtbare Institutionen. Es sind Institutionen, weil sie zur Integration, Kooperation und strukturellen Regulierung von Gesellschaften beitragen. Sie sind unsichtbar, weil sie weder durch Regeln definiert noch mit Möglichkeiten zu ihrer Durchsetzung ausgestattet sind. Sie werden vielmehr durch die Beziehungen zwischen Individuen oder zwischen Individuen und Organisationen konstituiert.
Eine konstruktive Demokratie hängt vom inneren Zusammenhalt einer Gesellschaft ab, die sich als beständig und stabil erweisen muss. Pierre Rosanvallon wirft mit diesem bahnbrechenden Buch ein neues Licht auf die Krisenzeiten, die wir durchleben, und zeichnet Möglichkeiten auf, wie es weitergehen könnte.
Um die Grundlagen für eine Erneuerung zu schaffen, konzentriert sich der renommierte Demokratietheoretiker Pierre Rosanvallon auf die Konzepte Vertrauen, Autorität und Legitimität. Diese Konzepte, die auf das Innere der Gesellschaft verweisen, bezeichnet er als unsichtbare Institutionen. Es sind Institutionen, weil sie zur Integration, Kooperation und strukturellen Regulierung von Gesellschaften beitragen. Sie sind unsichtbar, weil sie weder durch Regeln definiert noch mit Möglichkeiten zu ihrer Durchsetzung ausgestattet sind. Sie werden vielmehr durch die Beziehungen zwischen Individuen oder zwischen Individuen und Organisationen konstituiert.
Eine konstruktive Demokratie hängt vom inneren Zusammenhalt einer Gesellschaft ab, die sich als beständig und stabil erweisen muss. Pierre Rosanvallon wirft mit diesem bahnbrechenden Buch ein neues Licht auf die Krisenzeiten, die wir durchleben, und zeichnet Möglichkeiten auf, wie es weitergehen könnte.
Inhaltsverzeichnis
Die unsichtbaren Institutionen erkennen und begreifen Einleitung 9
I Geschichte und Konzeptualisierung 25
II Stützpfeiler und Grundlagen 85
III Widerstände und Verblendungen 153
Geist und Formen einer Rehabilitation Schluss 247
Bibliografie 267
I Geschichte und Konzeptualisierung 25
II Stützpfeiler und Grundlagen 85
III Widerstände und Verblendungen 153
Geist und Formen einer Rehabilitation Schluss 247
Bibliografie 267
Produktdetails
Erscheinungsdatum
12. Mai 2025
Sprache
deutsch
Untertitel
Originaltitel: Les institutions invisibles.
Seitenanzahl
296
Autor/Autorin
Pierre Rosanvallon
Übersetzung
Michael Bischoff, Ulrike Bischoff
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
französisch
Produktart
gebunden
Gewicht
514 g
Größe (L/B/H)
216/145/27 mm
ISBN
9783868543971
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Ein ebenso gelehrtes wie engagiertes Buch, [. . .] zwischen Warnruf und begründeter Hoffnung. « Le Monde
 Besprechung vom 29.07.2025
Besprechung vom 29.07.2025
Störungen der sozialen Grammatik
Vertrauen, Autorität, Legitimität: Pierre Rosanvallon widmet sich der Frage, was Demokratien lebensfähig hält
Es gehört zu den Paradoxien der Gegenwart, dass Demokratie ebenso omnipräsent wie teils ohnmächtig erscheint. Wahlen finden statt, Regierungswechsel funktionieren, Verfassungen werden gefeiert - und doch wächst das Gefühl, dass etwas Entscheidendes fehlt. Pierre Rosanvallon, emeritierter Historiker am Collège de France, widmet diesem Umstand sein neues Buch "Unsichtbare Institutionen". Der erfrischend frei von Tagespolitik gehaltene Essay will keine weitere Gegenwartsdiagnostik populistischer oder autoritärer Wenden betreiben. Rosanvallon versucht die Aushöhlung demokratischer Systeme vielmehr aus dem Verlust jener Klammern zu erklären, die Gesellschaften mit Demokratie verbinden. Mit unsichtbaren Institutionen sind daher keine verborgenen Schattenreiche wie Lobbyismus oder Bürokratie gemeint, sondern jene Grundlagen unterhalb des Rechts, die Demokratien lebensfähig halten. Hierunter fallen für Rosanvallon Vertrauen, Autorität und Legitimität. Der thematische Zuschnitt wie auch die Fokussierung auf drei Kernbegriffe sind für den französischen Autor nicht neu, blickt man auf seine 2010 erschienene Monographie "Demokratische Legitimität". Wohl ist es aber der damit einhergehende Versuch, die Sozialgeschichte der Demokratie gegen ihre juristische Selbstbeschreibung in Stellung zu bringen.
Beim Lesen der Ausführungen zum zunächst behandelten Vertrauen fällt auf, dass dieses nicht als hehre Tugend innerhalb zwischenmenschlicher Nahebeziehungen firmiert, sondern als Bedingung für den Abbau von Komplexität und Unsicherheiten. Es tritt hier mit einer anderen "sichtbaren Institution" in ein Konkurrenzverhältnis: dem Recht. Der Historiker spürt auch deshalb den römischen fides, der Entstehung des Kreditwesens sowie der Rolle informeller Netzwerke im Außenhandel nach. Vertrauensverhältnisse können so stärker als soziale Technologien gelesen werden, die keine anthropologische Konstante kennen, sondern auf Informationsasymmetrien, Sanktionsmechanismen und wiederholte Erfahrungen reagieren. Die Beispiele zur historischen Vergegenwärtigung mögen selektiv herausgegriffen erscheinen, bilden aber das Kernargument. Eine Demokratie, die sich zu stark auf formalisierte Verfahren verlässt, ohne ihre sozialen Voraussetzungen zu reproduzieren, bleibt zwar formal intakt, wird aber funktional entleert.
Auch Autorität wird nicht als nostalgisches Relikt behandelt, sondern als eine Form symbolischer Präsenz des Gemeinwesens im Individuum. Dass diese Form heute weitgehend unter Verdacht steht, ist Rosanvallon nicht entgangen. Gerade deshalb versucht er sie von autoritärer Resteverwertung frei zu halten, indem er sie als soziale Konfiguration deutet, die ohne konkrete Machtmittel auszukommen versucht. Autorität beruht demnach nicht auf Zwang, sondern auf Anerkennung.
An dieser Stelle findet sich der Träger des Bielefelder Wissenschaftspreises aus dem Jahr 2016 in einer Traditionslinie republikanischen Denkens von Rousseau über Gramsci bis hin zu Arendt wieder. Gegen die verbreitete Vorstellung, Autorität sei per se reaktionär oder autoritär, setzt er die Idee einer richtunggebenden, moralisch anerkannten Instanz, die Konflikte nicht unterdrückt, sondern moderiert. Dass sich deren Anerkennung nicht rechtlich erzwingen lässt, führt Rosanvallon zum dritten Begriff: der Legitimität. Für ihn, wie auch bereits für Carl Schmitt, hat dabei das Auseinanderhalten von Legalität und Legitimität zentrale Bedeutung - ein Unterschied, den viele Demokratietheorien der Gegenwart zugunsten eines positivistischen Verständnisses von Herrschaftsrechtlichkeit eingeebnet haben.
Der Verdienst des Essays ist es hier, daran zu erinnern, dass Legitimität nicht nur formale Zustimmung meint, sondern die Fähigkeit einer Ordnung, sich selbst als gerechtfertigt zu begreifen - abseits von Mehrheiten, Verfahren und Rechtsvorschriften. Dieser Gedanke erhält noch einmal besonderes Gewicht, wenn Rosanvallon an die Erfahrungen der Weimarer Republik, aber auch an die aktuelle Schwäche vieler Repräsentationssysteme erinnert. Eine Regierung, die rechtmäßig gewählt ist, aber kein Vertrauen genießt und keine Autorität ausstrahlt, ist de facto delegitimiert. Auch eine hohe Wahlbeteiligung und Paragraphen können einen solchen Umstand nicht kaschieren. Recht bleibt so vor allem die Funktion, Vertrauen zu stabilisieren und Erwartungen der Rechtsunterworfenen zu schützen.
Ganz um Formalisierung, Verfahren und Recht herum kommt der französische Historiker jedoch nicht. In seinen vorsichtig gehaltenen Lösungsansätzen sind es etwa mit der Verfassungsgerichtsbarkeit erneut sichtbare, juridische Institutionen, die gestärkt werden sollen. Wer darüber hinaus jedoch nach einer konkreten Reformagenda sucht, wird enttäuscht. Doch das ist vielleicht bereits Teil der Pointe: Die Krise der Demokratie ist nicht nur Systemstörung, sondern auch eine Krise ihrer "sozialen Grammatik" (Norbert Elias) und semantischen Grundlagen. Dass viele ihrer Begriffe - wie Autorität, Vertrauen oder Legitimität - entweder abgeblendet oder technisch abgewickelt wurden, sagt hierbei weniger über die Begriffe als über das Blickfeld aktueller Politik aus. Ausflüchte dieser Risiken für die Demokratie ständig antizipieren zu wollen und mithilfe von Recht einzuhegen, laufen so Gefahr, die eigentlichen Wurzeln der Probleme aus den Augen zu verlieren. Rosanvallons Buch lädt vor diesem Hintergrund dazu ein, die nicht kodifizierten Zwischentöne der Demokratie neu zu verinnerlichen und ernst zu nehmen. ALEXANDER WEHDE
Pierre Rosanvallon: "Unsichtbare Institutionen".
Aus dem Französischen von Ulrike und Michael Bischoff. Hamburger Edition, Hamburg 2025. 296 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Unsichtbare Institutionen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









