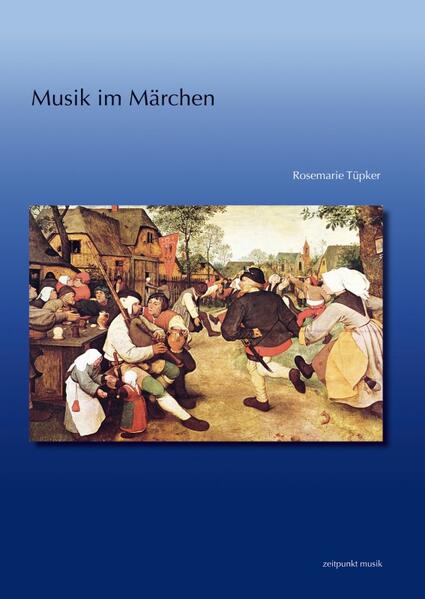
Zustellung: Sa, 16.08. - Sa, 23.08.
Versand in 6 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Music moves us to dance, sometimes until we drop. It immerses us in other worlds, it overcomes boundaries, it arouses longings and desires which often set the development of a story in motion. The author has examined more than three hundred European folktales in search of how music was experienced in the past, away from courts and palaces. In addition to familiar things, she encountered surprising points in the process: Music acts as a witness, uncovering long past crimes, or in a very modern manner it contributes to the shaping of identity.
The comparative study is preceded by detailed depth psychological analyses of three selected music tales: "The Creation of the Violin", "The Donkey" and "The Son Fights against the Father". For the first time, an intersubjective method stemming from morphological psychology is tested on fairy-tale texts so that the ideas that occur to listeners can establish contemporary references to the understanding of the fairy tales in our time.
Additionally, an index with the 329 fairy tales examined makes this book the most comprehensive collection of European fairy tales up to now in which music appears.
The book is a treasure trove for fairy-tale researchers, music scholars and psychologists. But readers who simply find fairy tales appealing and who are enthusiastic about music can make interesting discoveries and find the inspiration for a completely new perspective on supposedly well-known fairy tales.
The comparative study is preceded by detailed depth psychological analyses of three selected music tales: "The Creation of the Violin", "The Donkey" and "The Son Fights against the Father". For the first time, an intersubjective method stemming from morphological psychology is tested on fairy-tale texts so that the ideas that occur to listeners can establish contemporary references to the understanding of the fairy tales in our time.
Additionally, an index with the 329 fairy tales examined makes this book the most comprehensive collection of European fairy tales up to now in which music appears.
The book is a treasure trove for fairy-tale researchers, music scholars and psychologists. But readers who simply find fairy tales appealing and who are enthusiastic about music can make interesting discoveries and find the inspiration for a completely new perspective on supposedly well-known fairy tales.
Musik bewegt zum Tanz, manchmal bis zum Umfallen. Sie lässt uns eintauchen in fremde Welten, überwindet Grenzen, erweckt Sehnsüchte und Begehren, durch die die Entwicklung einer Geschichte oft erst in Gang kommt. Über dreihundert europäische Volksmärchen untersuchte Rosemarie Tüpker auf der Spur des Musikerlebens früherer Zeiten, jenseits der Höfe und Paläste. Neben Bekanntem stieß sie dabei auch auf Verblüffendes: Musik deckt als Zeugin längst vergangene Verbrechen auf oder leistet - ganz modern - einen Beitrag zur Identitätsfindung.
Der vergleichenden Untersuchung vorangestellt sind ausführliche, tiefenpsychologische Analysen von drei ausgewählten Musikmärchen: "Die Erschaffung der Geige", "Das Eselein" und "Der Sohn kämpft gegen den Vater". Durch eine erstmals an Märchentexten erprobte intersubjektive Methode aus der Morphologischen Psychologie werden dabei durch die Einfälle von Hörern aktuelle Bezüge zum Verständnis der Märchen in unserer Zeit geschaffen.
Ein Register mit den 329 untersuchten Märchen macht dieses Buch ganz nebenbei zu der bisher umfassendsten Sammlung europäischer Märchen, in denen Musik vorkommt.
Das Buch ist eine Fundgrube für Märchenforscher, Musikwissenschaftler und Psychologen. Aber auch, wer Märchen einfach spannend findet und sich für Musik begeistert, kann mit diesem Buch aufregende Entdeckungen machen und sich zu einer völlig neuen Sichtweise auf vermeintlich altbekannte Märchen inspirieren lassen.
Märchenausschnitte:
"Hierauf sperrten die Diener des Königs den Jüngling in einen dunklen Kerker. Kaum daß sie die Tür zugesperrt hatten, da wurde es hell und die Feenkönigin Matuya erschien, die den Armen in Bedrängnis hilfreich zur Seite steht. Sie sprach zum Jüngling: »Sei nicht traurig! Du sollst noch die Königstochter heiraten! Hier hast du eine kleine Kiste und ein Stäbchen! Reiß mir Haare von meinem Kopf und spanne sie über die Kiste und das Stäbchen! « Der Jüngling tat also, wie ihm die Matuya gesagt hatte. Als er fertig war, sprach sie: »Streich mit dem Stäbchen über die Haare der Kiste! « Der Jüngling tat es. Hierauf sprach die Matuya:. »Diese Kiste soll eine Geige werden und die Menschen froh oder traurig machen, je nachdem wie du es willst. « Hierauf nahm sie die Kiste und lachte hinein, dann begann sie zu weinen und ließ ihre Tränen in die Kiste fallen."
(Die Erschaffung der Geige, Romamärchen)
"Dieser Spielmann fiedelte so, dass alles tanzen mußte, wenn er aufzuspielen begann. Sogar die Toten erwachten auf ihren Bahren. Lustig tummelten sie sich im Reigen."
(Die sechs Faulpelze und Prinzessin Goldhaar, Frankreich)
"Als die Kühe den Klang der Flöte hören, spitzen sie die Ohren, sie fangen an zu tanzen, es tanzt die Wiese, es tanzen die Wälder, die Flüsse, auch die Berge - alles tanzt, weil es eine Zauberflöte ist."
(Der Aga und seine Schlauheit, Griechenland)
"Da er noch nicht einschlafen konnte, zog er seine Mundharmonika aus der Tasche und fing an, sich eins zu spielen. Bis er mit der Harmonika im Munde einschlief. Aber bald wachte er wieder auf durch ein Rascheln. Als er den Kopf drehte, sah er am Tisch ein schönes Mädchen stehen. Sie hatte ihr Haar gelöst und flocht es vor dem Spiegel in zwei dicke Zöpfe. Das Haar fiel ihr bis über die Hüften und glänzte im Licht so, als stände es im Feuer. . . Es was so schön, dass er merkte, es war kein irdisches Mädchen, sondern ein Geisterwesen."
(Die Mundharmonika, Skandinavien)
"Da ging der Königssohn hinauf, machte das Fenster auf und fing auf seiner Flöte zu spielen an. Das hörte gegenüber im Schloße die Prinzessin, und an dem Tone und der Melodie erkannte sie, daß der gekommen war, welcher sie aus den Händen der Räuber befreit hatte."
(Der Königssohn mit der goldenen Kette, Deutschland)
"Als es die Musik hörte richtete sich das kleine Ding, das bisher in seiner Wiege mäuschenstill gelegen hatte, in die Höhe, grinste und verdrehte sein garstig
Jetzt reinlesen: Inhaltsverzeichnis(pdf)Der vergleichenden Untersuchung vorangestellt sind ausführliche, tiefenpsychologische Analysen von drei ausgewählten Musikmärchen: "Die Erschaffung der Geige", "Das Eselein" und "Der Sohn kämpft gegen den Vater". Durch eine erstmals an Märchentexten erprobte intersubjektive Methode aus der Morphologischen Psychologie werden dabei durch die Einfälle von Hörern aktuelle Bezüge zum Verständnis der Märchen in unserer Zeit geschaffen.
Ein Register mit den 329 untersuchten Märchen macht dieses Buch ganz nebenbei zu der bisher umfassendsten Sammlung europäischer Märchen, in denen Musik vorkommt.
Das Buch ist eine Fundgrube für Märchenforscher, Musikwissenschaftler und Psychologen. Aber auch, wer Märchen einfach spannend findet und sich für Musik begeistert, kann mit diesem Buch aufregende Entdeckungen machen und sich zu einer völlig neuen Sichtweise auf vermeintlich altbekannte Märchen inspirieren lassen.
Märchenausschnitte:
"Hierauf sperrten die Diener des Königs den Jüngling in einen dunklen Kerker. Kaum daß sie die Tür zugesperrt hatten, da wurde es hell und die Feenkönigin Matuya erschien, die den Armen in Bedrängnis hilfreich zur Seite steht. Sie sprach zum Jüngling: »Sei nicht traurig! Du sollst noch die Königstochter heiraten! Hier hast du eine kleine Kiste und ein Stäbchen! Reiß mir Haare von meinem Kopf und spanne sie über die Kiste und das Stäbchen! « Der Jüngling tat also, wie ihm die Matuya gesagt hatte. Als er fertig war, sprach sie: »Streich mit dem Stäbchen über die Haare der Kiste! « Der Jüngling tat es. Hierauf sprach die Matuya:. »Diese Kiste soll eine Geige werden und die Menschen froh oder traurig machen, je nachdem wie du es willst. « Hierauf nahm sie die Kiste und lachte hinein, dann begann sie zu weinen und ließ ihre Tränen in die Kiste fallen."
(Die Erschaffung der Geige, Romamärchen)
"Dieser Spielmann fiedelte so, dass alles tanzen mußte, wenn er aufzuspielen begann. Sogar die Toten erwachten auf ihren Bahren. Lustig tummelten sie sich im Reigen."
(Die sechs Faulpelze und Prinzessin Goldhaar, Frankreich)
"Als die Kühe den Klang der Flöte hören, spitzen sie die Ohren, sie fangen an zu tanzen, es tanzt die Wiese, es tanzen die Wälder, die Flüsse, auch die Berge - alles tanzt, weil es eine Zauberflöte ist."
(Der Aga und seine Schlauheit, Griechenland)
"Da er noch nicht einschlafen konnte, zog er seine Mundharmonika aus der Tasche und fing an, sich eins zu spielen. Bis er mit der Harmonika im Munde einschlief. Aber bald wachte er wieder auf durch ein Rascheln. Als er den Kopf drehte, sah er am Tisch ein schönes Mädchen stehen. Sie hatte ihr Haar gelöst und flocht es vor dem Spiegel in zwei dicke Zöpfe. Das Haar fiel ihr bis über die Hüften und glänzte im Licht so, als stände es im Feuer. . . Es was so schön, dass er merkte, es war kein irdisches Mädchen, sondern ein Geisterwesen."
(Die Mundharmonika, Skandinavien)
"Da ging der Königssohn hinauf, machte das Fenster auf und fing auf seiner Flöte zu spielen an. Das hörte gegenüber im Schloße die Prinzessin, und an dem Tone und der Melodie erkannte sie, daß der gekommen war, welcher sie aus den Händen der Räuber befreit hatte."
(Der Königssohn mit der goldenen Kette, Deutschland)
"Als es die Musik hörte richtete sich das kleine Ding, das bisher in seiner Wiege mäuschenstill gelegen hatte, in die Höhe, grinste und verdrehte sein garstig
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
12. Oktober 2011
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
320
Reihe
zeitpunkt musik
Autor/Autorin
Rosemarie Tüpker
Herausgegeben von
Rosemarie Tüpker
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
31 SW-Abb., 1
Gewicht
714 g
ISBN
9783895008399
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Die Stärke dieses Buches liegt vor allem im praktischen Teil. Die Untersuchung der Assoziationen zur Musik in Märchen regt zum kreativen Assoziieren an. Nicht nur für Interessierte aus den Bereichen der Musikwissenschaft und Märchenforschung, Psychotherapie und Psychologie ist dieses Buch empfehlenswert, sondern ebenso für AusbilderInnen im pädagogischen Sektor. Musik im Märchen verdeutlicht einen Erkenntniszuwachs, den die Märchenforschung der Untersuchung der Bedeutung der Musik in den Märchen verdankt. Die Autorin macht sich dadurch verdient, dass sie diese noch weitgehend ungehobenen Erkenntnisschätze begonnen hat zu heben und anhand illustrativer Untersuchungen in einen Bezug zu Kultur, Alltag und Klinik setzt.
Von Michael Tillmann
In: Psyche, 2013 Nr. 11, S. 1147-1150.
-------------------------------------
Zusammenfassen zeigt uns Tüpker, dass uns Märchen auch heute noch etwas zu sagen haben - gerade für die Arbeit in der Musiktherapie bietet diese Musikmärchensammlung viele Anknüpfungspunkte zu aktuellen, existenziellen Themen (Familienkonflikte, Fragen der Identität, Umgang mit Schicksalsschlägen etc.). Und wenn man sich zum Schluss etwas wünschen könnte, dann wären lange Winterabende am Kamin, an denen man sich diese Märchen vorliest und dazu Musik macht.
Von Thomas Stegmann
In: In: Österreichische Berufsverband der MusiktherapeutInnen. Mitteilungsblatt 4-12, S. 19.
--------------------------------------
Mit dem abschließenden Register der 329 untersuchten Märchen legt Rosemarie Tüpker die umfassendste Sammlung europäischer Märchen vor, in denen Musik vorkommt. Damit ist das Buch eine Fundgrube für Märchenforscher, Musikwissenschaftler und Psychologen. Aber auch, wer Märchen einfach spannend findet und sich für Musik begeistert, kann mit diesem Buch auf eine aufregende Entdeckungsreise gehen.
Es ist ein hoch wissenschaftliches und zugleich ungemein spannend und lebendig zu lesendes Buch, das den Leser in seinen Bann zieht. Die Autorin zeigt auf, dass Märchen lebendig und aktuell sind und die Beschäftigung damit zu Freude, Hilfe und Bereicherung führen kann.
Monika Nöcker-Ribaupierre
In: socialnet.
http://www. socialnet. de/rezensionen/12856. php
(4. April 2013)
-----------------------------------
Zwei gute Gründe, sich das im Reichert Verlag erschienene Buch Musik im Märchen von Rosemarie Tüpker vorzunehmen. Es handelt sich um eine Sammlung und Analyse von über 300 europäischen Musikmärchen, d. h. Geschichten, in denen die Musik oder Musikinstrumente eine Rolle spielen. Der dritte gute Grund - im Märchen eine bedeutsame Zahl - ist der, dass es Tüpker gelungen ist, in diesem Buch Wissenschaft und Kunst in einer sehr anregenden Art und Weise zu verbinden. anregend zum einen deshalb, weil die Autorin den Leser einlädt, sich seinen eigenen Reim auf die tiefenpsychologischen Aspekte der Märchen zu machen, zum anderen, weil viele Märchen wörtlich oder nacherzählend in den Text aufgenommen wurden und somit zum Schmökern und zum Nachlesen animieren. Allein der Umfang und die Vielfältigkeit der von Tüpker zusammengetragenen Märchen und die sorgfältig recherchierten Quellenangaben sind faszinierend. (. . .)
Zusammenfassend zeigt uns Tüpker, dass uns Märchen auch heute noch etwas zu sagen haben - gerade für die Arbeit in der Musiktherapie bietet diese Musikmärchensammlung viele Anknüpfungspunkte zu aktuellen, existentiellen Themen (Familienkonflikte, Fragen der Identität, Umgang mit Schicksalsschlägen etc.).
Und wenn man sich zum Schluss etwas wünschen könnte, dann wären es lange Winterabende am Kamin, an denen man diese Märchen vorliest und dazu Musik macht.
Thomas Stegemann
In: ÖBM Mitteilungsblatt. 4/2012. S. 18-19.
-----------------------------------
Historisches Musikverständnis und aktuelles Erleben von Musik in Märchen bilden zwei Schwerpunkte, aus denen sich die anzuzeigende Abhandlung von Rosemarie Tüpker speist. Neben einigen Publikationen zur Musiktherapie kommen der Autorin hierbei vor allem auch ihr Methodenrepertoire der psychologischen Forschung sowie ihre langjährige psychotherapeutische Erfahrung zugute. Dies ermöglicht ihr eine Arbeit im Schnittfeld verschiedenster Fachdisziplinen zwischen Musikwissenschaft, Kultur- und Tiefenpsychologie. Historische Kontinuität und Wandel von Musikverständnis spielen in der subjektiven Auseinandersetzung mit Instrumenten und Musik im Märchen eine wichtige Rolle. Drei tiefenpsychologische Märchenanalysen zum Märchen Die Erschaffung der Geige sowie zu dem Grimm' schen Märchen Das Eselein und dem Roma-Märchen Der Sohn kämpft gegen den Vater werden exemplarisch angeführt. Individuelles Erleben wird dabei zum Ausgangspunkt möglicher psychologischer Deutungen. Dem folgt eine textvergleichend-psychologische Betrachtung von über 300 europäischen Volksmärchen, in welchen Musik eine Rolle spielt. Bei der Kategorisierung folgt Tüpker keinen üblichen Typen der Märchenforschung, vielmehr kristallisieren sich aus ihrem tiefenpsychologischen Zugang eigene Typisierungen der Musik als Bewegende, als Verbindende zweier Welten, als das Fremde, als das Begehrte, als Zeugin und als Identitätsstifterin (S. 12) - eine Betrachtung, die zwischen den scheinbar autarken Fachdisziplinen auf integrative Weise vermittelt.
In: Märchenspiegel. 23 (2012) Heft 3. S. 52.
-----------------------------------
Rosemarie Tüpker, die die Musiktherapie an der Universität Münster akademisch vertritt, hat noch ein weiteres, sehr schönes Buch verfaßt: Musik im Märchen (Reichert-Verlag 2011) klingt der Titel, der überrascht. Aber schlägt man das Buch auf, kommt einem mit Wärme die ungemeine Belesenheit der Autorin entgegen, die die Märchen als Quelle der Inspiration (S.
19) rehabilitiert. Sie hat eine umfangreiche Sammlung von jenen Märchen zusammengestellt, in denen von Musik die Rede ist; sie analysiert das Echo von musiktherapeutischen Studenten auf diese Märchen auf eine Weise, die nicht nur in manchen Zweigen der qualitativen Forschung gut gegru ndet ist, sondern die mir als Leser manches bemerkenswert erscheinen lässt, das ich bei der Lektüre der präsentierten Märchen gar nicht bemerkt hatte. Das wird an zwei Märchen, Das Laute spielende Eselein und an Der Sohn kämpft gegen den Vater exemplarisch und umfangreich demonstriert - und am beeindruckendsten ist, wie die Autorin die Darstellung der Märchen mit Details aus anderen Gattungen, etwa Photographien von Details aus Kathedralen gleichsam garniert, die nur ein sehr aufmerksames Auge hat entdecken können. Hier findet eine archivalische Sammlerfreude nicht nur zu psychologischer Märchenanalyse, sondern erweitert sich zu historischer Kulturanalyse. Insgesamt sind mehr als 300 Märchen - eine Liste sämtlicher Märchen mit Musik findet sich im Anhang - analysiert. Die Musik erscheint hier in einer Verfassung, in der Soma und Psyche noch deutlich weniger von einander unterschieden waren als wir dies heute gewohnt sind (S. 271), sie bewegt machtvoll zum Tanz. Weil man sich dieser Macht nicht entziehen kann, wird sie sowohl göttlich als auch diabolisch konnotiert. Die Instrumente selbst haben magische Kraft,
sie müssen nicht erlernt werden. Erst viel später erlangt die Musik den Status, wie wir sie heute vermuten: dass sie Gefühle ausdrücke und dass sie somit beiträgt, ein Seelisches zu erschaffen. Sie kommt aus anderen Welten und bringt doch unsere zu sich selbst; sie öffnet Türen ins Fremde und die erweisen sich, wenn man hindurch geht, als Schritt zur Heimkehr. Die Musik ist somit gerade nicht nur Gestalt des Übergangs, sondern auch des Tausches. Das Buch ist durch sein Thema einzigartig, geht selbst durch bislang ungeöffnete Tu ren sowohl des Musik- wie Märchenverständnisses und vollzieht in dieser Kombination, wovon es inhaltlich überzeugend handelt.
Michael B. Buchholz
In: Psycho-News-Letter (PNL). Nr. 88 (2011). S. 16.
-----------------------------------
Eine Geschenk-Idee für jeden Musikinteressierten, nicht nur irgendein Märchenbuch. Und ein Muss für Musiker.
So schnörkelfrei und lebendig wie das Titelblatt ist das ganze Buch. Wer sich für die Theorie weniger interessiert, kann sich auch mit Vergnügen auf die wiedergegebenen Märchen beschränken. Aber es ist wenig wahrscheinlich, dass man es fertig bringt, nicht auch die Deutung zu lesen. Ein wunderbares Buch! Man kann darüber zum Märchenerzähler werden.
Jan Reichow
In: http://www. janreichow. de/wordpress/? p=5733 (9. Januar 2012)
Von Michael Tillmann
In: Psyche, 2013 Nr. 11, S. 1147-1150.
-------------------------------------
Zusammenfassen zeigt uns Tüpker, dass uns Märchen auch heute noch etwas zu sagen haben - gerade für die Arbeit in der Musiktherapie bietet diese Musikmärchensammlung viele Anknüpfungspunkte zu aktuellen, existenziellen Themen (Familienkonflikte, Fragen der Identität, Umgang mit Schicksalsschlägen etc.). Und wenn man sich zum Schluss etwas wünschen könnte, dann wären lange Winterabende am Kamin, an denen man sich diese Märchen vorliest und dazu Musik macht.
Von Thomas Stegmann
In: In: Österreichische Berufsverband der MusiktherapeutInnen. Mitteilungsblatt 4-12, S. 19.
--------------------------------------
Mit dem abschließenden Register der 329 untersuchten Märchen legt Rosemarie Tüpker die umfassendste Sammlung europäischer Märchen vor, in denen Musik vorkommt. Damit ist das Buch eine Fundgrube für Märchenforscher, Musikwissenschaftler und Psychologen. Aber auch, wer Märchen einfach spannend findet und sich für Musik begeistert, kann mit diesem Buch auf eine aufregende Entdeckungsreise gehen.
Es ist ein hoch wissenschaftliches und zugleich ungemein spannend und lebendig zu lesendes Buch, das den Leser in seinen Bann zieht. Die Autorin zeigt auf, dass Märchen lebendig und aktuell sind und die Beschäftigung damit zu Freude, Hilfe und Bereicherung führen kann.
Monika Nöcker-Ribaupierre
In: socialnet.
http://www. socialnet. de/rezensionen/12856. php
(4. April 2013)
-----------------------------------
Zwei gute Gründe, sich das im Reichert Verlag erschienene Buch Musik im Märchen von Rosemarie Tüpker vorzunehmen. Es handelt sich um eine Sammlung und Analyse von über 300 europäischen Musikmärchen, d. h. Geschichten, in denen die Musik oder Musikinstrumente eine Rolle spielen. Der dritte gute Grund - im Märchen eine bedeutsame Zahl - ist der, dass es Tüpker gelungen ist, in diesem Buch Wissenschaft und Kunst in einer sehr anregenden Art und Weise zu verbinden. anregend zum einen deshalb, weil die Autorin den Leser einlädt, sich seinen eigenen Reim auf die tiefenpsychologischen Aspekte der Märchen zu machen, zum anderen, weil viele Märchen wörtlich oder nacherzählend in den Text aufgenommen wurden und somit zum Schmökern und zum Nachlesen animieren. Allein der Umfang und die Vielfältigkeit der von Tüpker zusammengetragenen Märchen und die sorgfältig recherchierten Quellenangaben sind faszinierend. (. . .)
Zusammenfassend zeigt uns Tüpker, dass uns Märchen auch heute noch etwas zu sagen haben - gerade für die Arbeit in der Musiktherapie bietet diese Musikmärchensammlung viele Anknüpfungspunkte zu aktuellen, existentiellen Themen (Familienkonflikte, Fragen der Identität, Umgang mit Schicksalsschlägen etc.).
Und wenn man sich zum Schluss etwas wünschen könnte, dann wären es lange Winterabende am Kamin, an denen man diese Märchen vorliest und dazu Musik macht.
Thomas Stegemann
In: ÖBM Mitteilungsblatt. 4/2012. S. 18-19.
-----------------------------------
Historisches Musikverständnis und aktuelles Erleben von Musik in Märchen bilden zwei Schwerpunkte, aus denen sich die anzuzeigende Abhandlung von Rosemarie Tüpker speist. Neben einigen Publikationen zur Musiktherapie kommen der Autorin hierbei vor allem auch ihr Methodenrepertoire der psychologischen Forschung sowie ihre langjährige psychotherapeutische Erfahrung zugute. Dies ermöglicht ihr eine Arbeit im Schnittfeld verschiedenster Fachdisziplinen zwischen Musikwissenschaft, Kultur- und Tiefenpsychologie. Historische Kontinuität und Wandel von Musikverständnis spielen in der subjektiven Auseinandersetzung mit Instrumenten und Musik im Märchen eine wichtige Rolle. Drei tiefenpsychologische Märchenanalysen zum Märchen Die Erschaffung der Geige sowie zu dem Grimm' schen Märchen Das Eselein und dem Roma-Märchen Der Sohn kämpft gegen den Vater werden exemplarisch angeführt. Individuelles Erleben wird dabei zum Ausgangspunkt möglicher psychologischer Deutungen. Dem folgt eine textvergleichend-psychologische Betrachtung von über 300 europäischen Volksmärchen, in welchen Musik eine Rolle spielt. Bei der Kategorisierung folgt Tüpker keinen üblichen Typen der Märchenforschung, vielmehr kristallisieren sich aus ihrem tiefenpsychologischen Zugang eigene Typisierungen der Musik als Bewegende, als Verbindende zweier Welten, als das Fremde, als das Begehrte, als Zeugin und als Identitätsstifterin (S. 12) - eine Betrachtung, die zwischen den scheinbar autarken Fachdisziplinen auf integrative Weise vermittelt.
In: Märchenspiegel. 23 (2012) Heft 3. S. 52.
-----------------------------------
Rosemarie Tüpker, die die Musiktherapie an der Universität Münster akademisch vertritt, hat noch ein weiteres, sehr schönes Buch verfaßt: Musik im Märchen (Reichert-Verlag 2011) klingt der Titel, der überrascht. Aber schlägt man das Buch auf, kommt einem mit Wärme die ungemeine Belesenheit der Autorin entgegen, die die Märchen als Quelle der Inspiration (S.
19) rehabilitiert. Sie hat eine umfangreiche Sammlung von jenen Märchen zusammengestellt, in denen von Musik die Rede ist; sie analysiert das Echo von musiktherapeutischen Studenten auf diese Märchen auf eine Weise, die nicht nur in manchen Zweigen der qualitativen Forschung gut gegru ndet ist, sondern die mir als Leser manches bemerkenswert erscheinen lässt, das ich bei der Lektüre der präsentierten Märchen gar nicht bemerkt hatte. Das wird an zwei Märchen, Das Laute spielende Eselein und an Der Sohn kämpft gegen den Vater exemplarisch und umfangreich demonstriert - und am beeindruckendsten ist, wie die Autorin die Darstellung der Märchen mit Details aus anderen Gattungen, etwa Photographien von Details aus Kathedralen gleichsam garniert, die nur ein sehr aufmerksames Auge hat entdecken können. Hier findet eine archivalische Sammlerfreude nicht nur zu psychologischer Märchenanalyse, sondern erweitert sich zu historischer Kulturanalyse. Insgesamt sind mehr als 300 Märchen - eine Liste sämtlicher Märchen mit Musik findet sich im Anhang - analysiert. Die Musik erscheint hier in einer Verfassung, in der Soma und Psyche noch deutlich weniger von einander unterschieden waren als wir dies heute gewohnt sind (S. 271), sie bewegt machtvoll zum Tanz. Weil man sich dieser Macht nicht entziehen kann, wird sie sowohl göttlich als auch diabolisch konnotiert. Die Instrumente selbst haben magische Kraft,
sie müssen nicht erlernt werden. Erst viel später erlangt die Musik den Status, wie wir sie heute vermuten: dass sie Gefühle ausdrücke und dass sie somit beiträgt, ein Seelisches zu erschaffen. Sie kommt aus anderen Welten und bringt doch unsere zu sich selbst; sie öffnet Türen ins Fremde und die erweisen sich, wenn man hindurch geht, als Schritt zur Heimkehr. Die Musik ist somit gerade nicht nur Gestalt des Übergangs, sondern auch des Tausches. Das Buch ist durch sein Thema einzigartig, geht selbst durch bislang ungeöffnete Tu ren sowohl des Musik- wie Märchenverständnisses und vollzieht in dieser Kombination, wovon es inhaltlich überzeugend handelt.
Michael B. Buchholz
In: Psycho-News-Letter (PNL). Nr. 88 (2011). S. 16.
-----------------------------------
Eine Geschenk-Idee für jeden Musikinteressierten, nicht nur irgendein Märchenbuch. Und ein Muss für Musiker.
So schnörkelfrei und lebendig wie das Titelblatt ist das ganze Buch. Wer sich für die Theorie weniger interessiert, kann sich auch mit Vergnügen auf die wiedergegebenen Märchen beschränken. Aber es ist wenig wahrscheinlich, dass man es fertig bringt, nicht auch die Deutung zu lesen. Ein wunderbares Buch! Man kann darüber zum Märchenerzähler werden.
Jan Reichow
In: http://www. janreichow. de/wordpress/? p=5733 (9. Januar 2012)
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Musik im Märchen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.












