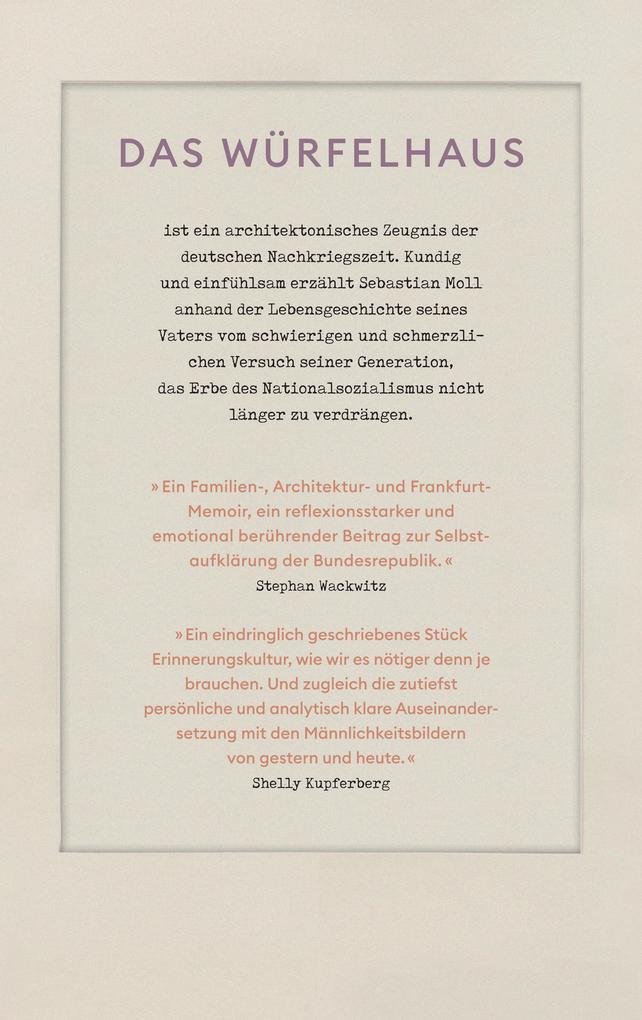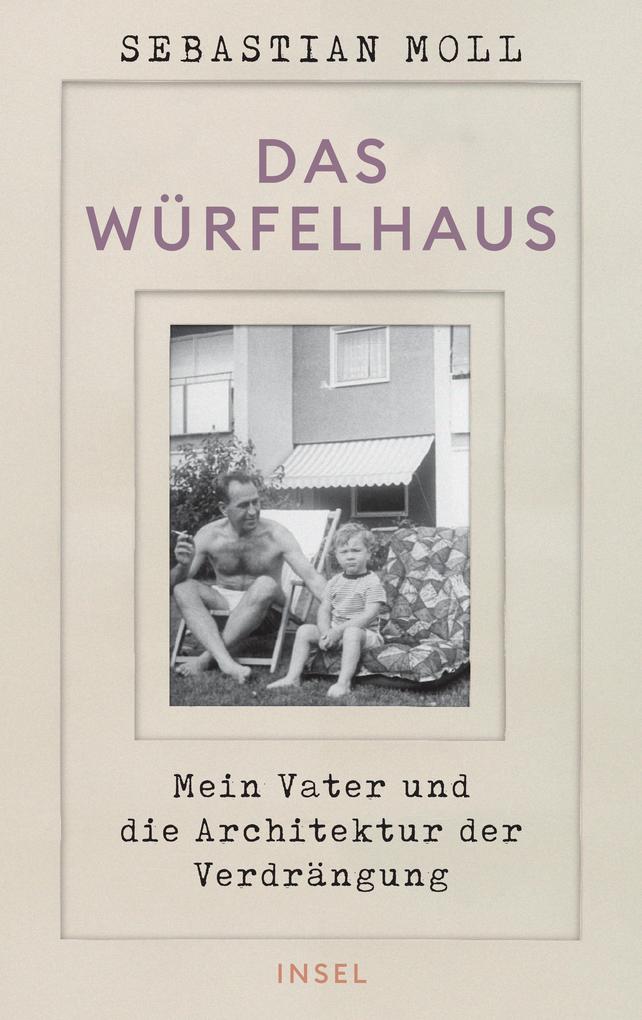
Als Sebastian Molls Vater in den 60er Jahren ein Zuhause für seine Familie baute, verband er damit eine Hoffnung: die Vergangenheit vergessen. Denn als Angehöriger der Flakhelfer-Generation hatte er Nazi-Indoktrinierung, Kriegstrauma sowie die seelische Verstümmelung durch den faschistischen Männlichkeits-Kult erlitten. Mit dem Bau eines Vorort Reihenhauses im Süden Frankfurts vollzog er diesen Neuanfang architektonisch, zudem prägte er als Städteplaner einer Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft den Neuaufbau seiner Heimat und trieb so eine Architektur der Verdrängung voran, die bis heute die deutschen Städte prägt. Doch sowohl im Privaten als auch im Leben der Stadt meldete sich das Verdrängte zurück.
Das Würfelhaus ist eine architektonische Freilegung der deutschen Nachkriegszeit. Kundig und einfühlsam erzählt Sebastian Moll anhand seiner Familiengeschichte den schwierigen und schmerzlichen Versuch seiner Generation und mit ihr der deutschen Gegenwart, das Erbe des Nationalsozialismus abzutragen.
»Sebastian Moll gelingt es eindringlich, eine familiäre Black Box zu füllen und dabei berührend, zutiefst persönlich und zugleich klar analytisch der Frage nach Männlichkeitsbildern gestern und heute nachzugehen. Ein spannend geschriebenes Stück Erinnerungskultur, wie wir es nötiger denn je brauchen. « Shelly Kupferberg
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Moll liefert mit seinem Essay einen psychogeografischen Abriss über den Städtebau von Frankfurt am Main. Und er wirft Fragen auf mit dem Fokus auf die Generation Flakhelfer . . . die es sich im derzeitigen politischen Klima in Deutschland erneut zu stellen lohnt. « Kathrin Schömer, taz. die tageszeitung
»»Das Würfelhaus« ist eine lohnende Lektüre, die das Gerede von der ach so gelungenen Aufarbeitung Lügen straft. « Benjamin Schlodder, Jungle World
»Ein eindringlich geschriebener, wertvoller Beitrag zur Erinnerungsgeschichte. « Marcus Golling, Südwest Presse
»Eine mutige Konfrontation mit familiären Narben, verwoben mit deutscher Erinnerungskultur in der Stadtgeschichte. « Frankfurter Neue Presse
»Das Buch ist eine gelungene Mischung aus persönlicher und architektonischer Biografie. Es handelt sich um zwei Bücher in einem: eine literarische Verarbeitung einer Kriegs- und Nachkriegs-Familienvita. Und einen sachlichen Text über die Architekturgeschichte Frankfurts im 20. Jahrhundert. « Frankfurter Rundschau
»Die Sozialisation des eigenen Vaters in der Nazi-Zeit und der Versuch eines Neubeginns nach dem Krieg das ließ sich in den verschiedenen Etagen des Elternhauses ablesen, wie in den Schichten einer archäologischen Ausgrabung. Und mehr noch: Sebastian Moll erkennt diese Schichten der Verdrängung auch in der Architektur unserer Städte . . . Über all das hat [er] ein faszinierendes Buch geschrieben« Hessischer Rundfunk
»Eine mitreißende Geschichte von Verdrängung und Wiederkehr. « Thomas Gross, Deutschlandfunk Kultur
» ein persönliches Stück Erinnerungskultur. « chrismon plus
 Besprechung vom 01.04.2025
Besprechung vom 01.04.2025
Hitler kam nur bis Niederrad
Sebastian Moll erinnert sich an seinen Vater und sinniert über den Umgang der Stadt Frankfurt mit dem baulichen Erbe der Nachkriegszeit
Mit den Details der Frankfurter Stadtgeschichte hat es Sebastian Moll nicht so. Es gab hier, anders als von ihm behauptet, nie eine amerikanische Botschaft, sondern immer nur ein Generalkonsulat; der erste Spatenstich für die Reichsautobahn durch Hitler fand nicht am Rebstockgelände statt, sondern am Mainufer in Niederrad. Und es war der Architekt Eugen Blanck und nicht Herbert Boehm, der maßgeblich am Entwurf für den Wiederaufbau der Paulskirche nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligt war.
Nun könnte man einwenden, es handele sich um Petitessen, wie sie einem Autor schon einmal unterlaufen können, der das Pech hat, dass sein Verlag am Lektorat spart. Das Problem ist nur, dass Moll eine Art Anklage verfasst hat. Und dieses Genre erfordert besondere Sorgfalt; wer da im Detail schlampig arbeitet, sät Zweifel an der Zuverlässigkeit auch in den großen Linien.
In seinem Memoir geht Moll der Frage nach, warum er bis heute unter einer existenziellen Unsicherheit leidet, die es ihm schwer mache, stabile Paarbeziehungen aufzubauen. Als Schuldigen hat er seinen Vater ausgemacht, von dem er sich schon als Jugendlicher entfremdet habe, während seine Mutter zur Alkoholikerin wurde. Den Charakter des Vaters, Jahrgang 1927, interpretiert der Sohn mittels des Begriffsbestecks aus Klaus Theweleits "Männerphantasien": Demnach hat sich der einst glühende Hitlerjunge und mit Todesmut in den Endkampf an der Ostsee gezogene Soldat nach Kriegsende nur oberflächlich zum sozialdemokratisch gesinnten Kleinfamilienvater in einer Neubausiedlung vor den Toren Frankfurts entwickelt; im Inneren sei Heinz Moll ein soldatisch-faschistischer Mann mit einer tief sitzenden Angst vor dem Weiblichen geblieben, die er hinter einem muskulösen Körperpanzer verborgen habe. Auch einen Hang zu Exhibitionismus und Sadismus stellt der Sohn beim Vater fest.
Das ganze Elend der elterlichen Ehe manifestiert sich für Moll geradezu aufdringlich im titelgebenden Würfelhaus der Familie, errichtet von der Wohnungsbaugesellschaft, für die Vater Moll als kaufmännische Führungskraft tätig war. Es handelt sich um eines jener Reihenhäuser in schlichten rechteckigen Formen, die in den Sechzigerjahren zu Abertausenden in Deutschland gebaut wurden. Das Wohnzimmer hatte sich das Paar mit Designermöbeln im rationalen Stil von Dieter Rams eingerichtet, doch bald zog sich der Vater nach Molls Schilderung immer häufiger in seinen Kellerraum zurück, um dort seine dunkle Seite auszuleben - er vertiefte sich in die Lektüre von alten Kriegszeitschriften und neuen Pornoheften.
Es sind traurige Erinnerungen, und es gibt keinen Anlass, am Bemühen des Autors um Wahrhaftigkeit zu zweifeln. Aber da er seine toxische Familiengeschichte nun einmal der Öffentlichkeit präsentiert, muss er sich die Frage gefallen lassen, inwieweit seine Ursachenanalyse auch für Außenstehende überzeugend gerät.
Auf die Theweleit-Spur haben ihn hinterlassene Briefe und Aufzeichnungen des Vaters gebracht. Sie belegen eine schwärmerische Jugendfreundschaft mit einem um ein Jahr Älteren, in der Nietzsche-Verehrung, Führerkult, Todessehnsucht und Homoerotik mitschwingen. Reicht das aus, um den Vater, der bei Kriegsende gerade achtzehn Jahre alt war, zur faschistischen Persönlichkeit zu stempeln? Oder wurzelte das Vorstadt-Unglück nicht doch in weniger zeitspezifischen und banaleren Defiziten der handelnden Personen?
Es fällt jedenfalls auf, dass es Sohn Moll gleich zweimal unterlässt, wichtige Zeuginnen aufzusuchen, die womöglich ein lustvoll-entspanntes Verhältnis seines Vaters zu Frauen hätten bezeugen können: dessen Jugendliebe aus dem Elsass und die Sekretärin, mit der er eine lange Affäre unterhielt. Dazu passt, dass die Fragen an die Mutter, aufgewachsen in einem Haushalt starker Frauen und von klein auf dazu erzogen, sich nicht von einem Mann abhängig zu machen, merkwürdig defensiv ausfallen. Die Frage, wieso es diese großstädtisch geprägte Frau, die offenbar erfolgreich als Lektorin tätig war, in der Ehe in der Vorstadthölle ausgehalten hat, drängt sich auf. Der Autor stellt sie nicht.
Er bemüht sich stattdessen darum, die Familiengeschichte auf einer allgemeineren Ebene zu spiegeln, nämlich im Umgang der Stadt Frankfurt - geliebte Heimat seiner Mutter - mit dem baulichen Erbe der Nachkriegszeit. Was das Würfelhaus für das Ehepaar Moll bedeutete, war demnach der Wiederaufbau des Stadtzentrums in modernen Formen für die Stadtgesellschaft: Ausdruck einer Verdrängung. Die Beseitigung beinahe alles Alten sei gegen Proteste aus der Bevölkerung von einer kleinen Planerelite rücksichtslos ins Werk gesetzt worden, so Moll. Eine Vorstellung davon, was stattdessen die richtige architektonische Antwort auf das Erbe deutscher Schuld gewesen wäre, entwickelt er nicht. Rekonstruktionen, wie sie viel später unter Akklamation durch die Bevölkerungsmehrheit mehr oder weniger erfolgreich versucht wurden, taugen dem Autor noch weniger als die Nachkriegsmoderne.
Die scheint er vielmehr doch irgendwie für wertvoll zu halten, wie sich aus seiner Haltung in der Debatte um die künftige Gestaltung der sanierungsbedürftigen Paulskirche ablesen lässt. Ärgerlich nur, dass sich Moll in diesem Zusammenhang nicht nur kleinerer Faktenfehler, sondern sogar der üblen Nachrede schuldig macht, wenn er behauptet, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe in einer Rede das Dritte Reich als Ausrutscher der deutschen Geschichte bewertet. Weitere Fehlinterpretationen deuten darauf hin, dass der Autor, der als Journalist zwischen New York und Frankfurt pendelt, die Zwischentöne in der Paulskirchen-Diskussion nicht zu deuten weiß.
Man klappt das Buch nach der Lektüre mit Beklemmung zu - in der Hand das Dokument eines wenig plausiblen Versuchs, komplizierte private und öffentliche Angelegenheiten mittels vorgefertigter Begriffe bei eingeschränkter Wahrnehmung zu sortieren. Das schreckensbelegte Würfelhaus ist inzwischen umgebaut worden, doch auch der neue Stil gefällt dem Autor nicht. Er mokiert sich darüber, dass sich der Geist der Neuen Sachlichkeit den neuen Eigentümern nicht mitgeteilt habe. Es könnte sein, dass es sich um eine glückliche Familie handelt. MATTHIAS ALEXANDER
Sebastian Moll: "Das Würfelhaus". Mein Vater und die Architektur der Verdrängung.
Insel Verlag, Berlin 2024. 207 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.