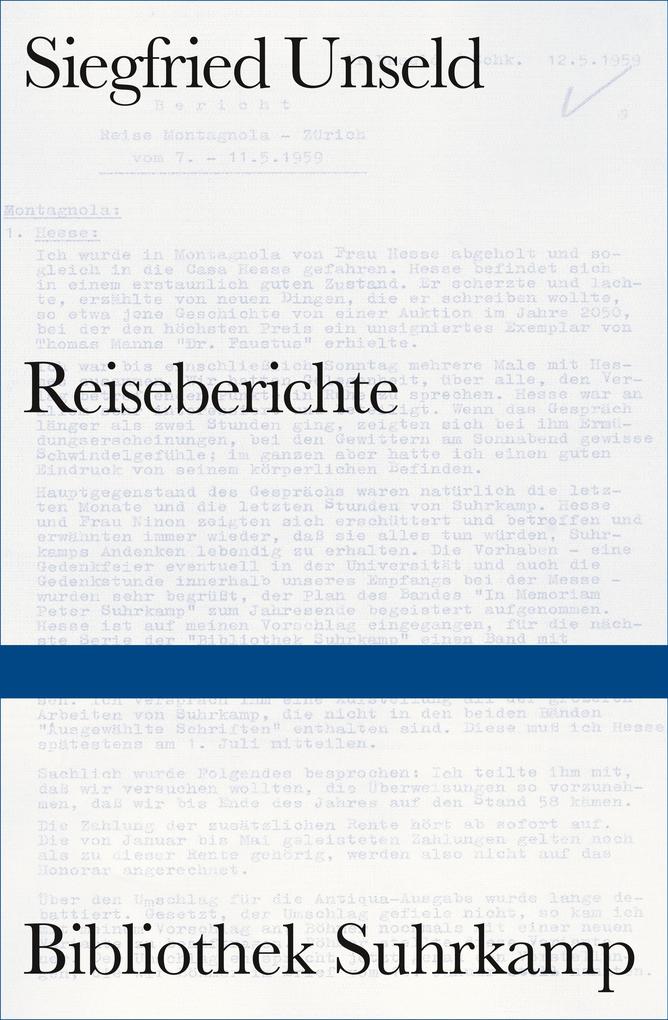Besprechung vom 24.06.2020
Besprechung vom 24.06.2020
Nach Japan war alles anders
Mehr als 1500 Reiseberichte hat der legendäre Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld hinterlassen. Nun erscheint eine schmale Auswahl und zeigt den Verfasser als Geschäftsmann und Literaten.
Der deutsche Verleger, der im Herbst 1985 in Japan unterwegs war, hatte sich interessante Autoren des Landes empfehlen lassen und bemühte sich, einige von ihnen zu treffen. Ausdrücklich ging es Siegfried Unseld um Haruki Murakami, dessen Roman "Pinball, 1973" er in einer englischen Ausgabe gelesen hatte - "der Autor hat mich sehr überzeugt", notiert der Verleger: "Haruki Murakami ist ein großer Liebhaber von Rockmusik und Jazz, und sein Roman ,Pinball, 1973' ist durchaus auch davon geprägt. Auch hier ist noch ein Übersetzer zu finden. Es gibt noch zwei neue Werke von ihm, einen Roman ,Hardboiled Wonderland und das Ende der Welt' und eine Erzählungssammlung, an der er sehr hängt, ,Karussell in der Sackgasse'." Im Übrigen bestehe Murakami darauf, seine Rechte selbst zu verwalten und dass Verlagsverträge nur mit ihm persönlich abzuschließen seien. Tatsächlich erschienen danach 1991 "Wilde Schafsjagd" und 1995 "Hard-boiled Wonderland" im Insel-Verlag, den Unseld zusammen mit dem Suhrkamp-Verlag leitete. Es waren die ersten Bücher von Murakami in deutscher Sprache, so dass man vor Unselds Gespür wieder einmal nur den Hut ziehen kann. Die Treue halten wollte der Verlag dem japanischen Autor dann aber nicht, so dass Murakami noch die Stationen Rowohlt und Berlin durchlaufen musste, ehe er 1998 bei DuMont seine deutsche Heimat fand.
Den Beginn dieser Akquise hielt Unseld in seinem Reisebericht aus Japan fest. Insgesamt habe der Verleger im Verlauf von mehr als vierzig Jahren gut 1500 solcher Texte angefertigt, schätzte der langjährige Suhrkamp-Cheflektor Raimund Fellinger, der 35 davon ausgewählt und herausgegeben hat, das Erscheinen des Bandes aber nicht mehr erlebte (F.A.Z. vom 28. April). Es handelt sich offenbar um denselben Inhalt, der vor mehr als zehn Jahren bereits erscheinen sollte, der Band war für Anfang 2010 angekündigt, wurde dann aber auf den Oktober desselben Jahres verschoben, ohne dass es zu einer Publikation gekommen war. Allerdings wurde das Gesamtmaterial für Briefeditionen von Suhrkamp-Autoren ausgewertet, und auch die beiden ebenfalls von Fellinger herausgegebenen Bände der "Siegfried Unseld Chronik" speisen sich zum Teil aus dieser Quelle.
Er konnte ja nicht überall sein.
Der neue Auswahlband beginnt im April 1959 mit einer Berlin-Reise des damals 34 Jahre alten Unseld. Der Verlagsgründer Peter Suhrkamp war damals noch keine zwei Wochen tot, sein Nachfolger besprach in Ost-Berlin unter anderem mit Bertolt Brechts Witwe Helene Weigel den Stand der unterschiedlichen Brecht-Editionen, wobei Unselds Wille um ein gutes Einvernehmen deutlich wird: "Der Henschel-Verlag veranstaltete Modell-Bücher ,Courage' und ,Galilei'. Darin wurden unerlaubterweise auch die Texte veröffentlicht. Ich habe dies nachträglich genehmigt. Ich werde dies noch an Frau Weigel für Henschel schreiben und darauf hinweisen, daß in Zukunft solche Vereinbarungen mit uns zu treffen sind." Als zwölf Jahre später nach dem Tod Helene Weigels der Nachlass Brechts beschlagnahmt werden soll, gelingt es Unseld, die Rechte des Verlags zu verteidigen.
Kurz nach der Ost-Berlin-Reise von 1959 besucht Unseld Max Frisch in der Schweiz: "Wir besprachen als erstes die Vertragssituation." In Winterthur wird mit dem Suhrkamp-Teilhaber Reinhart ein "sehr ausführliches und fruchtbares Gespräch" geführt, und die Protokolle dieser ersten Reisen, deren Prosa aus der vermittelten Mündlichkeit im Diktieren erwächst, entsprechen ganz ihrem Zweck: Der Verleger reist, führt Verhandlungen, dann teilt er das Ergebnis denen mit, die im Verlag geblieben sind, und zwar so, dass darin nicht nur das Erreichte dokumentiert wird, sondern auch jeder weiß, was er zu tun hat: "Herr Dr. Hornung: dies bitte prüfen", heißt es, wenn es um die Notwendigkeit geht, einen Teil der Brecht-Ausgabe neu setzen zu lassen, oder nach einer Paris-Reise im folgenden Jahr: "Bekommen wir regelmäßig ,Théâtre populaire', die Zeitschrift, die Voisin zusammen mit Duvignand herausgibt? Wenn nicht, Notiz an Voisin. Sie ist ja sehr wichtig, und nicht nur zu Informationszwecken."
Wer diesen ersten Teil des Bandes liest, erlebt einen Verlag im Aufbruch, und es ist Unseld, der diesen Aufbruch verkörpert. Er tritt das Erbe Peter Suhrkamps entschlossen an, ihm ist daran gelegen, den Ruf des 1950 gegründeten Verlags zu festigen und seinen Radius, den eigenen wie den des Hauses, zu erweitern. Wo immer er ist, lässt er sich von Literaturexperten berichten, wie es um die örtliche Belletristik steht. Er notiert sich Namen, die in seine Protokolle eingehen, immer wieder regt er an, bestimmte Texte zu prüfen, die ihm interessant klingen, und umgekehrt notiert er mit grimmiger Sachlichkeit, wenn ihm berichtet wird, dass Verlagsmitarbeiter nachlässig waren oder gar Schaden angerichtet haben. So hält er die Klagen von Autoren oder Vermittlern fest, die sich mit Anliegen an Suhrkamp-Bevollmächtigte gewandt und keine Antwort bekommen hatten. Und so wie er ständig auf der Suche nach neuen Autoren von überall her ist, so sucht er nach Menschen, die die Verlagsinteressen im Ausland vertreten können, wenn er selbst einmal nicht da ist. Überall kann er ja nicht sein.
Man wird ihn im Licht dieser Reiseberichte bisweilen visionär nennen - so verstanden, dass er von den Erfahrungen, die er im Ausland macht, sofort dasjenige erkennt und adaptiert, was dem Verlag hilft. Da ist vor allem die Notwendigkeit, mit Agenten zusammenzuarbeiten, und zwar mit den richtigen, wie Unseld als Ergebnis einer Amerika-Reise 1961 festhält, nachdem er knapp zwei Jahre lang den Verlag geführt hatte: "Ich musste in New York wirklich einsehen, dass wir ohne eine Agentur doch nicht weiterkommen und auch nicht recht ernst genommen werden. Immer wieder wurde ich gefragt, wer vertritt Ihre Rechte in New York?"
Eine Hymne auf Frau Ritzerfeld.
Zehn Jahre später beginnt, bei aller Sachlichkeit und Zweckmäßigkeit der Berichte, ein Ton Einzug zu halten, der persönlicher ist und mehr von den Begegnungen berichten möchte als das, was der eine oder andere gefordert hat und worauf man sich dann einigte. So wird ein Treffen mit Max Frisch in New York geschildert, das eigentlich die Feier von Frischs sechzigstem Geburtstag zum Zweck hatte, dann aber völlig aus dem Ruder läuft, weil Frisch sich vom Verleger - der ihm einen teuren Empfang ausrichten ließ - nicht recht gewürdigt fühlt. Ein Treffen mit Thomas Bernhard droht ebenfalls in eine Katastrophe zu münden, weil der Autor urplötzlich - so Unseld - die Partnerschaft aufkündigt, was dann vom Verleger mit viel Geld verhindert werden kann. Zugleich streut Unseld in seine Berichte immer wieder das Lob ein, das seine Gesprächspartner der Frankfurter Verlagsmitarbeiterin Helene Ritzerfeld zollen, die für Verträge zuständig ist: wie glatt alles mit ihr geht, wie einfach, wie professionell! Es sind schwer zu verkennende Hymnen des Verlegers auf eine Mitarbeiterin, die einfach ihre Arbeit erledigt.
Der Ton ändert sich auch hinsichtlich der Autoren und Bücher, die Unseld in der Ferne begegnen, von denen er hört, die ihm Enthusiasten, auf deren Urteil er etwas gibt, empfehlen. Die meisten Namen werden den heutigen Lesern der Berichte ganz fremd sein, durchgesetzt hat sich nur ein winziger Teil von ihnen, aber so, wie dann auch Unseld von ihnen schwärmt, ist man mehr als einmal versucht, den Namen nachzugehen, die manchmal dann tatsächlich im Suhrkamp- oder Insel-Programm erscheinen.
Auch Unselds wachsendes Bewusstsein für Literatur von Frauen wird man bemerken, er registriert das Macho-Verhalten eines japanischen Politikers und spart sich nun das frühere "Fräulein", wenn weiter von Helene Ritzerfeld die Rede ist.
Am schönsten, wohl auch für ihn selbst, ist der Ton, den er sich nun gestattet, wenn er unterwegs ist und einfach die Landschaft und die Kultur beschreibt. Im Japan-Reisebericht nimmt das den größten Raum ein. Was der Verlag davon hat? Schwer zu sagen. Aber für den Autor der Berichte ist damit eine neue, literarische Qualität erreicht. Und für den Leser allemal.
TILMAN SPRECKELSEN.
Siegfried Unseld: "Reiseberichte".
Hrsg. von Raimund Fellinger. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 378 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.