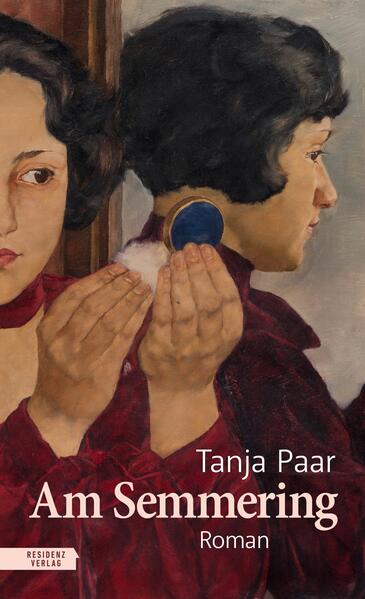Kommen Sie an den Semmering! Gönnen Sie sich im Sporthotel am Semmering eine luxuriöse Auszeit von der Hektik Wiens und tauchen Sie ein in die Freuden exquisiter Kulinarik, herrlicher Landschaft, Wellness und fantastischer Sportmöglichkeiten in einem der beliebtesten Luftkurorte Österreichs.
Bis heute ist der Semmering bei Wien ein Luftkurort für die Wohlhabenden. Tanja Paar aber nimmt uns mit in die Parallelwelt der einfachen Leute. Klara und Bertl leben nicht in der mondänen Welt der Luxushotels, auch wenn Klara immer mal wieder einen Blick in Richtung Bürgertum wirft. Sie leben in der Gartenwohnung des Bahnwärterhäuschens, denn Karl hat sich vom einfachen Bahnarbeiter zum Fahrdienstleiter hochgearbeitet.
Gemeinsam mit Klaras bester Freundin Rahel, einer jüdisch-orthodoxe Witwe mit drei Kindern, Fritz, einem Ex-Baron, der sich auf die Seite der Roten schlägt und Szabo, Lebemann, Pianist und Hotelverwalter bilden Klara und Bertl ein fünfblättriges Freundschaftskleeblatt, das das Beste aus dem Leben herausholt.
Der Semmering wirkt wie ein Kokon, in den erst nach und nach die Zeitgeschichte Einzug hält, die Tanja Paar gekonnt mit der Familiengeschichte verwebt.
Die Erzählung beginnt 1928 und reicht bis 1945. Die Bürgerkriegskämpfe 1934 sind Thema, die illegalen Nazis während der Ständediktatur, der Anschluss Österreichs ebenso wie die Kämpfe zwischen Wehrmacht und Roter Armee 1945. So entsteht ein multidimensionales Bild aus Familiengeschichte, Existenzsorgen und Historie Österreichs.
Wunderbar wird der Roman vom authentischen Klang der Sprache getragen, stilsicher nachempfunden und zum Leben erweckt. Die Sprachmelodie trägt wunderbar durch den Alltag, die kleinen Sorgen und die großen Umbrüche.
Tanja Paar zeichnet ein persönliches, wortgewandtes und eindringliches Portrait von Menschen, die keine Held*innen waren und dennoch unweigerlich politisiert wurden. Die Großeltern der Autorin lieferten mit ihrer eigenen Geschichte die Inspiration zu diesem außergewöhnlichen Erzählprojekt, denn der Großvater war Eisenbahner und lebte mit seiner Frau ebenfalls am Semmering. Wieder einmal zeigt sich anschaulich, wie die politische Geschichte ins Private eindringt. Ein absolut lesenswerter Roman, der mit leisen, humorvollen und klangvollen Tönen die Schrecken und Freuden der Zeit einfängt.