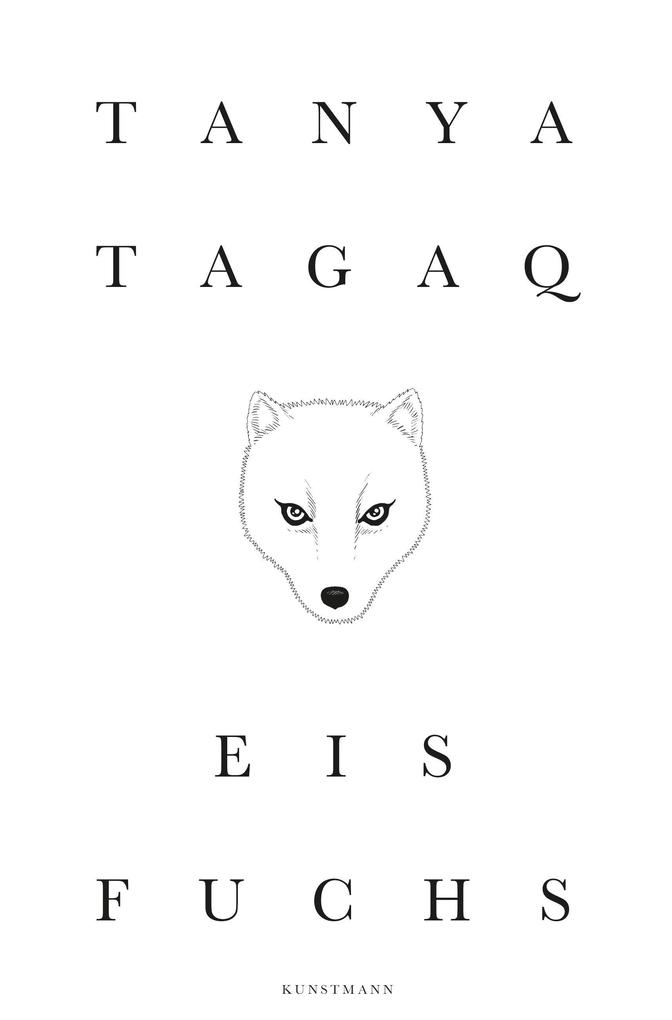
Zustellung: Di, 15.07. - Do, 17.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Der Winter ist vorbei und damit die Zeit, die die Kinder im Haus verbringen müssen, weil es draußen bitterkalt ist, hoch im Norden Kanadas, am Rande des Eismeers. Im Frühling haben die Kinder das Städtchen in der Hand, streunen auf der Suche nach Abenteuern durch die Straßen und durch die Tundra. Nach so wilden Abenteuern, dass sie dabei sogar das Leben riskieren. Die Erwachsenen sind mit eigenen Problemen beschäftigt und können keinen Halt bieten. Im Gegenteil. Tanya Tagaq erzählt in diesem atemberaubenden Debüt von der Kindheit und Jugend eines Mädchens in der Arktis: von einer übermächtigen Natur, von den allgegenwärtigen Füchsen, den majestätischen Polarbären und den Mythen der Inuit. Unter den furchterregenden und verzaubernden Polarlichtern verschwimmen für das Mädchen die Grenzen zwischen Mensch und Natur, Zeit und Raum, und sie begibt sich auf eine verstörend sinnliche Selbstsuche, um die Wunden zu heilen, an denen in einer sich auflösenden Gemeinschaft alle tragen.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
11. Februar 2020
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
200
Autor/Autorin
Tanya Tagaq
Übersetzung
Anke Caroline Burger
Illustrationen
Jaime Hernandez
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
374 g
Größe (L/B/H)
216/144/25 mm
ISBN
9783956143533
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 08.03.2020
Besprechung vom 08.03.2020
In den Weiten der Hocharktis
Magischer Realismus aus Kanada: Tanya Tagaqs "Eisfuchs"
Grün-leuchtende Polarlichter formen sich zu einem Lichtsplitter. Dieser trifft auf die zarte Kehle einer Siebzehnjährigen, zerstört sie jedoch nicht. Wer Tanya Tagaq bereits kennt, weiß um die Bedeutung dieses Bildes, denn die kanadische Gesangskünstlerin mit indigenen Wurzeln erlangte erste Berühmtheit durch ihre Darbietungen des traditionellen Kehlkopfgesangs der Inuit. So wie Tagaq musikalisch das Traditionelle mit Modernerem verbindet, stehen auch in ihrem Debütroman "Eisfuchs" Mythologie und Alltagserzählung, Poesie und Prosa, Traum und Realität so dicht beieinander, dass sie oft nur schwer zu unterscheiden sind.
"Eisfuchs" erzählt vom Aufwachsen in Nunavut, einer Region in der Hocharktis. Es ist die Geschichte einer "namelosen" Protagonistin, aus deren Sicht der Roman geschrieben ist, doch scheint sie mehr zu repräsentieren als nur sich selbst. Die Erzählerin gewährt Einblicke in ihr Leben, die vom Alltäglichen hin zum Mystischen reichen. Sie erzählt von Freunden, mit denen sie kleine, zuweilen lebensgefährliche Abenteuer erlebt; von einer Cousine, mit der sie Küken füttert. Sie erzählt von dem süßen Jungen, Bestboy, mit dem sie viel Zeit verbringt, und von seiner Großmutter Helen, der sie mehr zu vertrauen scheint als ihrer eigenen Familie. Stück für Stück wird die Erzählung mystischer. Trancezustände, Träume oder mythologische Legenden fließen fast unbemerkt in den Text ein, so dass man sich wundert, stockt, pausiert und noch einmal nachliest.
Andere Wirklichkeiten eröffnen sich, Gestaltenwandler treiben ihr Unwesen. Zumeist sind die Begegnungen mit dem "Übernatürlichen" erst unangenehm, dann irgendwie schön, besonders. Der Eisfuchs, dessen wahres Wesen höchstwahrscheinlich menschlicher Natur ist, verängstigt die Erzählerin. Die Rede ist von einem Fluch, der auf ihm lastet, den er auf das Mädchen übertragen könnte. Schafft sie es, das zu verhindern? Ein Eisfuchs begleitet sie auch später, greift niemals an, schaut bloß. Ob es derselbe Fuchs ist, bleibt fraglich, und "allesverändernd" ist ohnehin erst die Nacht mit den Polarlichtern.
"Die Natur kennt keine Gnade", sie ist bedrohlich, doch nicht so sehr wie das vom Menschen Erschaffene. Die Nachwirkungen des Kolonialismus werden an manchen Stellen so nüchtern thematisiert, dass es bedrückt: Alkoholismus und Gewalt. Alles nicht verwunderlich in einer Gesellschaft, die es jahrhundertelang mit allen Mitteln zu "zivilisieren" galt.
"Ich war siebzehn. Nach einem Selbstmordversuch von der Residential School geflogen." Und die Erzählerin ist nicht die einzige, die die Erlebnisse an der Residential School nur schwer erträgt. Sie berichtet von einem Lehrer, der sie anwidert, weitaus mehr, als sich einen Molch in den Mund zu legen oder lebendige Forellen zu schlucken. Seine krumme Haltung verrät ihn, er verharrt in seiner Opferrolle. Traumatische Erinnerungen an Gewalt und sexuellen Missbrauch übertragen sich auf künftige Generationen. Opfer werden zu Tätern.
Die christlich geleiteten Residential Schools hatten nicht nur viele Missbrauchsfälle zu beklagen, sondern auch den Verlust distinkter, indigener Kulturen, welche sich unter anderem durch eigene Sprachen und orale Literaturen auszeichneten. Die Protagonistin hasst den Innuinaktun-Unterricht, sie kommt sich in diesem Fach dumm vor, das Innukitut entgleitet ihr, denn selbst ihre Mutter spricht es mit ihr nicht mehr. Gesprochene, indigene Sprachen wie Innuktitut waren das Mittel der Überlieferung von Mythen, Sagen und Legenden, und die Protagonistin bedauert offen das ihr mit dem Verlust der Sprache verborgen bleibende Wissen der Vorfahren. Hierin liegt das besondere an "Eisfuchs" und dem künstlerischen Wirken Tagaqs: Sie fängt ein, was noch übrig ist, schreibt nieder, was in absolute Vergessenheit zu geraten droht. Eine der das Buch bebildernden Illustrationen ist ein Gedicht aus Symbolen, dessen Zeichen zwar vermutlich mit christlichen Missionaren erstellt wurde, aber dennoch ein stolzer Beweis und Verweis auf eine Sprache und eine Kultur ist, die einen postkolonialen Fortbestand verdient hat.
So wie Tagaq westliche, schriftliche literarische Traditionen mit indigenen, Oralen verbindet, wirkt ihr gesamter Roman durch Synthesen. Klang und Licht vereinen sich. Mensch, Tier und Natur, alles wird eins. Sonst klare Grenzen verschwimmen und erregen zuweilen Anstoß. Ebenso fasziniert die Tundra, die "unendlichen" baumlosen Weiten der Arktis. Man spürt förmlich den eiskalten Wind auf der eigenen Haut, wird dann aber wieder in einen Schulalltag zurückgeworfen, in dem Ausgrenzung, sexueller Missbrauch und das Schnüffeln von Benzin und Butan zur Normalität gehören.
Die Erzählung, deren Figuren fast alle unbestimmt, ja fast gesichtslose Gestalten sind und keine Namen tragen, regt dazu an, sich intensiver mit der Geschichte indigener Völker, indigener Frauen in Kanada zu befassen. Denn das Buch schrieb Tagaq "Für die verschwundenen und ermordeten indigenen Frauen und Mädchen Kanadas und für die Überlebenden der Residential Schools".
Tanya Tagaqs Sprache ist sehr direkt. Man merkt dem Roman an, dass er gegen christliche Schamgrenzen, den Zölibat und Prüderie ankämpft. So wie Tagaqs Kehlkopfgesang gerne als "ungewohnt" und "eigenwillig" beschrieben wird, wird es vermutlich auch mit ihrem Debütroman sein, und man wird sich die Frage stellen müssen, wieso man das Werk "gewöhnungsbedürftig" findet und ob die eigenen Grenzen dessen, was "normal" und "gewohnt" ist, nicht zu eng gefasst sind.
ZOË WYDRA.
Tanya Tagaq: "Eisfuchs". Roman. Aus dem Englischen von Anke Burger, Kunstmann Verlag, 200 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 31.01.2023
Ich konnte absolut nichts mit dem Buch anfangen.
Ich konnte absolut nichts mit dem Buch anfangen. Es ist völlig wirr geschrieben. Es wechseln sich Gedichte aus völlig wild zusammengewürfelten Worten, mit völlig abstrusen Erinnerungen an die Kindheit ab. Spätestens als die Protagonistin von den Polarlichtern geschwängert wird, habe ich nur noch quer gelesen bis zum Ende. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wie das Buch in ein Regal gekommen ist und wüsste nicht, wem ich es weiterempfehlen könnte. Das Schönste ist noch das Cover.
LovelyBooks-Bewertung am 26.05.2022
Verarbeitung traumatischer Kindheit und des Verlustes des Inuit-Lebensgefühls nahe der Natur durch allegorische Sprache und Lieder.









