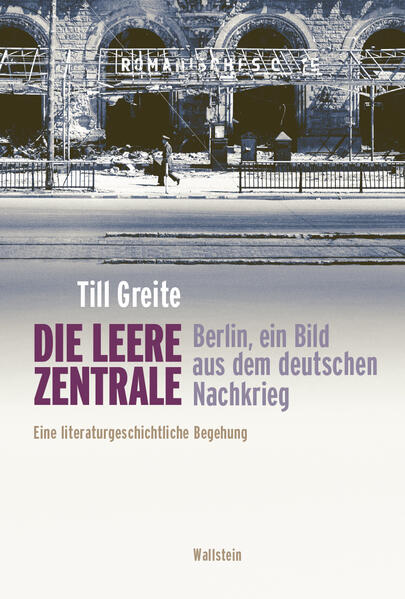
Zustellung: Sa, 19.07. - Di, 22.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Ein vergessenes Stück Literaturgeschichte der Stadt BerlinUnter der Leitmetaphorik der leeren Zentrale wird erstmals nicht nur das Ruinenfeld des Nachkriegsberlin mittels eines stadtarchäologischen Zugangs erschlossen, sondern ein literaturgeschichtliches Terrain aus dem Schutt der Überlieferung geholt, das sich sukzessive als Denkfeld sui generis erschließt. Durch dieses Feld zieht sich ein epochaler Riss, der auf neuen Deutungswegen durchwandert wird, um, - u. a. anhand von Archivbeständen - übersehene wirkungsgeschichtliche Linien für ein anderes Verständnis der deutschen Nachkriegsliteratur zugewinnen. Im Zeichen der Neuorientierung wird Berlin als inoffizieller locus communis gedeutet, der von West und Ost - wie vom Exil - als Suchpunkt für persönliche wie geschichtliche Erfahrungen angesteuert wurde. Der Ort brachte so unterschiedliche Schriftsteller:innen wie Wolfgang Koeppen, Günther Anders, Marie Luise Kaschnitz oder Peter Huchel ins Zwiegespräch. Zur Ausgrabung dieses Berliner Mosaiks aus poetischen Bruchstücken bedient sich die Arbeit eines eigenen hermeneutisch-phänomenologischen Verfahrens, das aus der Kraft des Unbegrifflichen, der Unhintergehbarkeit der Bilder und Erfahrungen jener Nachkriegsflaneure, ihre Befunde zieht.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
27. November 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
622
Autor/Autorin
Till Greite
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
31 Abb.
Gewicht
1110 g
Größe (L/B/H)
235/167/48 mm
ISBN
9783835356221
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»eine fulminante Studie zum literarischen Berlin unmittelbar nach dem Krieg«
(Nicole Henneberg, FAZ, 11. 01. 2025)
»faszinierende( ) Rekonstruktion des literarischen Nachkriegs-Berlin«
(Erhard Schütz, Die Welt, 17. 02. 2025)
»eine brillante Leistung, die auch sprachlich nicht hinter der seiner Gewährsleute zurücksteht. «
(Erhard Schütz, Literarische Welt, 02. 03. 2025)
»Greite s `inspection on foot as reflected in the German `Begehung in his title allows him to map a new cultural itinerary through Berlin (. . .). «
(Roberto Interdonato, Oxford German Studies, Vol. 54, Issue 2, 2025)
(Nicole Henneberg, FAZ, 11. 01. 2025)
»faszinierende( ) Rekonstruktion des literarischen Nachkriegs-Berlin«
(Erhard Schütz, Die Welt, 17. 02. 2025)
»eine brillante Leistung, die auch sprachlich nicht hinter der seiner Gewährsleute zurücksteht. «
(Erhard Schütz, Literarische Welt, 02. 03. 2025)
»Greite s `inspection on foot as reflected in the German `Begehung in his title allows him to map a new cultural itinerary through Berlin (. . .). «
(Roberto Interdonato, Oxford German Studies, Vol. 54, Issue 2, 2025)
 Besprechung vom 11.01.2025
Besprechung vom 11.01.2025
Orpheus im Schattenland
"Die leere Zentrale" von Till Greite ist eine fulminante Studie zum literarischen Berlin unmittelbar nach dem Krieg
Es fehle Deutschland das geistige Zentrum Berlin, darum bleibe seine Literatur reines "Provinzgebrodle", verkündete Gottfried Benn nach dem Krieg. "Doppelleben" nannte er später seine Autobiographie - ein vielsagender Titel. Denn am ideologischen Getöse des Berliner Frühlings 1933 hatte er sich öffentlich berauscht, später kehrte bei ihm eine gewisse Ernüchterung ein. Öffentlich losgesagt aber hatte er sich von seiner frühen Begeisterung nie.
Der Literaturwissenschaftler Till Greite beginnt seine profunde Studie mit einer Gegenüberstellung von Oskar Loerke, dem Dichter und Lektor des S. Fischer Verlages, und Gottfried Benn. Loerke verzweifelte am ideologischen Missbrauch der Sprache und sehnte sich nach frei denkenden und schreibenden "Katakombenbrüdern", die sich erst lange nach seinem Tod finden sollten - und dann jenseits der Berliner Mauer: Johannes Bobrowski, dem es gelungen war, am Rande von Ost-Berlin ein kleines Literaturrefugium zu gründen, berief sich in seinen Briefen ausdrücklich auf Loerke.
Solche Zusammenhänge poetologisch und hermeneutisch offenzulegen, ist das große Verdienst von Greites kluger Studie "Die leere Zentrale. Berlin, ein Bild aus dem deutschen Nachkrieg". Sie bringt traumatisierte Autoren wie Günther Anders, Wolfgang Koeppen und Witold Gombrowicz miteinander ins Gespräch. Als Besucher aus dem Exil wandern sie durch die Ruinen einer Stadt, die wie keine andere die Brüche des zwanzigsten Jahrhunderts abbildet.
Greite folgt seinen Autoren durch das völlig zerstörte Zentrum, über den Potsdamer Platz bis zum Anhalter Bahnhof, jetzt eine Wüste, ein Niemandsland, das Michael Hamburger, auch er ein Rückkehrer auf Zeit, ein "drittes Land" nennt - ihn bedrängt der überall spürbare Geruch der Leichen und des Krieges. In der Wilhelmstraße, dem einstigen NS-Machtzentrum, ist noch der Garten der Reichskanzlei zu erkennen, in dem Hitlers Leiche verbrannt wurde - Koeppen nennt es das "Pharaonengrab des Dritten Reiches". Es war ein gewalttätiges Gelände, das sich den verstörten Rückkehrern bot, und man brauchte schon viel schwarzen Humor, um wie Gabriele Tergit 1948 zu schreiben, sie hätte ihre "Verdächte wegen Pompeji, die Ruinen des Tiergartenviertels" sähen genauso aus.
Wolfgang Koeppen hatte miterlebt, wie das Romanische Café, sein Zentrum des freien Gesprächs, von einem Bombentreffer zerstört wurde. Hier hatte er seinen Verleger Bruno Cassirer kennengelernt, der überzeugt war, ohne solch ein Labor des freien Geistes könne gar keine Literatur entstehen. Jetzt, angesichts der Ruine, fühlt Koeppen sich verpflichtet, über das alles zu schreiben, doch er kämpft mit der Sprache, und alle Formen zerbröseln ihm unter den Händen. In seiner Literatur hört man sein Stammeln, wie auch das Schweigen - beides war Ausdruck seiner Scham, weil er sich in der NS-Zeit versteckt und kleingemacht hatte.
Koeppen ist einer der gewichtigsten Zeugen dieser Studie. Seine Gedankensplitter, von Greite psychologisch klug montiert, erklären nicht nur die eigenen Schreibblockaden, sondern beleuchten auch die Traumata der Emigranten. Greites zentrale, sorgsam ausgefaltete These: Das leere Zentrum funktioniert in den Augen der Nachkriegsflaneure wie eine Krypta, eine tatsächliche oder eine im psychoanalytischen Sinne. Schmerzhafte Erinnerungen und enttäuschte Hoffnungen werden zu Zeitkapseln, die sich unwillkürlich öffnen, auch vergessene Sprachklänge finden sich dort. Und neben dem Grausigen lagert noch bisher "Unabgegoltenes", vorsprachliche Schrecken, aus denen sich, so die Hoffnung der Dichter, sprachlich fassbare Bilder erheben können, die aus dem Unbewussten schöpfen.
Mit Johannes Bobrowski, dem "eingemauerten Orpheus", schließt sich der eindrucksvolle Kreis. Sein "Schattenland", wie er es nennt, ist durch viele unterirdische "Grabkammern" mit dem Westen verklammert und traumatisiert ihn, der an der Ostfront gekämpft hatte, immer wieder neu: Direkt unter dem Fenster seines Arbeitszimmers sterben die Mauerflüchtlinge. Die neue Diktatur knüpft nahtlos an die alte an.
Es gibt keine Stunde null, im Gegenteil, die Epochen sind eng verflochten, wie Greite zeigt. Und durch die wirkungsgeschichtlichen Linien, die er in den Tagebüchern und Briefen jener Generation aufspürt, erklären sich auch viele Besonderheiten der Nachkriegsliteratur - bis hin zu den Grabenkämpfen rings um die Gruppe 47. NICOLE HENNEBERG
Till Greite: "Die leere Zentrale". Berlin, ein Bild aus dem deutschen Nachkrieg.
Wallstein Verlag, Göttingen 2024. 622 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die leere Zentrale. Berlin, ein Bild aus dem deutschen Nachkrieg" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









