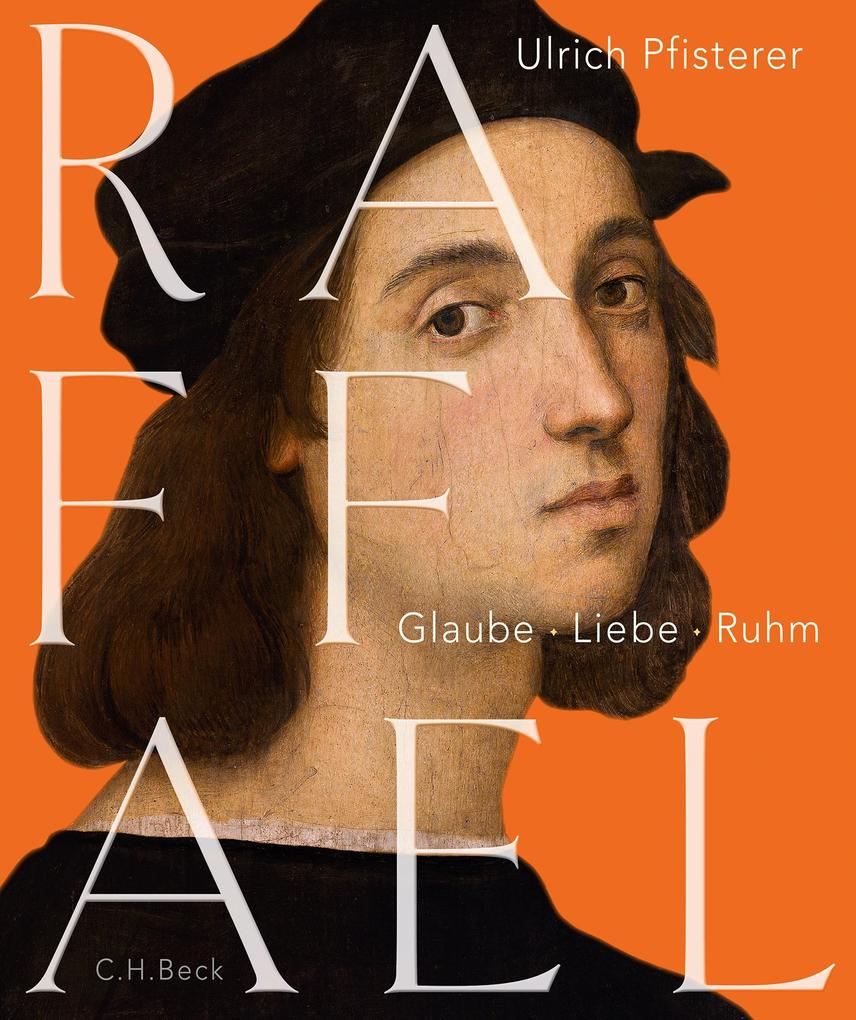Besprechung vom 20.12.2019
Besprechung vom 20.12.2019
Erotische Spiele eines Madonnenmalers
Ein vergötterter Künstler wird geerdet: Ulrich Pfisterer sondiert auf bündige Weise Leben und Werk Raffaels.
Nur als Gedankenexperiment: Wäre anstatt der drei Dresdner Diamantgarnituren die "Sixtinische Madonna" Raffaels aus der dortigen Galerie der Alten Meister entwendet worden, würde zwar gewiss auch von einem unersetzlichen Schaden die Rede sein; viele Menschen allerdings wären wohl überrascht, dass die beiden Engel, denen sie auf Kalendern und Postkarten begegnen, in Dresden hängen. Und noch mehr Menschen würden sie wohl gar nicht mit dem Namen Raffael verbinden.
Der italienische Künstler ist, internationalisiert wie sonst kaum jemand, in jedem großen Museum der Welt zu finden und damit ortlos. Seine Bilder sind so selbstverständlich in das kollektive Bildgedächtnis eingegangen, dass er eher für eine allgemeine, formschöne Renaissancemalerei ohne Kanten denn für eine bestimmte Handschrift oder gar einen klaren Stil steht. Auch nach dem Buch von Ulrich Pfisterer bleibt die Persona Raffaels ein Rätsel. Was kein Verschulden des Buches ist, im Gegenteil.
Sind doch über kaum einen Künstler seines Ranges derart wenig belastbare Fakten bekannt, obwohl er "erst" vor fünf Jahrhunderten, am 6. April 1520, verstorben ist, weshalb 2020 auch zum Raffael-Jahr erklärt ist. Raffael entzieht sich, und das, obwohl sich wohl kein Kunstmuseum aus dem neunzehnten Jahrhundert findet, in dem nicht das Konterfei des "Göttlichen" dem Besucher an der Fassade entgegenprangt. Neben dem Monumentalfresko der "Schule von Athen" im Vatikan ist Raffael vor allem für seine engelsgleichen Madonnenbilder bekannt, für deren knappe zwei Dutzend - je nach Großzügigkeit der Zuschreibung sind es auch nur zwanzig - er vorrangig gerühmt wird. Keine dieser Madonnen gleicht der anderen, denn während Botticelli und Leonardo als seine Vorbilder einem einmal gefundenen Erfolgsmodell mehr oder weniger treu blieben, hing Raffael offenbar dem römischen Motto Variatio delectat, dem stets wieder erfreuenden Neuarrangement, an. Ulrich Pfisterer würdigt und beschreibt das ausführlich.
Blasphemische oder von Phantasie überschießende Stimmen wie etwa in Achim von Arnims 1824 entstandener Erzählung "Raphael und seine Nachbarinnen" hingegen behaupteten, der frühe Tod des gefeierten Madonnenmalers mit gerade einmal siebenunddreißig Jahren hänge mit seiner erotischen Verausgabung, gar mit einer Syphiliserkrankung des "Vielgeliebten" zusammen. Was aber stimmt?
Eine der ersten wichtigen Aufräumarbeiten, die Pfisterer, Lehrstuhlinhaber für Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München leistet, ist daher die Frage nach dem Aufstieg zum vergötterten Künstler. Die drei Hauptabschnitte des Buchs erkunden, wie Raffaels Karriere "begann", er "aufstieg" und sich den Künstlerruhm "sicherte". In allen drei Teilen äußert sich wiederholt und wohltuend ein Weiterentwickeln der kunstsoziologischen Methode des englischen Kunsthistorikers Michael Baxandall, der die Renaissanceforschung seit den Siebzigern mit peniblen Untersuchungen zu Maltechnik, Kosten und Verwendung der Bilder auf eine neue Basis stellte. Ein Beispiel: In Raffaels Ära waren rund fünfundachtzig Prozent aller Aufträge in Italien Marienbilder. Während aber etwa Perugino seine wenigen Erfolgsmodell-Madonnen ständig reproduziert, liefert Raffael Unikate, indem er zwar den Grundtypus über drei bis vier Madonnenbilder beibehält, signifikante Details, wie etwa das Halten eines Buches, aber variiert. Zu beiden Geschäftsmodellen zitiert der Autor zeitgenössische Quellen und gibt damit Einblick in die Hochrenaissance-Kunstindustrie.
Der Schilderung des schmalen OEuvres und kurzen Lebens schließt sich das Kapitel "La grande Bellezza - Raffaels Kult" insbesondere bei den Nazarenern an. Dass diese lange Tradition der Raffaelvergötzung von den Nationalsozialisten im Begriff der "Gottbegnadeten"-Künstler pervertiert wurde, findet in dem Buch keine kritische Erwähnung. Dafür aber wird mit Sir Joshua Reynolds "Parodie auf die Schule von Athen" von 1751 die durchaus auch vorhandene Opposition zu diesem Vergötterten immerhin erwähnt.
Massiv dagegen fließt ein, was Pfisterer seit Jahren intensiv erforscht: wie Vorstellungen eines "Eros der Inspiration" virulent werden, wie also Metaphern einer "Bemusung" des Künstlers als weibliche und vitalistische Topoi einer männlichen "zeugenden Schöpfung" von Bildern die Rezeption des überwiegend als religiöser Maler angesehenen Raffael bestimmen. Wenig verwunderlich, dass im letzten raffaelzeitlichen Kapitel vor dem Nachleben dann der Tod - als Thanatos der alte Gegenspieler des Eros - die tragende Rolle einer "letzten Konkurrenz" übernimmt.
Davor aber wird das vermutlich bekannteste Bild des Malers, die sogenannte "Fornarina" detailliert besprochen. Als gewagte Mischung aus Muttergottes und Geliebter trägt sie am Oberarm ein Geschmeide, auf dessen lapislazuliblauem Grund "Raphael Urbinas" wie eine Besitzanzeige zu lesen steht. Könnte ihr Griff zur entblößten Brust noch als Schwundstufe einer Madonna lactans durchgehen, ist der fordernd kecke Blick zum Porträtisten, der im selben Moment jedem Betrachter gilt, ein unverhohlener Aufruf zum Voyeurismus auf die Geliebte des Malers. Wiederum setzt Pfisterer damit Raffael geschickt zwischen Leonardo mit seiner "Monna Vanna", die eine der Hauptanregungen für die "Fornarina" abgab, und Botticelli, der gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts eine antike Muse Milch aus der spitzen Brust spenden ließ.
Trotz der vielen schon erschienenen Bücher über Raffael ist Pfisterer hier eine so originelle wie kurzweilige Sondierung des frühverstorbenen frühvollendeten Hochbegabten gelungen.
STEFAN TRINKS
Ulrich Pfisterer: "Raffael". Glaube - Liebe - Ruhm.
Verlag C. H. Beck, München 2019. 384 S., Abb., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.