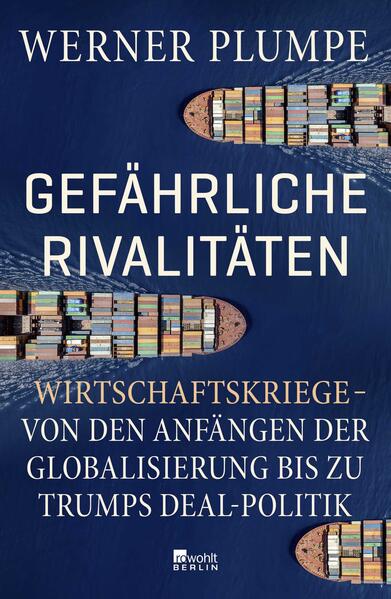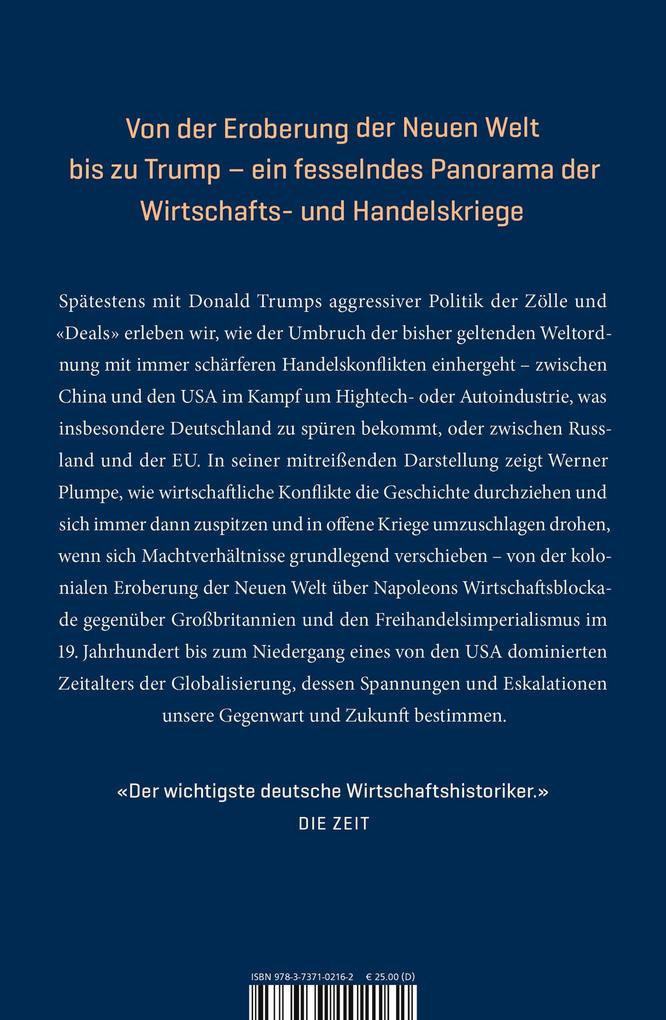Besprechung vom 24.05.2025
Besprechung vom 24.05.2025
Hat Trump am Ende recht?
Zukunft im Fließgleichgewicht: Werner Plumpe zieht Folgerungen aus der Geschichte von Handelskriegen
Ein Buch über die Geschichte der Wirtschaftskriege wie dieses von Werner Plumpe kann auf größtes Interesse rechnen. Deutschland befindet sich in einem oder vor gleich zwei solchen Wirtschaftskriegen: Die USA drohen mit hohen Einfuhrzöllen, und der Boykott russischer Energie hat zu Energiepreisen geführt, die sich zu einem offenbar erfolgreichen Thema der AfD entwickelt haben. Da möchte man sich gerne erklären lassen, was die Geschichte über Handelskonflikte weiß und was dieses Wissen für die Betrachtung der Gegenwart abwirft. Und Werner Plumpe, emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Frankfurter Universität, der ein lesenswertes Buch über die Geschichte des Kapitalismus ("Das kalte Herz", 2019) geschrieben hat, ist ein Forscher, der zur Auskunft befähigt ist.
Sein Buch will nicht ein Handbuch zur Sache sein, es behandelt prominente Beispielsfälle und erkennt darin gewisse Muster. Man könne die kommenden Konflikte zwar nicht vorhersagen, sie aber besser verstehen. Das wichtigste Muster: Wirtschafts- oder Handelskriege (der Handelskrieg ist ein Spezialfall des Wirtschaftskriegs, aber ein besonders wichtiger) schaden fast immer beiden Seiten. Die Vorstellung, es sei anders, kam im Merkantilismus auf: Was die eine Seite gewinne, müsse die andere verlieren. Wenn der Sinn des Außenhandels darin bestand, die Machtstellung eines Landes zu stärken durch Edelmetallbestände, war das nicht unplausibel. Importe bedeuteten Abfluss von Gold und Silber, Exporte Zustrom. Angestrebt wurde eine aktive Handelsbilanz und damit eine Bereicherung des Staatsschatzes.
Es gab Länder, die mit merkantilistischer Politik keine schlechten Erfahrungen machten, so England, das im siebzehnten Jahrhundert die rivalisierenden Niederlande auch mit Einfuhrsteuern aus dem Geschäft drängte. Doch weniger die handelspolitischen Maßnahmen, die Behinderung des Konkurrenten, gaben den Ausschlag, als die "Modernisierung und Vergrößerung eigener Produktionsfaktoren". Die Gefahr der Schutzzollpolitik, durch die Ausschaltung der Konkurrenz die Entwicklung der eigenen Industrie zu lähmen, hatten die Briten umgangen.
Der vielleicht bekannteste Fall eines Wirtschaftskrieges, die Napoleonische Kontinentalsperre, erwies sich als vollkommener Fehlschlag, was nicht mehr überraschte. Im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts erkannten die Theoretiker der Volkswirtschaft, was der Kaufmannschaft längst klar war: Außenhandel nutzt allen Beteiligten und ist eben nicht, was man später ein Nullsummenspiel nannte.
Das neunzehnte Jahrhundert wurde die große Zeit des Freihandels unter Führung Großbritanniens, das mit seiner gewaltigen industriellen Überlegenheit nicht nur keinen Konkurrenten zu fürchten hatte, sondern auf offene Märkte angewiesen war, um die eigenen Kapazitäten auslasten zu können. Der Freihandel ermöglichte nicht nur Großbritanniens Prosperität, sondern auch den wirtschaftlichen Aufstieg der Nachbarn, insbesondere Deutschlands. Unbefleckt war er nicht. Es gehörte auch der Freihandelsimperialismus dazu, die Opiumkriege und überhaupt die militärische Erzwingung offener Märkte in Ostasien mithilfe der "ungleichen Verträge" - für die betroffenen Länder eine tiefe Demütigung.
Die große Ausnahme in dieser Phase freien Handelsverkehrs waren Ende des neunzehnten Jahrhunderts die USA unter dem Präsidenten William McKinley. Die Einfuhrzölle für gewerbliche Güter waren hoch, aber Plumpe zufolge für die USA nicht von Schaden. Die Forschung sei sich ziemlich einig, dass für die junge Industrie die Zollschutzmauern "zweifellos nützlich" gewesen seien. Der amerikanische Wirtschaftsraum war für Europa zu attraktiv, als dass man dort zu Vergeltungsmaßnahmen hätten greifen wollen, zumal die amerikanische Industrie zu wenig exportierte, um angreifbar zu sein.
Hat Donald Trump, der McKinley ja sehr schätzt, vielleicht doch recht mit seiner Begeisterung für Zölle? Plumpe gibt ihm einigen Kredit. Amerika sei der Garant einer Ordnung, von der andere Länder wie China profitieren, ohne selbst etwas für die Bewahrung der Ordnung zu leisten. Kürzlich allerdings hat der in Harvard lehrende Ökonom Kenneth Rogoff in einem Gespräch mit dieser Zeitung (FAS vom 27. April) darauf hingewiesen, dass die amerikanischen Aufwendungen sehr wohl mit handfesten Vorteilen zusammengehen. Das Gefühl, betrogen zu werden, ein starker Treiber der trumpschen Politik und Rhetorik, wäre danach nicht ganz richtig. Interessant ist aber die Spekulation, Trump wisse sehr wohl, dass das amerikanische Außenhandelsdefizit auf mangelnder Konkurrenzfähigkeit vieler Branchen beruhe, und er dränge ausländische Unternehmen zu Investitionen in den USA, um den Wirtschaftsstandort durch die Ansiedlung neuer Konkurrenz aufzuwerten. In einer Welt, die sich nicht mehr durch eine einzelne Vormacht ordnen lasse, müsse man in "permanenten Neuaushandlungen" zeitweilige Stabilitäten herstellen. Womöglich werde Trumps Politik der Deals (was ja immer heißt, Kompromisse zu schließen) "eine Art Fließgleichgewicht konkurrierender Interessen" erreichen, das könnte die "Zukunft der Weltwirtschaft nach dem Ende der Pax Americana kennzeichnen".
Doch ob das mit Donald Trump gelingt? Alles läuft für Plumpe auf die Erfahrung hinaus: Je größer die Integration eines Landes in die Weltwirtschaft und damit der wirtschaftliche Erfolg, desto geringer dessen Handlungsfähigkeit. Für ein traditionell exportorientiertes Land wie Deutschland war das rasch klar, mittlerweile gilt es, anders als zu Zeiten McKinleys, auch für die USA. Wenn Trump aber zu Recht von Plumpe als "erratisch, sprunghaft, launisch" bezeichnet wird, sind die Hoffnungen nicht groß, dass er sich in die Erkenntnis reduzierter Handlungsfähigkeit fügt. STEPHAN SPEICHER
Werner Plumpe: "Gefährliche Rivalitäten". Wirtschaftskriege - von den Anfängen der Globalisierung bis zu Trumps Deal-Politik.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2025.
320 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.