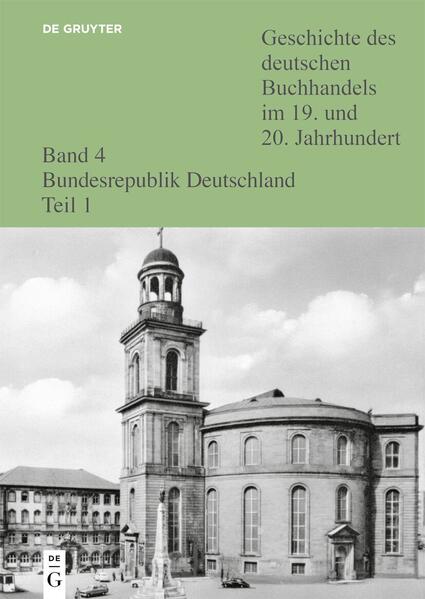
Zustellung: Do, 21.08. - Sa, 23.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 - und den vorhergehenden Beschlüssen der Konferenz von Jalta - setzte unmittelbar die Zweiteilung des Landes in die SBZ und die drei Westzonen ein. Über 200 Jahre Buchgeschichte mit dem 1825 in Leipzig gegründeten Börsenverein des Deutschen Buchhandels wurden innerhalb von Monaten verändert, Verleger aus Leipzig gezielt aufgefordert, in die Westzonen, zunächst nach Wiesbaden, umzuziehen und dort strategisch neue Buchhandelsstrukturen aufzubauen. In Frankfurt am Main wurde eine Buchhändlervereinigung, ein Börsenverein, eine Buchmesse und eine Archiv-Bibliothek (Deutsche Bibliothek) neu gegründet, parallel zu den Leipziger Institutionen. Der Band 4/1 der Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert untersucht zum ersten Mal historisch fundiert aus den Archiven in Washington, London und Paris die (unterschiedlichen) Strategien der drei Westmächte und schildert den Neuanfang in Frankfurt am Main bis zur Gründung der BRD.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
06. Mai 2025
Sprache
deutsch
Untertitel
44 b/w illustrations, 2 b/w tbl.
Seitenanzahl
ix
Reihe
Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert
Herausgegeben von
Stephan Füssel
Illustrationen
44 b/w illustrations, 2 b/w tbl.
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
44 b/w illustrations, 2 b/w tbl.
Gewicht
1004 g
Größe (L/B/H)
244/175/33 mm
ISBN
9783110350760
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 25.07.2025
Besprechung vom 25.07.2025
Nach Westen ging der Weg
Bücher braucht die Umerziehung: Die große Darstellung der Geschichte des deutschen Buchhandels erreicht die Jahre 1945 bis 1949 in den Westzonen.
Die Geschichte des Buchhandels der (alten) Bundesrepublik beginnt in Leipzig. Mitte April 1945 von den Amerikanern befreit, wussten nur die höchsten Stellen, dass die Stadt wenige Wochen später zur Sowjetischen Besatzungszone kommen würde. Zu den Eingeweihten gehörte Major Douglas Waples, der drei Tage nach Kriegsende in Leipzig erschien, um bedeutende, aber unbelastete Verleger und Großbuchhändler zur Übersiedlung in den Westen, nach Wiesbaden, zu bewegen; auch der Branchenverband, der Börsenverein der Deutschen Buchhändler, sollte mitsamt dem "Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel" verlagert werden - streng geheim natürlich und alles unter der Maßgabe, lediglich Filialen zu errichten. Der Transport, der 35 Personen, wichtige Firmenunterlagen sowie zweieinhalb Tonnen kostbaren Papiers umfasste, fand am 12. Juni 1945 statt. Zwei Wochen später erfolgte die Übergabe Leipzigs an die Rote Armee.
Für die weitere Entwicklung war der Leipziger Aderlass von erheblicher Bedeutung. Wie kein anderer Wirtschaftszweig war der deutsche Buchhandel seit dem achtzehnten Jahrhundert an einem einzigen Ort konzentriert gewesen. Die "Buchstadt" Leipzig war ein buchstäblich in der ganzen Welt berühmtes und bewundertes Zentrum des Buchgewerbes. Im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört, bedeutete der amerikanische Braindrain eine weitere Schwächung des traditionsreichen Zentrums, war aber zugleich eine wichtige, wenn nicht sogar die entscheidende Voraussetzung für den Wiederaufbau des Buch- und Verlagswesens in den Westzonen, das nun - nach einem kurzen Zwischenspiel in Wiesbaden - in Frankfurt am Main ein neues Zentrum erhielt.
Herausgegeben von Stephan Füssel, dem langjährigen Inhaber des Gutenberg-Lehrstuhls der Universität Mainz, schließt der erste Band der Geschichte des Buchhandels in der Bundesrepublik nahtlos an die Bände zur Geschichte des deutschen Buchhandels seit der Reichsgründung 1871 an (F.A.Z. vom 5. März 2021 zum Exilbuchhandel und vom 21. Juni 2024 zur NS-Zeit). Drei Autorinnen sowie Füssel selbst rekonstruieren in diesem Eröffnungsband zunächst die politischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen in den vier Jahren der Besatzungszeit. Michele Troy, den Lesern durch ihre fulminante Geschichte des Albatross-Verlags bekannt (F.A.Z. vom 11. März 2022), widmet sich der amerikanischen Zone, Judith Joos behandelt die Entwicklungen in der britischen Zone, und Vera Dumont und Judith Joos untersuchen die Verhältnisse in der französischen Zone, während der einführende Beitrag von Stephan Füssel den Börsenverein, das "Börsenblatt", das Entstehen der Frankfurter Buchmesse (in der 1948 wieder aufgebauten Paulskirche) und die Gründung der Deutschen Bibliothek (als Pendant zur Deutschen Bücherei in Leipzig) ins Auge fasst. Die Texte sind durchgängig aus den Akten gearbeitet, leisten also im Wortsinne Grundlagenarbeit.
Alle Besatzungsoffiziere der drei Zonen teilten die feste Überzeugung, dass das deutsche Volk umerzogen werden müsse und dass in Deutschland das ideale Mittel dafür das gedruckte Buch sei. Diese Hochschätzung des Buches erstaunt angesichts der Tatsache, dass Massenmedien wie Zeitungen, Kino und Rundfunk längst voll entwickelt waren. Zur Erklärung weist Judith Joos darauf hin, dass die mit der Konzeption und Umsetzung der "Buchpolitik" der Besatzungsmächte beauftragten Militärs und Beamten selbst "Männer des Buches" waren, entweder Akademiker wie Major Waples, der in Chicago Leserforschung betrieben hatte, oder Vertreter des Buchgewerbes wie Felix Reichmann, ein aus Wien emigrierter Antiquar. Mit dem Schriftsteller Alfred Döblin verfügten die Franzosen sogar über den berühmtesten Zensor der gesamten deutschen Buchgeschichte, aus dessen knapp 1600 leider immer noch weitgehend unerschlossenen Zensurgutachten Vera Dumont einige höchst aufschlussreiche Zitate anführt.
Ungeachtet vieler Unterschiede im Detail verfolgten die westlichen Besatzungsmächte denselben Ansatz, dass der ersten Phase einer vollständigen Übernahme und Kontrolle des Buchhandels und der zweiten Phase eines von den Alliierten gesteuerten Wiederaufbaus möglichst bald in einer dritten Phase die Übergabe der Verantwortung an deutsche Verleger und Buchhändler folgen sollte. Der Umschlagpunkt war schneller erreicht, als man ursprünglich vorhersehen konnte, denn mit der Währungsreform in den drei Westzonen vom 20. Juni 1948 endete das System der wirtschaftlichen Steuerung (insbesondere der Papierzuteilung, die wie eine Form indirekter Zensur gewirkt hatte), wenig später folgte auch die Aufhebung der Zensur.
Für die westlichen Alliierten endete damit ein höchst problematischer Zustand, denn es widerstrebte ihnen, ein diktatorisches System (oder dessen Hinterlassenschaften) mit diktatorischen Mitteln zu bekämpfen. Man wollte ausdrücklich keine "Arisierung unter umgekehrten Vorzeichen". Auswahl geeigneter Personen und Berufsverbote für andere, Vor- und Nachzensur von Manuskripten und gedruckten Büchern, Rationierung von Papier-, Druck- und Bindekapazitäten - das alles war für sie nur als Übergangslösung akzeptabel. Das daraus immer wieder entstehende Missbehagen führte mehr als einmal dazu, dass Besatzungsoffiziere großzügiger entschieden, als es nach dem Buchstaben der Gesetze und Verordnungen geboten gewesen wäre.
Allerdings stellten die Verantwortlichen ohnehin schnell fest, dass es nur in wenigen Ausnahmefällen möglich war, Schwarz und Weiß klar zu trennen. Wer die zum Betrieb eines Unternehmens der Buchbranche erforderlichen Kenntnisse und Ressourcen besaß, konnte die NS-Zeit kaum im Widerstand verbracht haben. Wer aber wie Bertelsmann oder Burda über intakte Druckereien oder wie Desch über geheime Papiervorräte oder wie Rowohlt über brillante Verbindungen verfügte, war schnell unentbehrlich, egal wie viele Flecken seine Weste aufwies. Und wer eine Buchhandlung betrieb, brauchte Bücher zum Verkaufen, Bücher, die die Verlage bis zur Währungsreform nicht oder nur eingeschränkt liefern konnten, sodass man dem Publikum anbot, was irgendwie verfügbar und nicht hochgradig verboten war - mit Schere, Kleister und weißer oder schwarzer Farbe wurden Bücher der NS-Zeit notdürftig verkaufsfähig gemacht.
Zu den Erkenntnissen, zu denen die alliierten Buchpolitiker notgedrungen kamen, gehörte es auch, dass der Markt sich nicht steuern ließ. Da besonders katholische Verleger dem NS-Regime ferngestanden hatten, erhielten viele von ihnen eine Lizenz zur Fortführung ihrer Verlage. Dies führte dazu, dass in allen drei Besatzungszonen theologische Bücher mit großem Abstand an der Spitze der Buchproduktion standen. Was aber die Leser tatsächlich wollten, nämlich Unterhaltungsliteratur, die der Flucht aus dem bedrückenden Alltag diente (wie schon in der NS-Zeit), wurde spätestens am Tag nach der Währungsreform deutlich - sofern das Publikum nicht ohnehin erst einmal die Fleischer- und Bäckerläden stürmte: "Es ist, als ob ein ausgehungertes Volk einen Freßkomplex bekommen hätte. Geist steht ganz tief im Kurs", schrieb Erich Kästners einstiger Verleger Curt Weller. Von Ausnahmen wie Eugen Kogons "Der SS-Staat" abgesehen, gab es kaum Interesse an einer selbstkritischen Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit.
Das Ziel einer Umerziehung mittels Büchern war nicht gescheitert, nur der Zeithorizont war viel zu knapp bemessen worden. Freiheit könne nicht befohlen werden, hatte Dolf Sternberger schon früh erkannt - sie zu erreichen war, wie sich erst langsam herausstellte, ein Generationenprojekt. MARK LEHMSTEDT
Stephan Füssel (Hrsg.): "Die Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert". Band 4: Bundesrepublik Deutschland, Teil 1: Westzonen, Politik, Institutionen.
De Gruyter Verlag, Berlin 2025. 516 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Westzonen, Politik, Institutionen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









