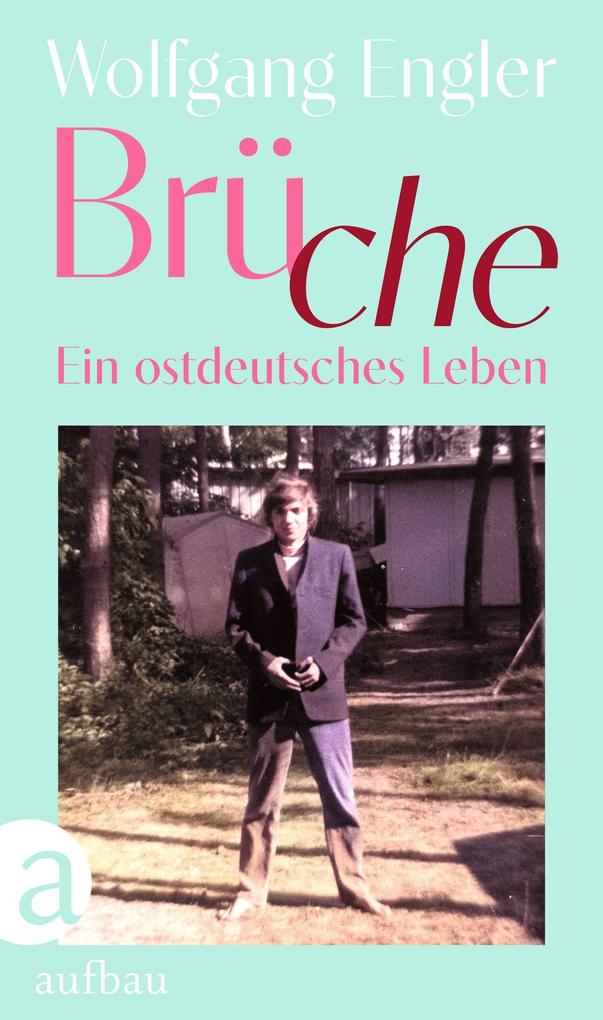Besprechung vom 07.08.2025
Besprechung vom 07.08.2025
Die Angst, kein Ossi zu sein
Es geht auch ohne Klassenverrat: Der Soziologe Wolfgang Engler blickt zurück auf seinen Werdegang
Seit einigen Jahren floriert das Genre des Klassismus-Memoirs. Ausgehend von Frankreich, wo Annie Ernaux, Didier Eribon und Édouard Louis ihren mühevollen Aufstieg in die Pariser Gesellschaft zu Bestsellern verarbeitet haben, gelangte diese Erzählweise auch nach Deutschland. Der Verlauf ist immer ähnlich: Jemand verlässt sein proletarisches Herkunftsmilieu, um Karriere zu machen, und hat Probleme, sich in der neuen bürgerlichen Umgebung zurechtzufinden: Der Habitus ist ihm fremd. Er weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Außerdem hadert er damit, dass er die eigenen Leute verraten musste, um oben anzukommen. Die Folge ist Scham, immerzu Scham und Wut auf die Arroganz der Eliten.
Wolfgang Englers neues Buch fügte diesen Geschichten vom Aufstieg eine weitere hinzu - und erweitert sie um eine spektakuläre Pointe: Der Soziologe, der in den Neunzigerjahren als Kenner der Ossis bekannt wurde, hat nämlich ein Gesellschaftsmodell erlebt, in dem Aufstieg ganz anders funktionierte: Er war normal, gehörte zu den gehaltenen Versprechen der DDR, wie Engler am Beispiel seiner eigenen Biographie erzählt.
Engler, der als halbes Arbeiterkind in Ost-Berlin aufwächst, bringt es in der DDR zum Universitätsdozenten - ganz ohne Klassenverrat, Scham über den Seitenwechsel, "falsche Ehrfurcht" und "Unterlegenheitsgefühle". Den Grund hierfür sieht Engler darin, dass die DDR als "arbeiterliche Gesellschaft" den sozialen Raum bewusst öffnete: Proletarier sollten studieren, und das Bürgertum war angehalten, sich für die Welt der Arbeiter zu interessieren. Sie alle verschmolzen zu einer "kultursozialistischen" Einheit, in der sich keiner besser fühlen durfte als der andere. Und niemand schlechter. Eigentlich sollte überhaupt niemand auffallen. Ein umfassendes Kulturprogramm, oft organisiert auf Basis der Betriebe, sorgte für die Herausbildung eines einheitlichen Geschmacks. "Werkleiter, Schriftsteller, Universitätsprofessoren" und Arbeiter pflegten "denselben robusten arbeiterlichen Habitus".
Dennoch - und das ist die nächste Pointe in diesem fulminant geschriebenen Buch - gab es durchaus Scham in der DDR. Keine Aufstiegs-, sondern eine Dauerscham, die das Leben begleitete. Als wäre sie aus den Verhältnissen zwischen den Klassen in den Alltag gewandert, wo sie zum Organisationsmittel der Gesellschaft wurde. "Wir waren", schrieb Engler "Kinder der Ordnung": "Gehemmtheit" und eine "Fremdheit" sich selbst gegenüber gehörten zur Gesellschaft der Gleichen.
War die DDR damit vielleicht sogar Avantgarde? Das klingt zumindest durch, wenn Engler in einem Kapitel Norbert Elias' Zivilisationstheorie ausführt. Elias, der heimliche Held dieses Buchs, ging davon aus, dass die Moderne zu Verdichtung, Verengung und zum Abbau von Standesunterschieden führt. Man muss miteinander auskommen. Das erhöht den Zivilisierungsdruck, die Normierung des Verhaltens. Die "Schamgrenze" rückt unaufhörlich vor. War die DDR also besonders zivilisiert, weil sich alle immerzu schämten?
Nach der Wiedervereinigung hatte Engler zunächst eine andere Theorie: Er warf seinen nörgelnden Landsleuten Anfang der Neunzigerjahre einen Mangel an "Zivilisierung" vor, lachte gemeinsam mit Westkollegen über die Unbeholfenheit der Ossis im neuen System. Heute schämt er sich dafür, wie er in langen Passagen voller Selbstzweifel bekennt. Er bereut sein fehlendes Einfühlungsvermögen damals, seinen "präsidialen Gestus", mit dem er über den Lagern schwebte, als hätten es beide Seiten nicht leicht miteinander: Ost wie West. Offenbar wollte er nicht, dass man ihn für einen Jammer-Ossi hält. Was die DDR nicht geschafft hatte, bewirkte nun die Wiedervereinigung: Engler fühlte sich als Verräter, als "Konvertit".
Er selbst ist in der Bundesrepublik nämlich weich gelandet, wurde als einer der wenigen Ost-Dozenten nicht abgewickelt und sogar zum Professor berufen. Seine Bücher wurden Bestseller, er schrieb als Gastredakteur für die "Zeit", unterrichtete in St. Gallen. Seine Landsleute hatten derweil zu knabbern. Arbeitslosigkeit, Treuhand und landesunkundige Machthaber aus dem Westen sorgten für eine Misere, die die DDR-Tristesse zu übertreffen schien: "Enteignung, Entwurzelung, Vertreibung", fasst Engler die Erfahrung jener Jahre zusammen.
Englers Buch liest sich wie eine Wiedergutmachung an den Ossis, mit denen er damals zu streng war. Dabei verführt ihn die nachträgliche Milde mitunter zu überzogener Nachsicht: Die Aufarbeitung der Stasi erklärt er zu einem bloßen Manöver der "Ablenkung", um die Ossis auf Linie zu bringen. AfD-Wähler findet er gar nicht so rechts; die AfD berge sogar "Chancen", das Land zu verbessern, wenn man den Unmut nur auf links drehe. Und Autoritäres oder einen Diktaturschaden kann Engler bei den Ossis nicht erkennen.
Dabei hat Engler zuvor eindrucksvoll die bedrückende Atmosphäre in der DDR geschildert, die "beklemmende Ähnlichkeit" und das Ressentiment gegen Abweichler, unter dem er selbst litt. Auch klingen halbverpflichtende Betriebsausflüge ins Musical im Namen des Kultursozialismus nicht gerade nach Wegen ins Reich der Freiheit. Dass er all dies beschreibt, aber nicht in seine Theorie des Ossis einfließen lässt, verweist auf einen Zwiespalt in der Person Englers, die uns wie der Protagonist eines wirklich aufregenden Romans vorgestellt wird: Er schwankt zwischen Ost und West, neigt mal zu der einen und dann umso heftiger zu der anderen Seite.
Insgeheim hat Engler womöglich das Gefühl, gar kein richtiger Ossi zu sein. Seine Referenzen - Luhmann, Elias, Habermas, Bourdieu - sind durch und durch westlich, was er an einer Stelle auch einräumt. Und als er 2017 als Rektor der Schauspielschule Ernst Busch verabschiedet wird, wird seine ostdeutsche Herkunft mit keinem Wort erwähnt. Die meisten seiner Kollegen, schreibt Engler ein wenig niedergeschlagen, wussten von ihr vermutlich gar nicht.
So entsteht der Eindruck, Engler will unbedingt dazugehören, ein Ossi sein. Da vergibt er seinen Landsleuten schon mal die eine oder andere Grobheit. Dabei ist diese Grobheit das eigentlich Interessante: Sie verweist auf ein Dilemma, das die Klassismus-Literatur kaum beleuchtet hat: Wer die Habitusschranken durchbrechen will, landet schnell beim kultursozialistischen Kollektiv, das ähnlich repressiv verfährt wie die verhassten Elitenzirkel - oder sogar noch ein bisschen derber, weil es sich nicht über-, sondern unterlegen fühlt. Klassismus von unten ist jedenfalls auch nicht ohne. MORITZ RUDOLPH
Wolfgang Engler: "Brüche". Ein ostdeutsches Leben.
Aufbau Verlag, Berlin 2025.
347 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.