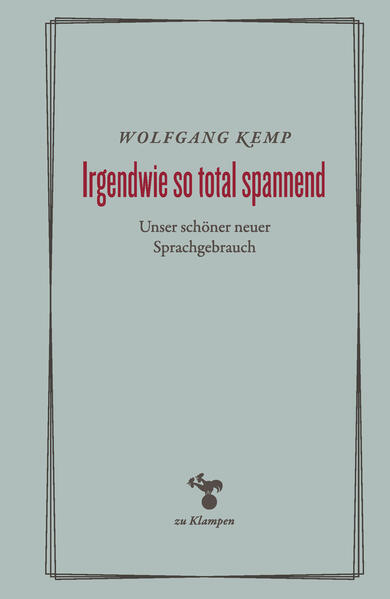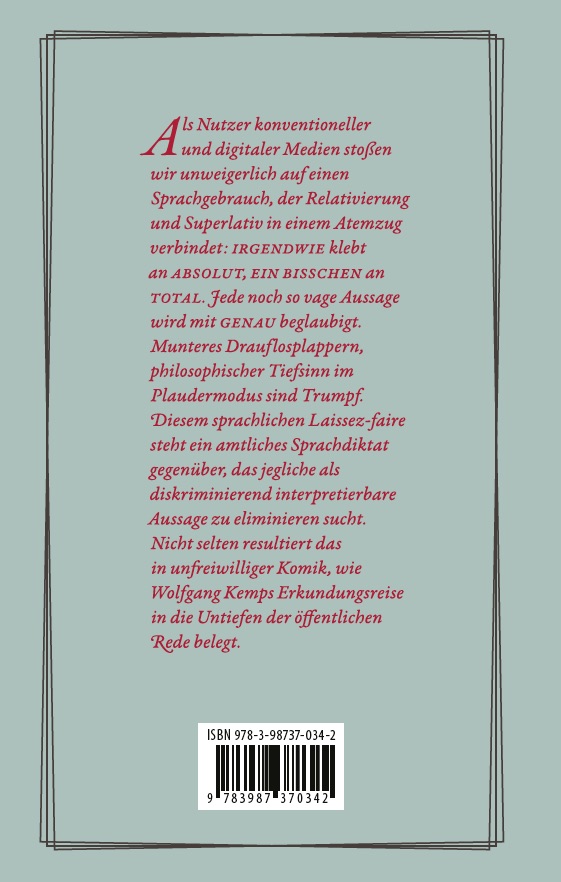Besprechung vom 03.06.2025
Besprechung vom 03.06.2025
Ich komme so ein bisschen von der Kritischen Theorie her
Der aktuelle Tiefstand eines immer geschwätziger werdenden Zeitgeistes: Wolfgang Kemp findet nichts Gutes am öffentlichen Sprachgebrauch
"Läuse im Pelz unserer Sprache" nennt der Linguist Peter Eisenberg die kleinen unscheinbaren Wörter wie "doch", "sehr", "so", "eben", "erst". Diese "Partikeln" - sie sind im Gegensatz zu ihren physikalischen Namensvettern feminin und haben ein -n im Plural - tönen das Gesagte ab, sie fokussieren Satzteile, lenken die Aufmerksamkeit des Zuhörers und halten den Sprachfluss am Laufen. Letzteres hat manchen Partikeln den Ruf eingetragen, überflüssige Füllwörter zu sein.
Eben die hat der Kunsthistoriker Wolfgang Kemp unter die sprachkritische Lupe gelegt. Er untersucht, wie "so" ("ist mir persönlich so total wichtig"), "irgendwie" ("auch so ein Schriftsteller irgendwie") oder das schon berüchtigte "sozusagen" ("sozusagen zutiefst beunruhigt") den medialen Sprachgebrauch durchwabern und was sie über den mentalen Habitus ihrer Sprecher verraten. Mit dabei sind auch Adjektivkombinationen wie "total gut", "ganz genau" oder "absolut spannend", die partikelgleich in die Sätze gestreut werden.
Das pandemische Vorkommen solcher Ausdrücke, in dem sich für Kemp der aktuelle Tiefstand eines immer geschwätziger werdenden Zeitgeistes spiegelt, ist freilich weniger neu, als der Autor meint: Die von ihm zum Leitwort seiner Untersuchung erklärte Partikel "so" bildet den Eröffnungssatz ("So.") im Roman "Geht in Ordnung - Sowieso -- Genau ---", der 1977 als zweiter Band der "Trilogie des laufenden Schwachsinns" erschien. In ihm setzt Eckhard Henscheid der Poesie des leer drehenden Geschwafels ein Denkmal und verweist im Anhang auf partikelkritische Sprachglossen dieser Zeitung ("Genau!") samt Leserbriefen. Henscheids Romanfiguren sind scheiternde Existenzen; die Schau- und Hörplätze ihres von Sechsämtertropfen beschwingten Dauergequatsches bilden Kneipentheken und ein trüber Teppichladen; ihr Publikum sind nur sie selbst.
Kemps Sprachmaterial hingegen - und da liegt das eigentlich Neue seiner Bestandsaufnahme - stammt aus den kulturell ambitionierten Plauder-Podcasts des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Sprachformen des laufenden Schwachsinns sind offenbar in den vergangenen Jahrzehnten aufgestiegen in den akademisierten Diskurs der gebildeten Stände. Kemp hat schöne Funde gemacht: "Von Ernst Jünger ist das ja auch so ein bisschen bekannt, das ist sehr anstrengend zu lesen", gibt ein podcastender Literaturkritiker zu bedenken. Eine Kollegin hat "irgendwie das Gefühl, dass da sozusagen die Zielrichtungen des gesamten feministischen Bestrebens von Beyoncé auch schon so ein bisschen durchgedrungen ist", und eine Literatursoziologin aus Bielefeld stellt sich dem Podcastpublikum mit "Ich komme so ein bisschen von der Kritischen Theorie her" vor. Dieser Herkunftsmetapher hat die gewesene Außenministerin Prominenz verschafft, als sie von sich sagte, sie komme "aus dem Völkerrecht", allerdings nicht "ein bisschen" - was völlig korrekt gewesen wäre -, sondern "eher".
Kemp macht zwei nebeneinander herlaufende Sprachspuren aus. Da sind zum einen die "Weichmacher" wie "sozusagen" und "irgendwie", Gesten der freundlichen Vagheit und intellektuellen Demut. In dieses "Umgehungsdeutsch" mischt sich das scheinbar gegenpolige "Ultradeutsch", das Exaktheit, Unbedingtheit und Totalität signalisiert: "absolut", "genau", "total", "definitiv". Damit versichern sich die Dialogpartner in wechselseitiger Permanenz ihrer Wertschätzung und der Richtigkeit ihrer Ansichten: "absolut spannend", "ganz genau", "total gut", "definitiv super".
Beides zusammen schafft, verbunden mit rituellen Sympathiekundgebungen ("schön, dass du da bist"), eine Studioatmosphäre fließend-flauschiger Barrierefreiheit und herzlichen Einvernehmens, deren Erzeugung leichtfällt, weil ohnehin nur eingeladen wird, wer die voreingestellte Harmonie der Gutgesinnten nicht zu stören droht. Sprachlich entsteht so ein Strom aus Wiederholungen, Schleifen und Füllseln, eine Aneinanderreihung von Satzteilen mit flachen syntaktischen und logischen Hierarchien, in der keine Sachaussage fixiert und jede argumentative Härte weichgespült wird.
Nun könnte man Kemp entgegenhalten, dass er die Spontaneität, das Improvisatorische der gesprochenen Sprache unfairerweise an den Normen der plan- und revidierbaren Schriftlichkeit misst. Doch schaut man sich Fernsehaufnahmen von Gesprächsrunden aus den Sechziger- und frühen Siebzigerjahren an, stellt man fest, dass es vor Talkshows und Laber-Podcasts eine Zeit gab, in der Diskutanten in der Lage waren, komplexe Gedankengänge gestochen scharf und füllstofffrei zu formulieren. Der zur Geschwätzigkeit neigende Parlando-Stil, der sich spätestens seit den Neunzigerjahren auch im Schreiben breitmacht, ist keine Folge der Mündlichkeit, sondern mangelnder gedanklicher Disziplin sowie des Wunsches, "locker rüberzukommen".
Kemp, der sich selbst als "Laienlinguisten" einstuft, mokiert sich zu Recht über die Kollegen vom Fach, die die Kritik an der Partikulitis als elitär und unwissenschaftlich abtun, selbst aber - ebenso wertend - die diskursive Kreativität dieser sprachwandlerischen Innovationen beteuern. An einer Stelle wäre allerdings mehr fachlinguistische Sorgfalt angebracht gewesen: Dass Partikeln "keine feste Stelle im Satzbau" hätten, weshalb ihre "schleichende Durchdringung des Sprachganzen" umso stärker sei, ist mindestens missverständlich formuliert. Zwar lassen sich Partikeln an unterschiedlichen Stellen, aber keineswegs überall im Satz platzieren. Diese begrenzte Flexibilität haben sie mit anderen Wortarten gemeinsam. Nicht die strukturellen Eigenschaften der Partikeln, sondern die mentalen Dispositionen der Sprecher sind für das "Sprachganze" verantwortlich.
Im zweiten Teil widmet sich Kemp dem Gendern als bürokratisch-autoritärem Eingriff in die gewachsenen Strukturen der Grammatik. Die Wahlverwandtschaft zwischen dem "geschlechtergerechten" Sprachgebrauch mit seinem Hang zu entpersönlichenden Formulierungen und der Sprache der verwalteten Welt ist freilich nicht, wie der Autor schreibt, bisher übersehen worden. Sie bildet vielmehr schon lange einen zentralen Punkt der Gender-Kritik. Kemps pointierte Schilderung, wie die einst im linksalternativen Milieu geborene "Frauensprache" in die Obhut der Kanzleien genommen und zur Richtschnur "hoheitlichen Sprachhandelns" gemacht wurde, ist deshalb nicht weniger lesenswert.
Protagonisten wie die "zentrale Frauenbeauftragte" der Berliner Humboldt-Universität, die wackeren Genderer der hannoverschen Stadtverwaltung oder die ehemalige, an der Flutkatastrophe gescheiterte Umweltministerin von Rheinland-Pfalz Anne Spiegel ("Bitte noch gendern: CampingplatzbetreiberInnen. Ansonsten Freigabe") überzeugen im Fach der Realsatire und der Tragikomödie gleichermaßen. Und wenn Kemp von "den Gleichstellungsbüros angeschlossenen Universitäten" schreibt, bringt er die Mischung aus Opportunismus, Indifferenz und wokem Bekenntniseifer, die die Leitungsgremien der Hochschulen gegenüber dem Sprachumbau an den Tag legen, auf den Punkt.
Das Buch ist nicht nur erhellend, sondern oft auch amüsant zu lesen, weil Kemp es versteht, die kernlose Schwammigkeit ambitionierten Laberns zu entlarven, indem er es beschreibend persifliert. Streckenweise schießt die parodistische Anverwandlung aber über das Ziel hinaus, dann droht die Gliederung des Textes so aus dem Leim zu gehen wie die Struktur der aufgespießten Satzbeispiele. Ähnliches gilt für die überreichlichen, unübersetzten Zitate aus postmodernistischen Werken amerikanischer Autoren sowie die dicht gestreuten Jargon-Anglizismen, mit denen Kemp sie kommentiert.
Falls hier die Kritik durch die Ausstellung des Kritisierten vollzogen werden soll, ist das gelungen: Die Lektüre dieser Passagen ist fast so enervierend wie die der Quellen, ihr linguistischer Erkenntnisgewinn für das Deutsche aber eher bescheiden. Sehr "fluide" ist schließlich der dritte Teil des Buches geraten, der sich Leitadjektiven der akademischen Populärkultur wie "spannend" und "schwierig" widmen soll, diese aber bald aus dem Blick verliert und dafür thematisch zwischen den sozialen Netzwerken und dem Kunstbetrieb, der Psychologie der Emojis, Frank Zappa, Martin Heidegger und den französischen Enzyklopädisten hin und her mäandert. Der Rezensent kam da irgendwie nicht mehr so mit. Er fühlte sich sozusagen nicht abgeholt. Ganz genau. WOLFGANG KRISCHKE
Wolfgang Kemp: "Irgendwie so total spannend". Unser schöner neuer Sprachgebrauch.
zu Klampen Verlag, Springe 2025.
144 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.