Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
15% Rabatt11 auf ausgewählte eReader & tolino Zubehör mit dem Code TOLINO15
Jetzt entdecken
mehr erfahren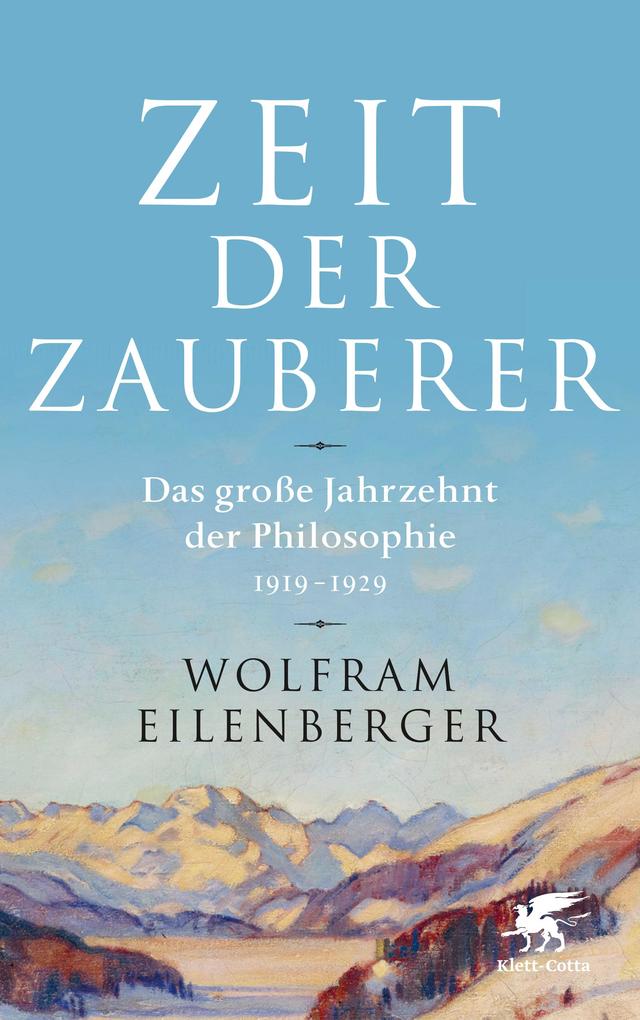
Zustellung: Mi, 27.08. - Fr, 29.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Jahre 1919 bis 1929 markieren eine Epoche unvergleichlicher geistiger Kreativität, in der Gedanken zum ersten Mal gedacht wurden, ohne die das Leben und Denken in unserer Gegenwart nicht dasselbe wäre. Die großen Philosophen Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer und Martin Heidegger prägten diese Epoche und ließen die deutsche Sprache ein letztes Mal vor der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs zur Sprache des Geistes werden.
Wolfram Eilenberger, Bestsellerautor, langjähriger Chefredakteur des »Philosophie Magazins« und der wohl begabteste und zurzeit auffälligste Vermittler von Geistesgeschichte im deutschsprachigen Raum, erweckt die Philosophie der Zwanziger Jahre und mit ihr ein ganzes Jahrzehnt zwischen Lebenslust und Wirtschaftskrise, Nachkrieg und aufkommendem Nationalsozialismus zum Leben. Der kometenhafte Aufstieg Martin Heideggers und dessen Liebe zu Hannah Arendt. Der taumelnde Walter Benjamin, dessen amour fou auf Capri mit einer lettischen Anarchistin ihn selber zum Revolutionär macht. Der Genius und Milliardärssohn Wittgenstein der, während er in Cambridge als Gott der Philosophie verehrt wird, in der oberösterreichischen Provinz vollkommen verarmt Grundschüler unterrichtet. Und schließlich Ernst Cassirer, der Jahre vor seiner Emigration in den bürgerlichen Vierteln Hamburgs am eigenen Leib den aufsteigenden Antisemitismus erfährt. In den Lebenswegen und dem revolutionären Denken dieser vier Ausnahmephilosophen sieht Wolfram Eilenberger den Ursprung unserer heutigen Welt begründet. Dank der großen Erzählkunst des Autors ist uns der Rückblick auf die Zwanziger Jahre zugleich Inspiration und Mahnung, aber in allererster Linie ein mitreißendes Lesevergnügen.
»Dieses schön erzählte Buch schildert die Jahre zwischen 1919 und 1929, in denen Heidegger, Wittgenstein, Benjamin und Cassirer Weltbedeutung gewannen. Zusammen bilden sie eine erstaunliche geistige Konstellation, vier Lebensentwürfe und vier Antworten auf die Frage: Was ist der Mensch? Herausgekommen ist dabei das Sternbild der Philosophie in einem großen Augenblick im Schatten der Katastrophen davor und danach. «
Rüdiger Safranski
Produktdetails
Erscheinungsdatum
28. Februar 2018
Sprache
deutsch
Untertitel
Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919 - 1929.
Originaltitel: Le Temps de Magiciens.
Nachdruck.
mit zahlreichen Abbildungen.
GB.
Auflage
Nachdruck
Seitenanzahl
431
Autor/Autorin
Wolfram Eilenberger
Illustrationen
mit zahlreichen Abbildungen
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
deutsch
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit zahlreichen Abbildungen
Gewicht
634 g
Größe (L/B/H)
221/141/43 mm
Sonstiges
GB
ISBN
9783608947632
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Ein genialer Coup ist Wolfram Eilenberger mit diesem Buch gelungen, die vier »Ausnahmephilosophen« Martin Heidegger, Walter Benjamin, Ludwig Wittgenstein und Ernst Cassirer zusammenzudenken [. . .] Eine Lektüre, die zeigt, wie zentral es für unser Leben und Überleben ist, auf welcher Grundlage wir denken. «Gisela Fichtl, Münchner Feuilleton, 06. 07. 2019 Gisela Fichtl, Münchner Feuilleton
»Das Buch, über das ich mich in diesem Jahr am meisten gefreut habe [. . .] Ein fast elegisches, berührend zu lesendes Buch«Rüdiger Safranski, Die Welt, 15. 12. 2018 Rüdiger Safranski, Die Welt
»Eilenberger ist Erzähler [. . .] Theorien serviert uns dieser Autor nicht wie fade, eisgekühlte Cocktails, sondern als Heisgetränke«Thomas Gärtner, Dresdner Neueste Nachrichten, 13. 12. 2018 Thomas Gärtner, Dresdner Neueste Nachrichten
»Es [das Buch] bietet keine trockene Philosophiegeschichte, sondern eine verständliche Einführung in die verschiedenen Weltbilder, die heftig aufeinanderprallten, aber auch in die Biographien der Denker, die unterschiedlicher kaum sein könnten«Damals, Ausgabe 12/2018 DAMALS
»Eilenberger [ist es] mit seiner Zeit der Zauberer gelungen, Maßstäbe zu setzen für ein philosophie- und wissenschaftshistorisches Sachbuch, das bei allem Interesse für seinen Gegenstand auch das Herz der eigenen Gegenwart trifft«Martin Ingenfeld, literaturkritik. de, 29. 11. 2018 Martin Ingenfeld, Literaturkritik. de
»ein Panorama des Denkens und Zeitgeschichte in einem«Romain Leick, Der Spiegel - Literaturspiegel, 24. 11. 2018 Romain Leick, SPIEGEL
»Eilenbergers Buch bewahrt das Staunen der Philosophie, nimmt aber die Ehrfurcht vor dem Unverständlichen weg. «Jörg Magenau, Tages-Anzeiger, 06. 08. 2018 Jörg Magenau, Tages-Anzeiger
»Immerhin haben wir noch Bücher, die uns die Faszination von einst für ein paar Tage zurückgeben können. Wolfram Eilenbergers Buch ist eines von ihnen. Wenn Sie nur für ein einziges Philosophiebuch Geld übrig haben: Nehmen Sie dieses. «Wolfgang Pichler, General-Anzeiger Bonn, 16. 06. 2018 Wolfgang Pichler, General-Anzeiger Bonn
»Die Angst, die Kreativität, der Taumel hatten dieses Jahrzehnt fest im Griff. Im Taumel der Gefühle legt man auch das Buch zur Seite und wünscht ihm viele Leser. «Michael Hesse, Frankfurter Rundschau, 20. 04. 2018 Michael Hesse, Frankfurter Rundschau
»Eilenberger ist nicht nur ein versierter Rechercheur, sondern durch sene schriftstellerischen Fähigkeiten auch ein begnadeter Vermittler. Es macht Freude, mit ihm tief in die Denkleben seiner Helden einzutauchen. «Ulrich Rüdenauer, Die Rheinpfalz, 18. 04. 2018 Ulrich Rüdenauer, Die Rheinpfalz
»Eilenberger ist ein Kritiker der an den Universitäten betriebenen Philosophie, und er löst das Problem, die "Goldenen Zwanziger" der Philosophie zu beschreiben, auf unakademische, gleichwohl erhellende Weise. «Harald Loch, Badische Zeitung, 28. 03. 2018 Harald Loch, Badische Zeitung
»"Zeit der Zauberer" heißt das Buch, in dem Eilenberger sachkundig und detailreich, spannend und gelehrt "das große Jahrzehnt der Philosophie" zwischen 1919 und 1929 erzählt die Dekade, in der sich Europas Schicksal zwischen Demokratie und Diktatur entschied, die Weltgeschichte gewissermaßen den Atem anhielt. «Roman Leick, Der Spiegel, 24. 03. 2018 Roman Leick, SPIEGEL
»Es gilt ein Buch vorzustellen, das auf lange Zeit seinesgleichen suchen wird. . . . Atemlos gespannt und immer wieder zum Nach-Denken angeregt, werden wir Zeugen eines Dramas, das uns wie ein Krimi fesselt und zum Verständnis unserer Gegenwart mehr beiträgt als so manche soziologische Studie. «Micha Brumlik, taz, 14. 03. 2018 Micha Brumlik, taz
»Wolfram Eilenberger hat ein großartiges Buch geschrieben. Mitreißend erzählt, klug, erhellend. "Zeit der Zauberer" ist beides zugleich: Inspiration und Mahnung. «Lydia von Freyberg, ttt, 11. 03. 2018 Lydia von Freyberg, titel thesen temperamente
»[Wolfram Eilenberger] bewahrt das Staunen der Philosophie, nimmt aber die Ehrfurcht vor dem Unverständlichen weg. Seine Qualität zeigt sich nicht zuletzt darin, dass er nicht Partei ergreift, sondern die verschiedenen Ansätze nebeneinander bestehen lässt. Damit macht er Lust darauf, bei jedem der vier nach- und weiterzulesen. «Jörg Magenau, Süddeutsche Zeitung, 09. 03. 2018 Jörg Magenau, Süddeutsche Zeitung
»Das Buch, über das ich mich in diesem Jahr am meisten gefreut habe [. . .] Ein fast elegisches, berührend zu lesendes Buch«Rüdiger Safranski, Die Welt, 15. 12. 2018 Rüdiger Safranski, Die Welt
»Eilenberger ist Erzähler [. . .] Theorien serviert uns dieser Autor nicht wie fade, eisgekühlte Cocktails, sondern als Heisgetränke«Thomas Gärtner, Dresdner Neueste Nachrichten, 13. 12. 2018 Thomas Gärtner, Dresdner Neueste Nachrichten
»Es [das Buch] bietet keine trockene Philosophiegeschichte, sondern eine verständliche Einführung in die verschiedenen Weltbilder, die heftig aufeinanderprallten, aber auch in die Biographien der Denker, die unterschiedlicher kaum sein könnten«Damals, Ausgabe 12/2018 DAMALS
»Eilenberger [ist es] mit seiner Zeit der Zauberer gelungen, Maßstäbe zu setzen für ein philosophie- und wissenschaftshistorisches Sachbuch, das bei allem Interesse für seinen Gegenstand auch das Herz der eigenen Gegenwart trifft«Martin Ingenfeld, literaturkritik. de, 29. 11. 2018 Martin Ingenfeld, Literaturkritik. de
»ein Panorama des Denkens und Zeitgeschichte in einem«Romain Leick, Der Spiegel - Literaturspiegel, 24. 11. 2018 Romain Leick, SPIEGEL
»Eilenbergers Buch bewahrt das Staunen der Philosophie, nimmt aber die Ehrfurcht vor dem Unverständlichen weg. «Jörg Magenau, Tages-Anzeiger, 06. 08. 2018 Jörg Magenau, Tages-Anzeiger
»Immerhin haben wir noch Bücher, die uns die Faszination von einst für ein paar Tage zurückgeben können. Wolfram Eilenbergers Buch ist eines von ihnen. Wenn Sie nur für ein einziges Philosophiebuch Geld übrig haben: Nehmen Sie dieses. «Wolfgang Pichler, General-Anzeiger Bonn, 16. 06. 2018 Wolfgang Pichler, General-Anzeiger Bonn
»Die Angst, die Kreativität, der Taumel hatten dieses Jahrzehnt fest im Griff. Im Taumel der Gefühle legt man auch das Buch zur Seite und wünscht ihm viele Leser. «Michael Hesse, Frankfurter Rundschau, 20. 04. 2018 Michael Hesse, Frankfurter Rundschau
»Eilenberger ist nicht nur ein versierter Rechercheur, sondern durch sene schriftstellerischen Fähigkeiten auch ein begnadeter Vermittler. Es macht Freude, mit ihm tief in die Denkleben seiner Helden einzutauchen. «Ulrich Rüdenauer, Die Rheinpfalz, 18. 04. 2018 Ulrich Rüdenauer, Die Rheinpfalz
»Eilenberger ist ein Kritiker der an den Universitäten betriebenen Philosophie, und er löst das Problem, die "Goldenen Zwanziger" der Philosophie zu beschreiben, auf unakademische, gleichwohl erhellende Weise. «Harald Loch, Badische Zeitung, 28. 03. 2018 Harald Loch, Badische Zeitung
»"Zeit der Zauberer" heißt das Buch, in dem Eilenberger sachkundig und detailreich, spannend und gelehrt "das große Jahrzehnt der Philosophie" zwischen 1919 und 1929 erzählt die Dekade, in der sich Europas Schicksal zwischen Demokratie und Diktatur entschied, die Weltgeschichte gewissermaßen den Atem anhielt. «Roman Leick, Der Spiegel, 24. 03. 2018 Roman Leick, SPIEGEL
»Es gilt ein Buch vorzustellen, das auf lange Zeit seinesgleichen suchen wird. . . . Atemlos gespannt und immer wieder zum Nach-Denken angeregt, werden wir Zeugen eines Dramas, das uns wie ein Krimi fesselt und zum Verständnis unserer Gegenwart mehr beiträgt als so manche soziologische Studie. «Micha Brumlik, taz, 14. 03. 2018 Micha Brumlik, taz
»Wolfram Eilenberger hat ein großartiges Buch geschrieben. Mitreißend erzählt, klug, erhellend. "Zeit der Zauberer" ist beides zugleich: Inspiration und Mahnung. «Lydia von Freyberg, ttt, 11. 03. 2018 Lydia von Freyberg, titel thesen temperamente
»[Wolfram Eilenberger] bewahrt das Staunen der Philosophie, nimmt aber die Ehrfurcht vor dem Unverständlichen weg. Seine Qualität zeigt sich nicht zuletzt darin, dass er nicht Partei ergreift, sondern die verschiedenen Ansätze nebeneinander bestehen lässt. Damit macht er Lust darauf, bei jedem der vier nach- und weiterzulesen. «Jörg Magenau, Süddeutsche Zeitung, 09. 03. 2018 Jörg Magenau, Süddeutsche Zeitung
 Besprechung vom 13.08.2025
Besprechung vom 13.08.2025
Rilkes Schnupfen und Picassos Katzen
Von Florian Illies' "1913" bis Uwe Wittstocks "Marseille 1940": Seit mehr als einem Jahrzehnt reüssieren historische Sachbücher, die kleine Szenen aus dem Alltag von Dichtern und Denkern zu einem Zeitpanorama montieren. Ist das moderne Geschichtsschreibung oder Netflix für Bildungsbürger?
Rainer Maria Rilke hat Schnupfen." So lesen wir im Kapitel "März" von Florian Illies' Sachbuch "1913: Der Sommer des Jahrhunderts". Davor steht, durch Raute und Leerzeilen getrennt, ein kaum seitenlanger Abschnitt zum Selbsthass und Alkoholismus des Dichters Georg Trakl. Nach Rilkes Schnupfen und einem weiteren Trennungszeichen hören wir von der "schwer depressiven" Virginia Woolf, die ihr erstes Romanmanuskript zum Verleger schickt. Soll die Empfindlichkeit Rainer Maria Rilkes also mit den wirklichen Problemen anderer Schriftsteller kontrastiert werden? Solche Vergleiche werden ebenso dem Leser überlassen wie eine etwaige Verbindung von Rilkes Gesundheitszustand und seinem Werk.
Gerade weil die Bedeutung dieses Schnupfens in der Literaturgeschichte aber offenbleibt, ist seine Bedeutung in der Literaturgeschichtsschreibung umso erheblicher. Denn der eingangs zitierte Satz treibt, in seiner Alltäglichkeit und Unverbundenheit, Illies' Methode in "1913" auf die Spitze. Und mit dieser Methode, so heißt es heute im Klappentext, begründete das Buch "ein neues Genre der erzählenden Geschichtsschreibung".
Man kann das kaum als großspurige Eigenwerbung des Verlags abtun. Erschienen 2012 und damit überpünktlich zum Jubiläum (wenn man bei einer bloßen Jahreszahl von einem Jubiläum sprechen kann), ist "1913" zu einem der erfolgreichsten deutschen Sachbücher des einundzwanzigsten Jahrhunderts avanciert. Während Verlage in der Regel schon mit ein paar Tausend verkauften Exemplaren zufrieden sind und deutsche Autoren sich im Ausland eher schwertun, stand "1913" achtzehn Wochen lang auf Platz eins der "Spiegel"-Bestsellerliste, verkaufte sich rund eine Million Mal und wurde in 27 Sprachen übersetzt.
Rasch fand Illies' Erfolgsmodell fast ebenso erfolgreiche Nachahmer. Volker Weidermann mit "Ostende 1936" und "Träumer", Wolfram Eilenberger mit "Zeit der Zauberer" und "Feuer der Freiheit", Uwe Wittstock mit "Februar 33" und "Marseille 1940", Illies mit seinen eigenen Sequels "1913: Was ich unbedingt noch erzählen wollte" und "Liebe in Zeiten des Hasses": Sie alle schreiben über große Schriftsteller, Künstler und Philosophen, bevorzugt der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie alle montieren kurze Szenen aus dem Alltag dieser Intellektuellen zu einem Panorama ihres Lebens und ihrer Zeit. Und sie alle zählen damit zu den gegenwärtig meistverkauften Autoren ihrer durchweg sehr renommierten Verlage, ja zu den meistverkauften Sachbuchautoren überhaupt. Was ist es, das ihre Werke neu, aufregend und erfolgreich macht? Und was geht dabei womöglich verloren?
Traditionell gelten Sachbücher, zumal historische, als anstrengend und schwer. Wenn Texte, frei nach Horaz, entweder nützen oder erfreuen sollen, steht hier eindeutig der Nutzen, im Sinne des Wissenszuwachs, im Vordergrund. Für diesen Wissenszuwachs, so häufig die stillschweigende Annahme, muss der Leser die ein oder andere Strapaze auf sich nehmen, etwa abstrakte Gedankengänge nachvollziehen oder mit fremden Begriffen hantieren lernen.
Die Sachbücher von Illies und seinen Nachfolgern sind dagegen alles andere als anstrengend und schwer. Das beginnt bei der Länge der Texteinheiten. Während sich traditionelle Kapitel über Dutzende Seiten ziehen, sind die Abschnitte hier oft nur ein paar Zeilen, selten mehr als ein oder zwei Seiten lang, durch Asteriske oder andere Sonderzeichen getrennt und auch inhaltlich kaum verbunden. Gerade noch sahen wir Thomas Mann sein neues Grundstück besichtigen, jetzt hören wir von Picassos drei Siamkatzen, gleich blicken wir Kafka bei seinen selbstbezichtigenden Liebesbriefen an Felice Bauer über die Schulter: alles innerhalb von einer Minuten Lesezeit. So fühlt sich auch ein Leser mit geringer Aufmerksamkeitsspanne hinreichend unterhalten, kann jederzeit aus- und einsteigen. Fast ist es, als scrolle man durch den Feed eines Social-Media-Accounts im Jahr 1913 oder 1933.
Wie in vielen Medienformaten der Gegenwart wird zudem einiges getan, um das Geschehen so nah wie möglich an den Betrachter heranzuholen. Der fast durchgehende Gebrauch des Präsens hilft, die historische Distanz zu überbrücken. Äußere Beschreibungen wie Angaben zum Wetter erzeugen eine realistische Atmosphäre, lassen den Leser mitsehen und mitfühlen: "Berlin friert schon seit Wochen", beginnt Wittstocks "Februar 33"; "die bunten Badehäuser leuchten in der Sonne", hebt Weidermanns "Ostende 1936" an. Man erkennt, dass die Autoren Feuilletonisten sind, und nicht Wissenschaftler, wie sonst bei historischen Sachbüchern üblich. Bisweilen überschreiten sie gar die Grenze zur Fiktion: Während Wittstock betont, dass kein noch so kleines Detail bei ihm erfunden sei, hat man Illies' allwissendem Erzähler einige Sachfehler nachgewiesen. Weidermann wiederum setzt so stark auf eine anschauliche Außen- und psychologisierende Innensicht, dass sich mancher Rezensent fragte, ob "Ostende 1936" noch ein erzählendes Sachbuch oder nicht eher ein auf Tatsachen beruhender Roman sei.
Vor allem aber sorgt für Nahbarkeit, dass die großen Geister der Vergangenheit nicht in ihrem Denken, sondern in ihrem Alltag präsentiert werden: in dem Bereich also, den sie mit uns teilen und den wir deshalb am besten nachvollziehen können. Das gilt selbst dann, wenn sie sich darin - wie man es von Genies fast schon erwartet - vollkommen außergewöhnlich verhalten: Kaum jemand würde, wie Ludwig Wittgenstein, auf ein Millionenerbe verzichten, um Volksschullehrer zu werden; dennoch sind uns Fragen von Erbe und Berufswahl näher als Probleme der analytischen Sprachphilosophie. Die "Duineser Elegien" konnte nur Rilke schreiben, Schnupfen aber hatte jeder schon einmal.
Nun sind Illies und seine Nachfolger nicht die Ersten, die die Großen der Geschichte im Kleinen darstellen wollen. Schon im ersten Jahrhundert nach Christus provozierte der griechische Biograph Plutarch die traditionell kriegsversessenen Historiker der Antike mit der These, "eine kleine Sache, ein Wort oder ein Witz" sage mehr über den Charakter eines Menschen aus als "Schlachten mit Tausenden von Toten". Der ebenso rebellisch gestimmte Friedrich Nietzsche plädierte in seiner Frühschrift "Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen" für dezidierte Unvollständigkeit: "Aus drei Anekdoten ist es möglich, das Bild eines Menschen zu geben". Egon Friedell schließlich, Sprössling der Wiener Moderne und Autor einer bis heute viel gelesenen "Kulturgeschichte der Neuzeit", hielt die Anekdote gar für die "einzig berechtigte Kunstform der Kulturgeschichtsschreibung".
Der Sinn des Kleinen liegt nach solcher Auffassung darin, pars pro toto auf etwas Größeres zu verweisen: auf den Charakter eines Herrschers, die Eigenheiten eines Denkers oder die Merkmale einer Epoche. Doch was die Werke von Plutarch oder Friedell zu Klassikern gemacht hat, ist bei Illies und Co. deutlich schwerer zu entdecken. Auf welches Größere verweisen Kafkas Liebesnöte oder Picassos Katzen? Mit anderen Worten: Was wollen uns die Erfolgsbücher der vergangenen Jahre eigentlich sagen?
Wolfram Eilenbergers Bestseller "Zeit der Zauberer", "Feuer der Freiheit" und "Geister der Gegenwart" lassen sich noch am ehesten als Einführung in Leben und Werk der behandelten Figuren begreifen, als popularisierende Philosophiegeschichte. Zu Wittgensteins "Tractatus logico- philosophicus" zum Beispiel schreibt Illies nur, dieser sei "so komplex, dass selbst Russell, als er brieflich darum gebeten wird, Korrektur zu lesen, sich noch einmal seine eigenen Fragen schicken lassen muss, um Wittgensteins Antworten zu verstehen". Eilenberger dagegen zitiert immer wieder aus dem Werk, fasst dessen Grundgedanken zusammen und setzt die Entstehung mit Wittgensteins Kriegserlebnissen in Beziehung. Es hilft zweifellos, dass er sich auf je vier Protagonisten konzentriert, und sich die Schriften von Philosophen leichter auf ein paar Thesen bringen lassen als die Romane der von Illies, Wittstock und Weidermann vorrangig behandelten Dichter.
Bei Wittstock und Weidermann steht meist ein dramatischer historischer Augenblick im Mittelpunkt: die Münchner Räterepublik 1918/19 ("Träumer"), die ersten Wochen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ("Februar 33") oder der deutsche Frankreichfeldzug mit seinen Folgen für literarische Emigranten ("Marseille 1940"). Wittstock formuliert sogar so etwas wie ein historiographisches Programm. Angesichts erschreckender Parallelen zur Gegenwart wolle er zeigen, "was nach einer fatalen politischen Fehlentscheidung mit einer Demokratie geschehen kann", schreibt er im Vorwort zu "Februar 33". Und im Nachwort zu "Marseille 1940" beklagt er, dass Varian Fry, der Protagonist seines Buchs und wichtigste Fluchthelfer deutscher Emigranten, bislang nicht die Anerkennung gefunden habe, die er verdiene.
Am schwersten ist eine Aussageabsicht beim erfolgreichsten der Autoren, bei Florian Illies, zu identifizieren. Die Hunderte Szenen in den beiden Büchern zu "1913" verbindet wenig mehr als ihre bloße Gleichzeitigkeit. Zwar entdeckt man bei manchen Figuren über die insgesamt 600 Seiten gewisse Verhaltensmuster, die gelegentlich auch zu einem Charakterbild verdichtet werden. So, wenn Illies Kafka kommentiert: ",Noch immer unentschieden. Franz'. Vier Wörter, eine Autobiographie." Doch sind die behandelten Figuren ja nicht durch ihre Persönlichkeit, sondern durch ihre Werke in die Geschichte eingegangen - und Letztere sind für Illies meist nur als Kuriositäten interessant. Auch in der Verlagsankündigung zu seinem nächsten Buch, das im Oktober erscheinen und die "Familie Mann in Sanary" behandeln soll, ist von Literatur keine Rede.
Man wird Wittstock, Weidermann und Illies vermutlich am ehesten gerecht, wenn man ihre Bücher nicht als Geistes-, sondern als Zeitgeschichte betrachtet und daran bemisst. Das Größere, auf das die vielen Anekdoten verweisen, ist vielleicht einfach die Summe seiner Teile: ein historisches Panorama. Der Wert ihrer Bücher liegt dann nicht primär darin, die Dichter und Denker von ihren Denkmälern ins Alltagsleben zu holen. Ihr Wert liegt vor allem darin, in diesem Alltagsleben eine vergangene Epoche erfahrbar zu machen - wozu Schnupfen ebenso gehören kann wie Emigration. Das hohe Erzähltempo und der häufige Perspektivwechsel erhöhen die immersive Anziehungskraft zusätzlich. Nach mehreren Stunden binge reading von "1913" glaubt man sich womöglich wirklich ins Jahr 1913 zurückversetzt.
Wie bei vielen Netflix-Serien oder Social-Media-Formaten hat die unmittelbare Anschaulichkeit der Darstellung freilich auch ihre Schattenseiten. Denn so sehr Nahbarkeit und Einfühlung dazu beitragen, den Betrachter ins Geschehen hineinzuziehen, braucht es zur Erkenntnis doch Abstand und Reflexion. Die besten historischen Sachbücher wechseln daher Passagen lebhafter Erzählung mit Passagen betrachtender Analyse ab. Letztere fehlen bei Illies und Co. Die einzelnen Szenen folgen in einem solchen Tempo aufeinander, dass dem Leser keine Zeit bleibt, über Zusammenhänge und Kausalitäten nachzudenken - geschweige denn dass die Texte selbst darüber reflektierten. Hätte die Moderne auch ohne den Ersten Weltkrieg ihren gesellschaftlichen Durchbruch erlebt? Inwiefern trugen deutsche Intellektuelle zur geistigen Atmosphäre bei, die den Nationalsozialismus erst ermöglichte? Antworten auf solche Fragen sucht man vergebens. Der Wissenszuwachs bleibt begrenzt.
So hängt die Bewertung der jüngsten Erfolgsbücher auch von der eigenen Sicht auf die Gegenwart ab, der eigenen Haltung zu Geistesdemokratismus respektive Kulturkritik. Entweder man freut sich, dass Illies und andere eine Form gefunden haben, mit der sich auch im 21. Jahrhundert ein breites Publikum für die Geschichte und Kultur der Klassischen Moderne interessieren lässt. Oder aber man bedauert die Vereinfachungen und Verrenkungen, die dafür offenbar nötig sind. Wie jedes Geschichtswerk ist auch das historische Sachbuch der Gegenwart ein Kind seiner Zeit. JANNIS KOLTERMANN
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 02.05.2025
Unterhaltsam erzählt, nett als Hörbuch. Das Interessanteste kommt, wie so oft, zum Schluss. Ein guter Auftakt der Trilogie. Gern gehört.
LovelyBooks-Bewertung am 06.05.2019
Erzählendes Sachbach über Martin Heidegger, Ernst Cassirer, Ludwig Wittgenstein und Walter Benjamin und v. w.
REZENSION ¿ZEIT DER ZAUBERER¿ VON WOLFRAM EILENBERGERZUM INHALT ¿ZEIT DER ZAUBERER¿Auf der einen Seite handelt es sich bei ¿Zeit der Zauberer¿ von Wolfram Eilenberger um eine Zusammenfassung der Biografien vier großer Philosophen, ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen und ihres Umfelds und auch ihrer in dieser Zeit veröffentlichten Werke. Der Autor zeigt uns nicht nur die Philosophen, sondern er erweckt sie zum Leben, indem er ihre menschliche Seite zeigt. Auf der anderen Seite ist es auch ein geisteswissenschaftliches Porträt der Zwanziger Jahre.Exemplarisch herausgegriffen hat Wolfram EilenbergerLUDWIG WITTGENSTEIN (1889¿1951)Werk ¿Tractatus Philosophicus¿¿Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt¿ ¿Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.¿¿Die Welt ist alles, was der Fall ist.¿Daraus entwickelte sich später der Logische Positivismus. Er Ist der Vater der Analytischen Sprachphilosophie.MARTIN HEIDEGGER (1889 ¿ 1951)Werk ¿Sein und Zeit¿In Davos 1929 treffen sich Ernst Cassirer und Martin Heidegger. Heidegger ist aus heutiger Sicht der Vater der Hermeneutik und des Existentialismus.ERNST CASSIRER (1874-1945)Ohne erst Cassirer gäbe es keine Kulturwissenschaft. Er hält die Ideale der Aufklärung hoch. Er war einer der letzten Universalgelehrten, hatte aber keinen Willen zu einer eigenen Sprache.WALTER BENJAMIN (1892-1940)Walter Benjamin ist Mitbegründer der Frankfurter Schule und der kritischen Theorie. Walter Benjamins Leben wird als hoch emotional geschildert. Depressionen, Geldnot und familiäre Probleme machten ihn zu einer glücklosen Existenz. Er nahm sich 1940 in Paris das Leben.Wolfram Eilenberger lässt die vier Philosophen lebendig werden und erzählt dabei nicht nur über die Entstehung ihrer großer Werke, sondern auch wie sich ihr Denken mit dem Privatleben vereinbart hat. Hierzu lässt der Autor weitere Personen aus dem Umfeld auftreten: Hannah Arendt, Karl Jaspers und Theodor Wiesengrund Adorno und noch viele Weitere. Was haben die vier gemeinsam? Was unterscheidet sie? Nur einer der vier Philosophen war ein Demokrat, Ernst Cassirer. Bis auf Heidegger gehörten die genannten Philosophen dem jüdischen Glauben an.In der beobachteten Dekade wächst das Wissen exponentiell. Konnte nach so einer großen Katastrophe, wie dem Ersten Weltkrieg, Metaphysik überhaupt noch eine Bedeutung haben? Wie sieht es mit der Sprache und deren Unvermögen über ¿Höheres¿ zu kommunizieren, aus? Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?Die Zeit offenbart eine Revolution des Denkens. Es geht um Erkenntnistheorie: Wie viel von seiner Umwelt bzw. überhaupt von der Welt kann der Mensch erfassen? Was sagen die empirischen Sprachwissenschaften? Wie lässt sich der Mythos damit verbinden? Was Können Anthropologen und Ethnologen dazu beitragen? Letztendlich: Was sagen die theoretischen Physiker?Das Ziel eines interdisziplinären Forums wird formuliert. ¿Das Ding an sich¿, dessen Erkenntnis Immanuel Kant dem Menschen abgesprochen hat, spielt nach dem 1. Weltkrieg keine große Rolle mehr. Jaspers, Heidegger und die französischen Existentialisten führen eine neue Terminologie ein: Daseinssorge ¿ Dasein ¿ das je¿meinige Leben ¿ Grenzerfahrungen ¿ Das Umgreifende ¿ Gott ist tot!Wolfram Eilenberger (Vielen sicherlich bekannt aus Sternstunde Philosophie) zeigt, wodurch seiner Meinung nach die vier Philosophen diese Epoche geprägt haben. Dabei entwickelten sich folgende Fragen:Wie weit dringt das philosophische Denken in den Alltag ein? Gehört es immer zum Alltag?4/5 PunktenSPRACHLICHE GESTALTUNGWolfram Eilenbergers Erzählstil ist leicht, gut verständlich und unterhaltsam. Die Kapitellänge ist angenehm.5/5 PunktenCOVER UND ÄUSSERE ERSCHEINUNDas Cover ist ansprechend, sagt aber wenig aus.3/5 PunktenFAZIT / REZENSION ¿ZEIT DER ZAUBERER¿ VON WOLFRAM EILENBERGERDer Leser erkennt schnell, dass sich mit Sicherheit gewaltige Synergieeffekte ergaben, sobald diese Philosophen miteinander agierten.Wolfram Eilenberger zeigt dabei, wie eng die Beziehung zwischen Existenz und Theorie war. Das Denken und das Leben sind miteinander verknüpft. Ludwig Wittgenstein verschenkt seine Milliarden. Walter Benjamin fand nie wirklich sein Glück.Zu Martin Heidegger: Heidegger sagte über Aristoteles:¿Aristoteles wurde geboren, arbeitete und starb¿. Er sah das Werk getrennt von der Biografie des Autors, der er keine Bedeutung beimaß. Ich sehe das anders. Mir fehlt jegliches Verständnis für Martin Heidegger. Wolfram Eilenberger betrachtet Martin Heidegger aus einer bewusst objektiven Distanz. Ich kann das nicht. In meinen Augen gehören Werk und Autor als Einheit zusammen.Während Hannah Arendt Heidegger als Philosophen sehr schätze, war sie menschlich von ihm zutiefst enttäuscht. Er war 1933 der NSDAP beigetreten. Sie bezeichnete es als eine ¿Entfremdung von Feinden¿.Rezension ¿Menschen in finsteren Zeiten¿ Hannah ArendtErnst Cassirer scheint der Einzige zu sein, der die Philosophie nicht in sein Familienleben ließ und zufrieden lebte.Für Liebhaber von Philosophie, Geschichte auch Zeitgeschichte, lohnt es sich in jedem Fall, das Buch zu lesen. Es ermuntert zum Recherchieren und nachlesen. Vielleichte ist es aktueller, als es auf den ersten Blick scheint@NetgalleyDe und Klett-CottaVielen Dank für das Rezensionsexemplar!Ich vergebe insgesamt 4/5 Punkten.









