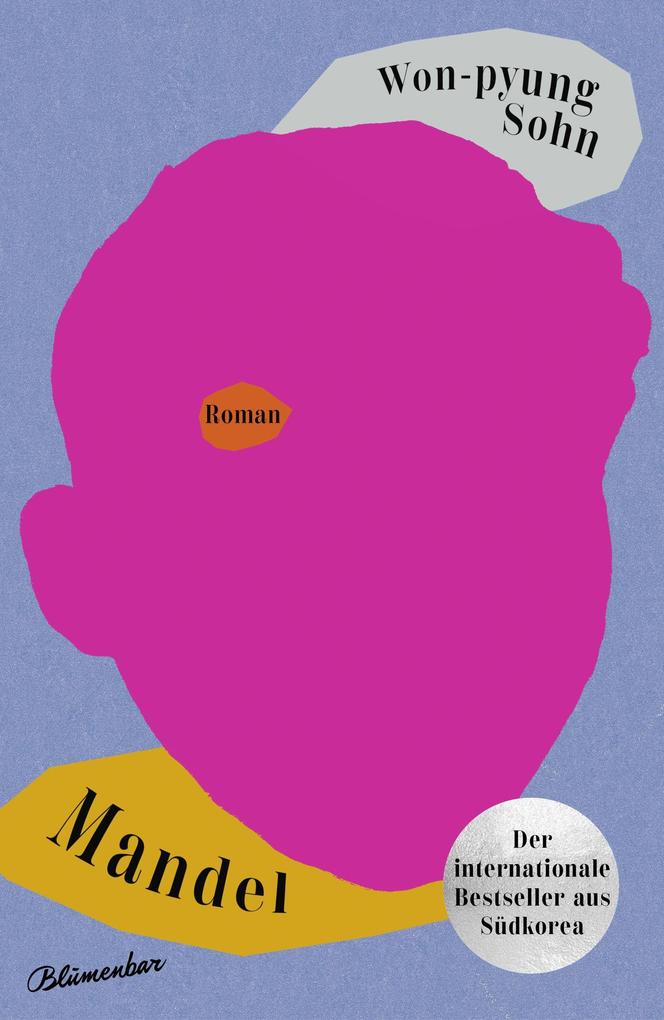Besprechung vom 06.11.2024
Besprechung vom 06.11.2024
Ganz wie Siddhartha
Won-pyung Sohns Welterkenntnis und Weckerlebnisse
Der in Korea 2017 erschienene Bestseller und buddhistisch inspirierte Bildungsroman "Mandel" der Regisseurin und Autorin Won-pyung Sohn kreist leitmotivisch um Themen wie Alterität und Außenseitertum, Ausgrenzung, Mobbing, Gewalt. Yunjae, der jugendliche Held der Geschichte, leidet unter einer durch angeborene Verkleinerung der Amygdala - des auch "Mandelkern" genannten Teils des Gehirns - verursachten Alexithymie. Die Krankheit bewirkt, dass er kaum Gefühle empfinden oder die anderer lesen kann.
Yunjae wächst beschützt auf bei Mutter und Oma, die in ihrem Haus ein Antiquariat betreiben. Er paukt anhand von Beispieldialogen oder Zetteln der Mutter mit Aufschriften wie "Lächle zurück" oder des magischen Worts "Entschuldigung" das Abc der Gefühle. Sein "verkorkstes Gehirn" lernt die Bedeutung hinter den Regungen. Er lernt das Lächeln, Notlügen und Überleben im hochkompetitiven koreanischen Gesellschaftsspiel.
Doch just an seinem sechzehnten Geburtstag werden Yunjaes Oma und Mutter Opfer eines Amoklaufs. Der Moment größter Not wird ihm zum Umkehrsignal. Allmählich treten neue Menschen in sein Leben. Es ist ein an Prüfungen reicher Bildungsroman des Herzens. Wie die Bücher des Antiquariats, das er nach Schulschluss weiterführt, wartet er auf jemanden, der die verborgenen Seiten seiner Seele aufschließt: "Bücher sind still. Sie bleiben stumm, bis jemand sie öffnet. Dann erzählen sie eine Geschichte."
Doch seine Umwelt nennt ihn ein Monster oder "Psycho". Ausgerechnet mit dem in Waisenhäusern und im Jugendgefängnis aufgewachsenen Mitschüler Gon entspinnt sich eine Außenseiterfreundschaft. Gons frühzeitig verstorbene Mutter hatte ihn in einem Vergnügungspark verloren, und die Annäherung an seinen nach dreizehn Jahren wiedergefundenen Vater, einen alltagsfernen Wirtschaftsprofessor, gestaltet sich schwierig, doch nicht unmöglich. Weitere Bezugspersonen Yunjaes sind Dr. Shim, ein im selben Haus eine Bäckerei betreibender ehemaliger Herzchirurg, der sein Mentor wird, und die phantasiebegabte Schülerin Dora. Yunjae lernt die Arithmetik der Gefühle und dass "das Mitfühlen meiner Traurigkeit durch andere mich glücklich macht, dass also zwei Negative etwas Positives ergeben".
Das Buch schildert Wachstumsschübe der Welterkenntnis und Weckerlebnisse der Empathie. Es ist eine buddhistische "Éducation sentimentale" und Schule des Mitgefühls. Als sich ausgerechnet der gewaltaffine Gon Gedanken über "Schicksal und Zeit" macht und darüber, dass Bettler, die auf dem Bauch kriechen, "vielleicht ganz anders ausgesehen" haben, als sie jung waren, entgegnet ihm Yunjae: "Siddhartha hatte ähnliche Gedanken wie du und verließ den Palast."
In gewitzten Dialogen zwischen dem gefühlstauben Yunjae und dem abgestumpften Gon verhandelt das Buch Konformismus und Makel, Norm und Normalität. Beide lernen, dass Vorurteile entkräftet, frühkindliche Biographien und ärztliche Etikettierungen revidiert werden können. Ferner stehen Dora und Gon für wesenhafte Gegenpole: "Während Gon versuchte, mir Schmerz, Schuld und Leid zu vermitteln, lernte ich mit Dora Blumen, Düfte, den Wind und Träume kennen."
Im intertextuellen Spiel alludiert Sohn auf "Der Fänger im Roggen", mit dem gefühlsunfähigen "Anti-Werther" Yunjae auf Goethe, und sie zitiert Erich Fromms "Die Kunst des Liebens" als Kritik am Warencharakter der Liebe. Als Ode auf die Freundschaft ohne Kalkül bietet der luzide Roman jenseits von kommerzialisierter Unwahrhaftigkeit eine Anleitung zum Wiedererlernen echter Gefühle und zum Zulassen von Verletzlichkeit. In Zeiten von Mobbing und hate crimes an Minderheiten beschwört es nicht nur im Kontext Koreas das "Geschenk eines mitfühlenden Herzens". STEFFEN GNAM
Won-pyung Sohn:
"Mandel". Roman.
Aus dem Koreanischen von Sebastian Bring. Blumenbar Verlag, Berlin 2024.
224 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.