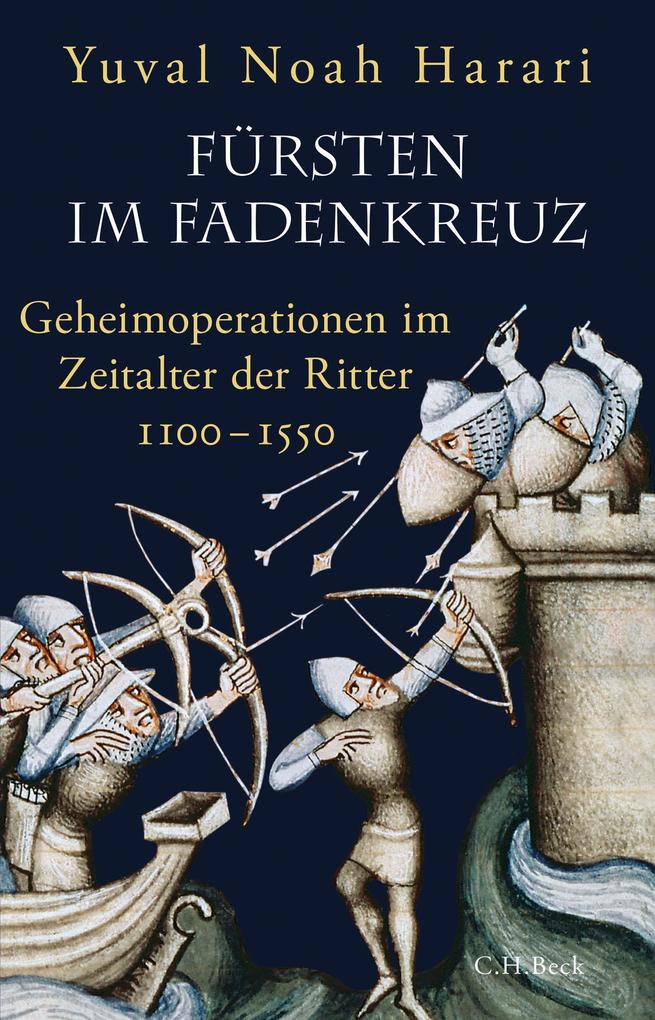Besprechung vom 26.02.2020
Besprechung vom 26.02.2020
Dolch im Gewand
List, Verrat und Strickleitern: Yuval Noah Harari spürt geheimen Kommandos im Mittelalter nach.
Konrad von Montferrat war ein kriegserprobter Mann. Erst kurz nach der Schlacht von Hattin im Juli 1187, bei der die abendländischen Ritter von Saladin entscheidend besiegt worden waren, hatte er das Heilige Land betreten und musste hier auch den Fall der Stadt Jerusalem miterleben. Tyros, die Hafenstadt in Palästina, hatte er indessen zur Festung der Christen ausgebaut und Isabella, die Erbin des eigentlich verlorenen Königreichs Jerusalem, zur Ehe gezwungen. Nach Ausschaltung eines Konkurrenten wartete er nun auf seine feierliche Krönung.
Man schrieb den 28. April 1192, als der ungekrönte König, begleitet nur von zwei Bewaffneten, durch die Gassen von Tyros ritt, an Wechselstuben und der Kathedrale vorbei; dort saßen Mönche, die man kannte, weil sie sich seit einem halben Jahr in der Stadt aufhielten. Als der König sie passierte, stürzten sie sich auf ihn und erstachen ihn. Unter den Kutten verbargen sich Fedajin, bestens ausgebildete Glaubenskämpfer der schiitischen Gruppierung der Nizariten. Diese war Ende des elften Jahrhunderts in Persien entstanden und bekämpfte mit gezieltem Terror vornehmlich die Sunniten unter den Muslimen. Ihre Gegner nannten sie "Haschischraucher" - eine Diffamierung, aus der sich unter Christen die Bezeichnung Assassinen ableitete.
Nachdem sie zuerst in den Bergen Irans verstreute Festungen und Herrschaftszentren errichtet hatten, stützten sie sich nun auch zwischen Antiochia und Tripolis auf ein unabhängiges Fürstentum. Weshalb ihr Führer Raschid ad-Din Sinan, "der Alte vom Berge", die Attacke auf Konrad von Montferrat befohlen hat, ist unklar, aber für ihre Selbstlegitimation, das Ende der Zeit und des Gesetzes zu verkünden, kam es auf politisch rationale Ziele auch gar nicht an.
Die Assassinen gehören zu den erfolgreichsten Geheimorganisationen der Geschichte. Ihre Einsätze lassen an die moderner Spezialeinheiten denken. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari hat der mittelalterlichen Geschichte der "special operations" 2007 die erste umfassende Monographie überhaupt gewidmet, die jetzt auch auf Deutsch vorliegt. Wie Harari zeigt, waren die Assassinen als ständige Institution und in ihrem anarchistischen Zerstörungswillen zwar eine Ausnahme in Mittelalter und Renaissance, doch wurden Spezialkommandos in Westeuropa immer dann eingesetzt, wenn andere Mittel des Krieges versagten.
Wo Festungen und Städte uneinnehmbar waren, halfen List, Verrat und Strickleitern bei dunkler Nacht. Weshalb die Spezialkommandos im Mittelalter trotz dichter Evidenz in der Überlieferung so lange übersehen werden konnten, lag wohl daran, dass man Geheimoperationen, die mit Täuschung und Skrupellosigkeit ihre Ziele erreichten, nicht ausgerechnet im "Zeitalter der Ritter" beginnen lassen wollte. Was will es demgegenüber schon besagen, dass Machiavelli Mord und Entführung als legitime politische Instrumente empfahl und Thomas Morus den Utopiern die Entführung und Tötung feindlicher Akteure zuschrieb.
Unverkennbar haben Harari, der in Haifa geboren wurde und jetzt in Jerusalem lehrt, die Erfahrungen in seinem Heimatland zu diesem Thema geführt; konnten nicht auch alle israelischen Premierminister seit 1996 - Netanjahu, Barak und Scharon -, auf ihrem Nimbus als Angehörige von Spezialkommandos bauen?
Harari analysiert zwar scharfsinnig und klar das Phänomen der Geheimoperationen, aber vor allem widmet er sich diesen mit beachtlicher Erzählkunst. Wer seine seit 2011 erschienenen Bestseller kennt - die "Kurze Geschichte der Menschheit", "Die Geschichte von morgen" und die "21 Lektionen für das 21. Jahrhundert" -, kann in diesem frühen Buch, das aus seiner Oxforder Dissertation hervorgegangen ist, auch die Grundlagen für seine späteren Erfolge erkennen.
Dieser mediävistische Kriegshistoriker wusste selbstverständlich, dass die Quellensplitter allein niemals für eine geschlossene Darstellung ausreichen. Weshalb es nur um phantasiegeleitete Konstruktionen der Zusammenhänge gehen konnte. "Es ist unmöglich", schreibt Harari, "jeden Satz mit einem ,vielleicht' zu beginnen und trotzdem den Leser bei der Stange zu halten." Wer seine Darstellung liest, solle daran denken, "dass sich viele der berichteten Fakten nicht verifizieren oder bezeugen lassen und dass ich ähnlich wie die mittelalterlichen Chronisten oftmals das Gefühl hatte, meine vorrangige Pflicht sei es, eine fesselnde Geschichte zu verfassen, statt nur das aufzuschreiben, was ich sicher weiß".
MICHAEL BORGOLTE
Yuval Noah Harari:
"Fürsten im Fadenkreuz". Geheimoperationen im
Zeitalter der Ritter
1100-1550. Aus dem
Englischen von Andreas
Wirthensohn. Verlag C. H. Beck, München 2020.
347 S., Abb., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.