 Besprechung vom 23.05.2021
Besprechung vom 23.05.2021
Die kurze Illusion
Zeruya Shalev hat zum ersten Mal einen Israel-Roman geschrieben: "Schicksal" geht auch auf das Leben ihres Vaters zurück, der im Untergrund kämpfte.
Zeruya Shalev sitzt an ihrem Schreibtisch zu Hause in Haifa und schaut in die Kamera. Neben ihr liegt ein ganzer Stapel mit Notizheften, sie hält sie hoch, um sie zu zeigen, öffnet sie, um die Notizen sichtbar werden zu lassen, die sie alle während der Arbeit an ihrem neuen Roman gemacht hat: "Schicksal". Zwölf bis vierzehn Stunden habe sie oft am Stück geschrieben, nicht selten nachts, um dieses Buch fertigzukriegen, das ihr sehr viel abverlangt habe. Zum Schluss habe sie eine panische Angst ergriffen, sie könnte möglicherweise an Corona sterben, bevor das Buch fertig sei. "Aber ich lebe noch", sagt sie und lacht erschöpft, auch wenn "in mir alles brennt und weint" angesichts dessen, was, während wir sprechen, draußen auf den Straßen von Haifa Realität ist. Wo, seitdem alle geimpft waren, "noch vor zwei Wochen alle draußen in den Cafés und Restaurants saßen, jüdische und arabische Familien zusammen und durcheinander".
Es gibt in "Schicksal" eine Szene, in der Shalevs Hauptfigur Atara auf ihr Handy schaut und beunruhigt die Nachrichten durchscrollt. "In letzter Zeit hat sie das Gefühl, sie habe den Staat schon aufgegeben und führe nur noch ihr Haifaer Stadtleben, das Leben der einzigen Stadt in Israel, die versucht, die Vision eines Zusammenlebens zu verwirklichen, eine beinah romantische Fantasie, die sie verzaubert hatte, als sie von Jerusalem hierhergezogen war, und die in ihr noch immer ab und zu Hoffnung weckt. Doch die Nachrichten, die sie jetzt liest, bieten nicht viel Hoffnung", heißt es da. Denn der Roman erzählt nicht nur von fataler Verstrickung und von Komplexität; davon, wie alles mit allem zusammenhängt, sondern auch die Geschichte einer Desillusionierung, die mit dem Land Israel verbunden ist. Das macht das Buch hochaktuell - zugleich aber auch anders als die bisherigen Romane von Zeruya Shalev.
"Schicksal" nämlich ist Shalevs erster Israel-Roman, was nicht heißt, dass die anderen es nicht waren. "Liebesleben", "Mann und Frau" oder "Späte Familie" jedoch erzählten universelle Geschichten und von Israel eher indirekt, von den Konflikten des Landes in Andeutungen und Metaphern. Sie handelten vorrangig von den Obsessionen der Figuren, was immer mit einer Obsession der Form einherging. Shalevs lange Kaskadensätze füllten oft weit mehr als eine Seite und führten in radikaler Subjektivität Geschehen, Erinnerungen, Dialoge und Phantasmen in einem Tableau empfundener Gleichzeitigkeit zusammen. Jetzt sind die Sätze der Syntaxkünstlerin plötzlich nicht mehr so lang, ganz so, als gäbe es nicht mal mehr die Chance, sich in etwas zu verlieren.
Und es kommt ausdrücklich die Geschichte des Landes ins Spiel, genauer: die "Kämpfer für die Freiheit Israels", die "Lechi", eine zionistische militärische Untergrundorganisation in Palästina während des britischen Mandats, deren terroristische Anschläge sich gegen die britische Mandatsherrschaft über Palästina richteten und die auch nach Beginn des 2. Weltkriegs nicht bereit war, diesen Kampf einzustellen, um vereint gegen Deutschland zu kämpfen. Nach 1945 verübten sie Anschläge auf britische Militär- und Polizei-Einrichtungen. Auf ihr Konto ging auch der Mord an dem UN-Vermittler Graf Folke Bernadotte im September 1948. Nach der Staatsgründung 1948 wurde die Lechi verboten.
Wenn die Architektin Atara nach dem Tod ihres schwierigen, tyrannischen alten Vaters zu Beginn des Romans in ihrem Auto vor der Haustür von Rachel sitzt, der ersten Liebe des Vaters, die dieser nie erwähnt hatte - dann hofft sie, von der inzwischen über neunzigjährigen Frau etwas über die Lechi zu erfahren. Über die gemeinsame Vergangenheit von Rachel und ihrem Vater im Untergrund. Da er bis zu seinem Tod über diese Zeit nie gesprochen hat, ist Rachel ihre einzige Chance, zu begreifen, was ihn damals zerstört und gebrochen, was ihn für immer desillusioniert hat.
"Nachdem meine beiden Eltern gestorben waren und es keine Möglichkeit mehr gab, ihnen Fragen zu stellen", erzählt Zeruya Shalev in unserem Gespräch, "an diesem Wendepunkt im Leben, wenn du keine Eltern mehr hast, habe ich festgestellt, was ich alles nicht wusste oder auch nicht hatte wissen wollen. Denn mein Vater ist Mitglied der Lechi gewesen, zwar nur weniger als ein Jahr, er hat auch keine Anschläge verübt, er schrieb die Plakate. Es war für ihn aber das sicher aufregendste Jahr seines Lebens, und anders als der Vater von Atara im Buch erzählte er endlos davon. Er war so besessen von seiner Lechi-Zeit, dass er alles damit in Verbindung brachte und immer nach Gelegenheiten suchte, mit seinen Lechi-Erinnerungen kommen zu können. Meine Mutter und mich hat das sehr ermüdet, wir haben schon immer mit den Augen gerollt! Und es war auch Teil meiner Rebellion gegen ihn, mich nicht interessiert zu zeigen. Vor sechs Jahren, als ich mit dem Roman begann, überfiel mich, nach so vielen Jahren der Gleichgültigkeit, eine große Neugierde. Und ich war unglaublich wütend auf mich, ihm nicht zugehört zu haben. Ich konnte mich an nichts erinnern, was er erzählte hatte."
Shalev schaute sich Interviews mit den ehemaligen Mitgliedern der Lechi auf Youtube an, las alles, was sie finden konnte - und lässt nun Rachel erzählen, wie es gewesen ist. Was für unterschiedliche Leute sich hier zusammenfanden, Rechte wie Linke, Religiöse und Atheisten, allesamt ähnlich radikale und emotionale Charaktere, von denen ein Großteil durchaus mit den in Palästina lebenden Arabern kooperieren und eine gemeinsame Front gegen den britischen Kolonialismus aufbauen wollte. "Die arabischen Bewohner des Landes sind nicht unsere Feinde", sagt Ataras Vater im Buch zu Rachel und hebt auch die kleinsten Ansätze für ein jüdisch-arabisches Miteinander hervor. "Wir alle, die in diesem Lande leben, haben gemeinsame Interessen, ganz gleich, welcher Religion, Rasse oder welchem Volk wir angehören."
Dann aber folgt der Schock: Die Ermordung einer jungen Frau, Atara Schamir (der Vater wird seine Tochter nach ihr benennen, ohne es ihr je zu offenbaren), ausgerechnet durch Araber im Winter 1948, als arabische Banden mit Anschlägen auf den jüdischen öffentlichen Verkehr beginnen und unterschiedslos Alte, Frauen und Kinder ermorden. Für Rachel und ihre Liebe im Untergrund kündet sich hier an, was in den kommenden Monaten mit dem jungen Staat passieren sollte, mit der zerbröckelnden Bewegung und mit ihrer Liebe, die keine Fortsetzung und keine Nachkommen haben und von der nichts übrig bleiben würde.
"Ihr seid doch auch Terroristen gewesen! Wo liegt der Unterschied zwischen den ,Kämpfern für die Freiheit Israels' und den ,Kämpfern für die Freiheit Palästinas'?", hält Rachels erster Sohn ihr später vor. Sie verkneift sich, ihm zu entgegnen, dass die Lechi mit ihren Anschlägen immerhin keine Unschuldigen hatten treffen wollen. "Wie habt ihr glauben können, dass, nachdem die Briten abgezogen sind, Ruhe einkehren wird? Wie konntet ihr so blind sein?" Sie gibt ihm recht. Auch darin, dass ihr großer Kampf vergeblich war. Aber, so Rachel, glaubten nicht auch der Sohn und seine Freunde heute noch an ein Zusammenleben und gute Nachbarschaft mit den Arabern?
Zeruya Shalev lässt Atara die Spuren der Vergangenheit so entschlossen verfolgen, dass die dabei aus dem Auge verliert, was in der Gegenwart geschieht. Atara versäumt es, in ihrer unmittelbaren Umgebung Zeichen und Signale zu deuten. Und genau das führt zur eigentlichen Katastrophe des Romans, die sich nicht in der Vergangenheit, sondern im Jetzt abspielt. Eine grausame Verkettung von Umständen, die nicht nur ein Leben verändern. "Schicksal" nennt Shalev deshalb ihr Buch. Sie hätte ihren großen Roman, wenn der Titel nicht schon vergeben wäre, genauso gut "Verlorene Illusionen" nennen können.
Blickt Zeruya Shalev so illusionslos auf ihr Land wie Rachel? "Wir befinden uns in Israel in einer großen politischen Krise", sagt sie. "Was wir als israelische Bürger tun können, liegt vor allem im Privaten. Ich hoffe, dass die Krise zumindest die gemäßigten Araber und Juden in Israel näher zusammenbringt als vorher, etwa in Haifa, und vielleicht könnte Haifa dann ein Beispiel für andere Städte sein." In den vergangenen zwei Jahren habe die Politik Netanjahus das Land immer weiter gespalten, und sie hatte sich auf einen Regierungswechsel gefreut, für den die Chancen jetzt aber schlechter stehen denn je. Die Extreme innerhalb Israels seien das eine, "die Hamas aber ist eine Terrororganisation, die Israel zerstören will. Und diese Terrororganisation hat die Macht über Gaza übernommen, und sie schützen ihre eigenen Leute nicht, sie benutzen sie, die meisten von ihnen sind unschuldig und haben mein Mitgefühl".
Für Zeruya Shalev sind die militärischen Abwehrmaßnahmen Israels nicht mit den Angriffen der Hamas zu vergleichen, die Raketen abfeuert, um so viele Menschen wie möglich zu verletzen. "Ich glaube weiter, dass wir mit jedem verhandeln sollten und mit jedem reden, der verhandeln und reden will. Aber wie soll das mit einer Terrororganisation gehen?" JULIA ENCKE
Zeruya Shalev: "Schicksal". Roman. Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer. Berlin Verlag, 416 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.












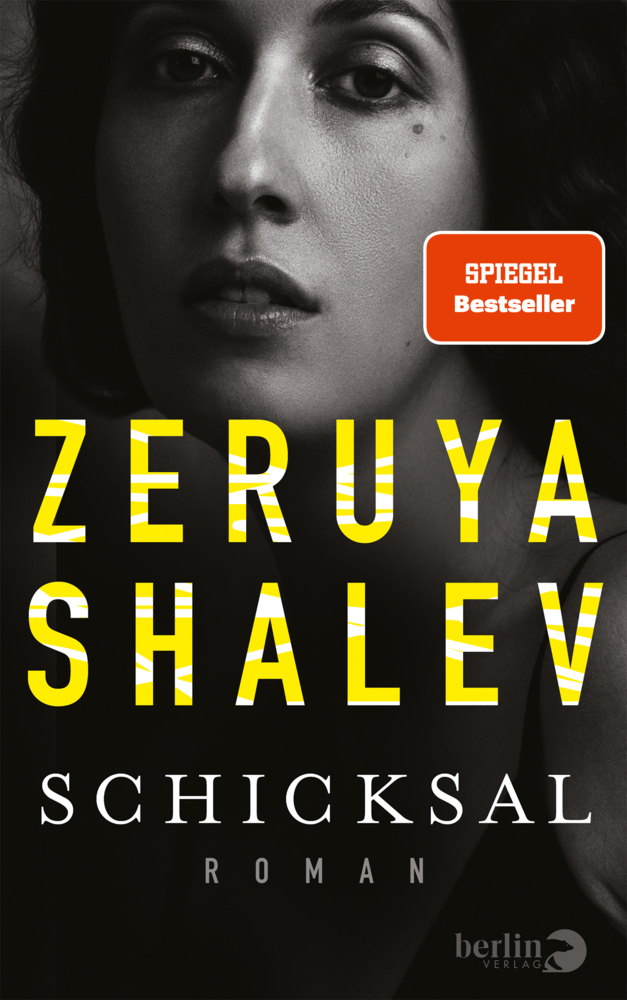

 Besprechung vom 23.05.2021
Besprechung vom 23.05.2021