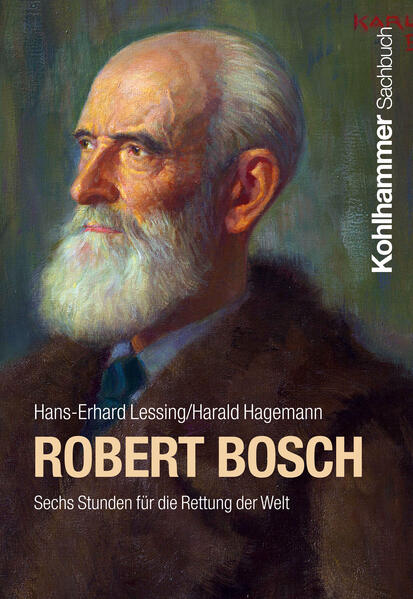Besprechung vom 18.11.2024
Besprechung vom 18.11.2024
Ein Pionier der Industrie
Robert Bosch als Ingenieur, Erfinder und Reformer
Der Schwabe Robert Bosch (1861-1942) gilt als große Gründerfigur der deutschen Industriegeschichte. Sein weltweites Imperium besteht noch heute und beschäftigt in 60 Ländern 420.000 Mitarbeiter. Der versierte Techniker setzte früh auf die Zukunft des Autos. Die Erfindung der schnellen Magnetzündung katapultierte seine Firma in die Höhe. In der Einführung des Achtstundentags und einer Betriebsrente für seine Beschäftigten war er Vorreiter.
Zu seinen Ideen und Maßnahmen hat Bosch nicht nur selbst immer wieder geschrieben. Auch viele Biographen äußerten sich dazu. Schon früh der damalige Berliner Kulturjournalist Theodor Heuss, den Bosch noch mitten im Zweiten Weltkrieg selbst beauftragt hatte. Das Heuss-Buch erschien erst 1946 und stellte vor allem auf das liberale Gedankengut des Unternehmers ab. Sieben Jahrzehnte später schilderte Peter Theiner 2017 in seiner Biographie Bosch eindrucksvoll als Opfer politischer Extreme im 20. Jahrhundert. In der neuesten Lebensbeschreibung stellt der Physiker und Technikhistoriker Hans-Erhard Lessing den Ingenieur, Erfinder und Neuerer Bosch in den Vordergrund. Die Genese der Motor-Magnetzündung und ihrer erfolgreichen wirtschaftlichen Umsetzung verquickt er dabei mit den wichtigsten Stationen von Boschs Unternehmensgeschichte, aber auch mit einer Chronologie des Privatlebens, zu dem fünf Kinder, zwei Ehen sowie die Begeisterung für die Jagd, Reformkleidung, Homöopathie und ein Musterlandgut, außerdem bereits 1914 20 Millionen Mark Vermögen und 4 Millionen Mark Jahreseinkommen gehörten. Lessings schwieriger Spagat zwischen Fachbuch und Homestory gelingt in gut lesbaren Kurzkapiteln, aufgelockert durch Bosch-Zitate, alte Fotos, Tabellen und Konstruktionszeichnungen.
Hans-Eberhard Lessings eben erschienene Bosch-Biographie mit einem Cover-Bild des 76 Jahre alten, etwas schütteren, weißbärtigen Unternehmers basiert auf der zweiten Auflage der erstmals 2007 edierten rororo Monographie des Autors, die Robert Bosch als dynamischen Mittfünfziger im "Jäger'schen Reform-Wollanzug" auf dem Umschlag zeigte. Der ursprüngliche Text wurde um gut 70 Seiten erweitert und durch neue Quellen sowie unveröffentlichte Tagebücher, Briefe und Bilder ergänzt. Auf den letzten 18 Seiten kommt für die heutige Diskussion bedeutsam ein Kapitel über Boschs Manifest "Die Verhütung künftiger Krisen in der Weltwirtschaft" hinzu. Es erklärt den Untertitel von Lessings Buch: "Sechs Stunden für die Rettung der Welt". Bosch hatte nämlich in dieser Denkschrift für das Magazin "Paneuropa" im März 1932 ausführlich seine Idee formuliert, die damals verheerende Arbeitslosigkeit durch Arbeitszeitverkürzung auf sechs Stunden täglich zu bekämpfen. Zugleich rief er zu Freihandel und Völkerverständigung auf. Bosch hielt das Manifest für seine bedeutungsvollste Arbeit. Lessing hat den bislang wenig beachteten Text vom Wirtschaftswissenschaftler Harald Hagemann, wie er selbst emeritierter Hochschullehrer, analysieren lassen.
Der Ko-Autor vergleicht Boschs Ausführungen mit denen von John Maynard Keynes in dessen 1930 veröffentlichtem Essay zu künftigen ökonomischen Möglichkeiten bei starkem Beschäftigungsrückgang ("Economic Possibilities for our Grandchildren") und stellt Gemeinsamkeiten in der sozialliberalen Grundhaltung fest. Keynes sah offenbar wie Bosch die Gefahr technologischer Arbeitslosigkeit, aber genauso weiterhin eine Erhöhung des Lebensstandards durch den industriellen Fortschritt. Im Unterschied zu Keynes durchziehe Boschs eigene Schrift jedoch "durchgehend der Glaube an die menschheitsbeglückenden Wirkungen des technischen Fortschritts, dessen Nutzen unentwegt betont wird", moniert Hagemann dennoch. Die Schwäche seiner Argumentation besteht seiner Meinung nach in der Vernachlässigung makroökonomischer Zusammenhänge wie der Geld- und Finanzpolitik, ebenso der Folgen von Deflation. Hagemann wundert das nicht: Boschs Vorstellungen seien "wesentlich geprägt durch die Erfahrungen, die er auf der Mikroebene des eigenen Betriebs gemacht hatte".
Viel Stärke und Weitsicht rechnet Hagemann andererseits Boschs engagiertem Plädoyer für einen freien Welthandel zur Überwindung der Weltwirtschaftskrise im Manifest von 1932 an. Zu Recht weise der Unternehmer darauf hin, dass Autarkie oder hohe Schutzzölle ein großes Hemmnis für die Weltwirtschaft darstellen und negative Wirkungen auf die Wohlfahrt haben. Bosch habe frühzeitig erkannt, dass die Überwindung des damals weitverbreiteten Elends in Europa nicht in einer Verschärfung der Gegensätze zwischen den Nationalstaaten, sondern nur in einer verstärkten wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zusammenarbeit liegen könne. Hagemanns Resümee: "Mit Fug und Recht kann festgestellt werden, dass Robert Bosch ein Vordenker der Europäischen Union war, wie sie sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg realisieren sollte."
Mit dem Bezug zur EU kommt die Lebensgeschichte von Bosch in der Gegenwart an. Ob allerdings schon eine frühe EU-Vision die jetzige Bosch-Biographie zum Bestseller macht, sei dahingestellt. Das Heuss-Buch "Leben und Leistung" verkaufte sich einst laut Lessing so gut, "weil es in Schwaben lange Zeit als das Konfirmationsgeschenk schlechthin galt, auf dass der Konfirmand einmal so erfolgreich werde wie Bosch". ULLA FÖLSING
Hans-Erhard Lessing und Harald Hagemann: Robert Bosch. Sechs Stunden für die Rettung der Welt, Kohlhammer Sachbuch, Stuttgart 2024, 234 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.