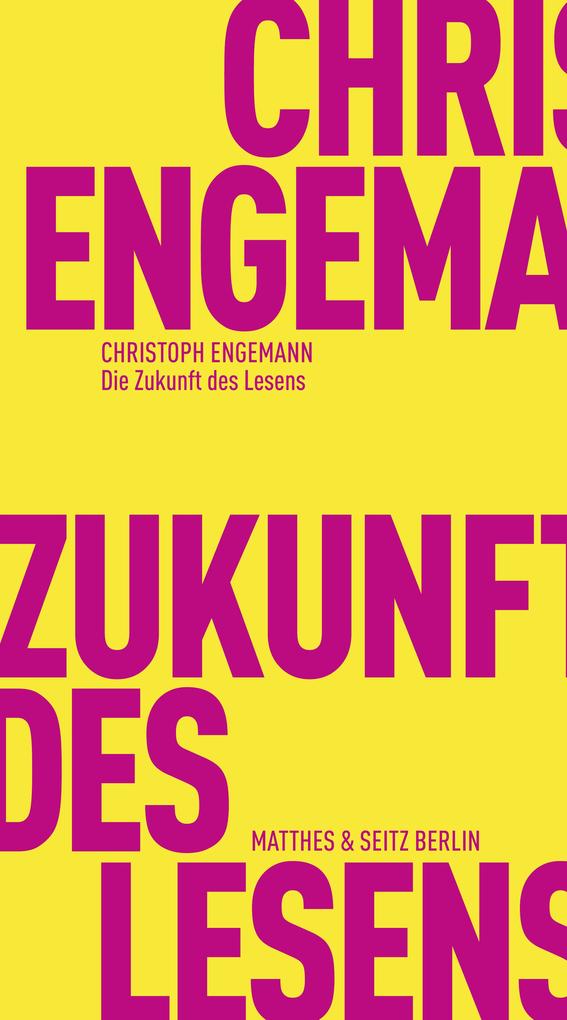Besprechung vom 29.10.2025
Besprechung vom 29.10.2025
Verlernen wir das Lesen?
KI-Tools zerlegen Bücher in Häppchen, Videoclips dominieren das Internet: Der Medienwissenschaftler Christoph Engemann prognostiziert, dass "Plattform-Oralität" die alte Schriftkultur ersetzen wird.
Über die "Zukunft des Lesens" hat sich der Medienwissenschaftler Christoph Engemann Gedanken gemacht. Noch ganz klassisch, nämlich auf 158 Papierseiten. Die Lektüre eröffnet einen kritischen, aber zugleich zukunftsgewandten Blick auf eine Kulturtechnik im Wandel. Als Hörbuch ist der Essay nicht erhältlich. Schade eigentlich. Denn so lässt sich eine zentrale These des Autors im Selbstversuch gar nicht prüfen: dass es nämlich einer neuen Oralität gelingen könne, die herkömmliche Schriftlichkeit zu verdrängen.
Denn um das klassische analoge Papierlesen eines Ganztextes, so die im Buch vertretene These des Autors, müsse man sich Sorgen machen. Nicht nur der konkurrierenden Audio-Books und Podcasts wegen. Sondern auch wegen der niedrigschwelligen KI-Angebote, die für kleines Geld große Sprachmodelle auf alle Arten von Texten loslassen. Lesen lassen statt selber lesen - so lautet dann die Devise. Mit den richtigen Prompts werden Bücher aller Art kurz und klein gehauen.
Schreiben lassen statt selber schreiben ist die daran anschließende Versuchung. Wer in Schulen und Hochschulen noch schriftliche Hausarbeiten erteilt, kennt die erstaunlichen Produkte der digitalen Lese- und Schreibhilfen zur Genüge. Wo sich das KI-gestützte Schreiben mit inhaltlichem Vorwissen paart, lassen sich die algorithmisch generierten Texte leicht um ein paar halluzinierende Satzhülsen bereinigen. Auch wenn es viele noch nicht wahrhaben wollen: Bildung und Wissen, einschließlich der Verfahren ihrer Überprüfung, sind infolgedessen völlig neu zu verhandeln.
Auf diese Weise verändert sich auch das Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit grundlegend: "Die Ökonomie des Internets ist eine Ökonomie des Wortes", so Engemann. Längst haben sich soziale Medien, Videoclips und Podcasts als legitime Formate der Wissensvermittlung jenseits des klassischen Lesetextes etabliert. Mit der maschinellen Sprachverarbeitung verschwimmen die Grenzen zwischen Schrift und Rede; auch Gesprochenes wird jetzt adressierbar, verlinkbar, durchsuchbar. "Die Möglichkeit der synchronen und asynchronen Vernetzung mündlicher Rede bei gleichzeitiger orts- und zeitunabhängiger Wiederauffindbarkeit" ist das eigentlich Neue der als "Plattform-Oralität" bezeichneten mündlichen Schriftlichkeit der Youtuber und Tiktoker. Der Autor beschreibt eindrucksvoll, wie das "Sprechzeug" der automatischen Spracherkennung die Fundamente des Schreibens und Lesens unterspült hat.
Ob sich das Delegieren des Lesens langfristig als eine lohnende Abkürzung zur Texterschließung erweisen wird, mag man bezweifeln. Engemann befürchtet, dass es zwangsläufig zu einem Machtgefälle zwischen den Selbstlesern und den nur noch aus zweiter Hand Lesenden kommen wird. So gerate die Fähigkeit zum Selbstlesen früher oder später zum neuen Latein der wenigen, während die breite Masse häppchenweise und gefiltert ihre Kenntnisse von Chatbots und aus Podcasts bekäme. Dass mit dieser "Klerikalisierung des Lesens" Gefährdungen für die Selbstbestimmung einhergehen, liegt auf der Hand. Aus pädagogischer Sicht sitzt ohnehin einem didaktischen Kurzschluss auf, wer meint, sich oder anderen die Zeit und Mühen zum Selberlesen ersparen zu können. Ohne den Umweg über das Textverstehen geht es nicht von der Information zum Wissen.
Die kognitionspsychologische Leseforschung wird im Buch nicht verhandelt. Dabei wäre es interessant gewesen, Textverstehen, Textgenres, Lesemedien und Leseanlässe zur behaupteten Literalitäts-Oralitäts-Verschiebung in Bezug zu setzen. Auch pädagogische Implikationen werden nur gestreift. Für die Zukunft des Lesens wird es aber entscheidend darauf ankommen, die herkömmlichen Lesekompetenzen um eine mediale Befähigung zu erweitern. Längst reicht es in der digitalen Welt nicht mehr aus, bloß zu verstehen, was geschrieben oder gesagt wird. Man muss auch dessen Faktizität und die Glaubwürdigkeit von Quellen einzuschätzen wissen, statt sich auf generierte Zusammenfassungen oder Clip-Häppchen zu verlassen.
Ironisch wäre es schon, wenn die 5000 Jahre währende Erfolgsgeschichte der Literalität an ihr Ende käme, weil eine neue Oralität die Dominanz des Schriftsprachlichen beim Wissenserwerb infrage stellt. Der Legende nach war die Erfindung der Schrift von bewahrpädagogischen Bedenkenträgern äußerst kritisch begleitet worden. Scheinwissen, Gedächtnis- und Kontrollverluste würden mit dem Niedergang des gesprochenen Wortes Einzug halten - so die altertümlichen Unken. Jetzt also eine Rolle rückwärts zu einer neuen Mündlichkeit, die genau diese alten, auf die Schrift bezogenen Prognosen erfüllt? Engemann verweigert sich dem Krisengeraune und verweist auf die transformatorischen Potentiale, die mit einer Verschiebung vom Schriftlichen ins Mündliche verbunden sind.
Die Verschiebung von der Literalität zur Mündlichkeit beschreibt er nüchtern als kulturellen Wandel, der im Übrigen nur eine bestimmte Art des Lesens betreffe, nämlich das Lesen langer Texte und herkömmlicher Bücher. Geht es um Kurzformate, also etwa um das Lesen von Chats oder um das informatorische und zweckorientierte Onlinelesen, so werde derzeit mehr gelesen als je zuvor. Das "System Buch" sei allerdings in der Klemme. Und damit der Anspruch, dass Wissen besonders gut durch eigenes Lesen erworben werden kann. Gefahr im Verzug sieht der Autor bei aller Technologieoffenheit hingegen an anderer Stelle: wo das Lesen gänzlich an andere delegiert wird, die daraus nach ihren eigenen Regeln und Kriterien schriftliche Kurzfassungen, Podcasts oder Erklärvideos machen. Wo Stimme und Körper von Sprechern wichtiger werden als textuelle Qualitäten und institutionelle Legitimation.
Bislang wurden den bei PISA getesteten 15-Jährigen schematische Darstellungen von Bücherregalen vorgelegt, die wenig, teilweise oder ganz mit Büchern gefüllt waren. Sie sollten anhand dessen eine Einschätzung zum Buchbestand im heimischen Wohnzimmer abgeben. Viele Bücher im Regal indizierten ein günstigeres häusliches Lernumfeld und ein größeres kulturelles Kapital der Familie. In der alten Welt war das positiv mit dem Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen korreliert und also förderungswürdig. Was aber, wenn Bücherregale künftig nur noch als Nippesablagen herhalten müssen? Wer will, kann sich im E-Paper der F.A.Z. diese Rezension über eine Text-to-Speech-Funktion vorlesen lassen. ANDREAS GOLD
Christoph Engemann: "Die Zukunft des Lesens".
Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2025. 158 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.