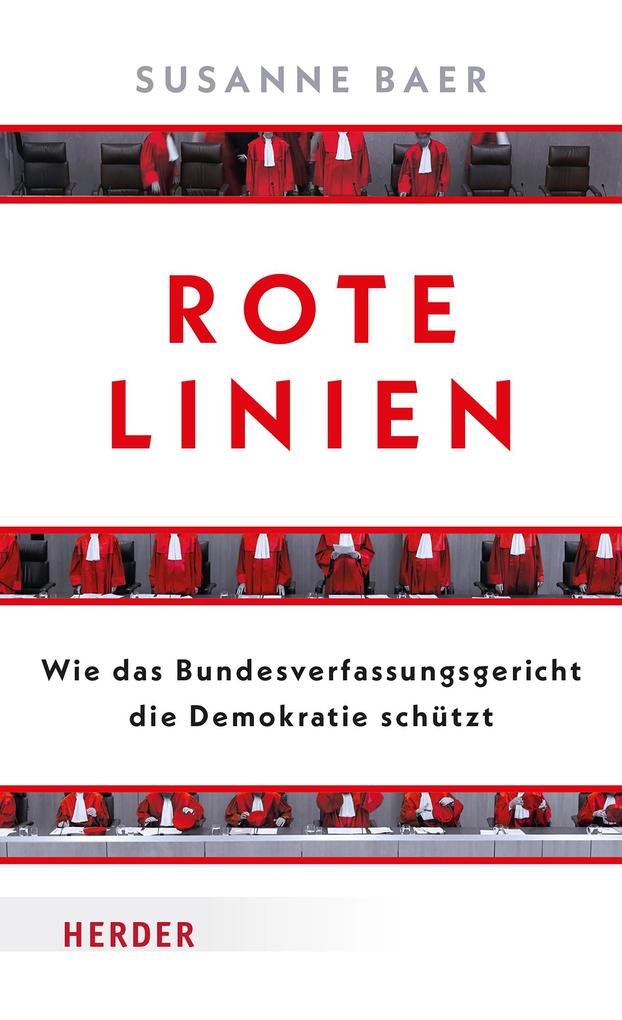Besprechung vom 07.10.2025
Besprechung vom 07.10.2025
Selbst der Aktenwagen wird nicht vergessen
Aufklärung überzeugender Art: Susanne Baer, ehemalige Richterin in Karlsruhe, beschreibt die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts
Wie arbeitet eigentlich das Bundesverfassungsgericht? Zuständigkeiten und Verfahren sind im Grundgesetz und im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Zu Einzelfragen gibt es konkretisierende Rechtsprechung und Kommentare. All das vermittelt jedoch nur begrenzt Aufschluss darüber, wie das Gericht zu seinen Entscheidungen und Interpretationen der Verfassung kommt, wie es praktisch arbeitet und von welchen Menschen mit welcher Mentalität Verfassungsrechtsprechung gemacht wird. Zehn Jahre nachdem Gertrude Lübbe-Wolff als ehemalige Verfassungsrichterin eine konzise Funktionsbeschreibung vorgelegt hat ("Wie funktioniert das Bundesverfassungsgericht?", 2015), ist nun ein Innenbericht aus dem Maschinenraum des Gerichts von Susanne Baer erschienen. Baer war zwölf Jahre Richterin des vor allem für Grundrechte zuständigen Ersten Senats und hier verdienstvolle Berichterstatterin unter anderem für die Wissenschaftsfreiheit.
Es handelt sich um einen Rückblick, der nicht nur die Arbeitsweise des Gerichts in liebevoller Detailliertheit schildert, sondern immer wieder auf sehr persönliche Erfahrungen zurückgreift. Eine Institution wird durch die Brille der vormaligen Richterin erklärt, die bewusst in der ersten Person beschreibt, wie sie ihr Amt, ihre Rolle und ihre Arbeit wahrgenommen hat. Das Buch ist keine wissenschaftliche Abhandlung, auch wenn es durch die Brille einer Staatsrechtslehrerin an der Humboldt-Universität zu Berlin geschrieben ist. Es kombiniert akademische Versachlichung und Analyse mit explizit subjektiven Bewertungen, die durch ihre Geradlinigkeit, erfrischende Ehrlichkeit und Offenheit einnehmen. Wo Fragen von Funktion und Legitimation des Bundesverfassungsgerichts erläutert werden, bewegt sich Baer changierend zwischen fachlicher Institutionenanalyse und Volksbildung.
Mit acht Richterinnen und Richtern pro Senat ist das Bundesverfassungsgericht vor allem Kollegialgericht. Seine Richterinnen und Richter sind Menschen, und die durch fallbezogene Anträge veranlasste Deutung der Verfassung ist keine Zauberei, sondern hochprofessionelles Handwerk. Die Entscheidungs- und Interpretationsmacht erfordert eine pluralistische Grundierung der Entscheidungsfindung, weshalb es auf die Vielfalt der Perspektiven ankommt. Ein Senat ist epistemisch stets mehr als die Summe seiner Teile. Geschildert werden sachbezogene, heitere und oft auch nachdenkliche Facetten der Arbeit am Gericht, von der positiven Arbeitsatmosphäre über den Umgang mit möglicher Befangenheit bis zum Aktenwagen, dem "Hund". In Farbtiefe und Detailreichtum ist das Buch einzigartig und auch für ein Fachpublikum wertvoll.
Baer beschreibt die Funktionen als Schutz der Demokratie. Nicht immer ist klar, wie voraussetzungsvoll ein impliziter - offensichtlich materieller - Demokratiebegriff hierfür eigentlich sein muss. Denn oftmals geht es gerade darum, den Rechtsstaat und die individuelle Freiheit vor dem Zugriff demokratischer Mehrheiten zu schützen. Auch diese Begrenzungen sind freilich auf einen demokratischen Willen zurückzuführen, wie Baer verdeutlicht. Demokratie als Verfahren braucht Regeln, und diese brauchen Interpretation. Richterin am Bundesverfassungsgericht ist auch ein Amt, das persönliche Opfer abverlangt. Anfeindungen und Vorurteile muss man aushalten können, was leichter gesagt als getan ist.
Dieses Fenster in das Menschliche hinter der Ikonographie der roten Roben ist mehr als eine einfühlsame Anekdotensammlung. Es veranschaulicht, was im Bundesverfassungsgericht steckt und wie Menschen mit den Herausforderungen eines Knochenjobs umgehen. Viele gängige Klischees über das Gericht, die sich beharrlich halten, werden charmant und mit viel Geduld gerade gegenüber einem nicht fachkundigen Publikum abgeräumt. Dies erinnert - im positiven Sinne - ein wenig an die "Sendung mit der Maus", in die es - wie man aus den Hinweisen am Ende erfährt - auch das Bundesverfassungsgericht als "Sachgeschichte" geschafft hat. Klingt komisch, ist aber so.
Ein wenig Grundverständnis für die Institution dürfen die Bürgerinnen und Bürger nicht zuletzt von denen erwarten, die demokratisch über die Besetzung des Gerichts entscheiden. Selbstverständlich ist das leider nicht. Gerade dem gerne bedienten Vorurteil einer Regentschaft der Rechtshaber aus Karlsruhe wird engagiert entgegengetreten. Tatsächlich antwortet das Gericht auf Fragen, die andere an es herantragen. Gerade manche, die das Gericht besonders polemisch attackieren, rufen es besonders häufig sowie immer wieder durchaus erfolgreich an, beklagen aber gleichwohl angebliche Einseitigkeit. Was wie ein performativer Widerspruch wirkt, ist letztlich Wählertäuschung: Gerichtsbashing kommt in bestimmten Milieus an, in denen man sich weder für schwierige Rechtsprechungsarbeit noch für die Überzeugungskraft von Argumenten sonderlich interessiert.
Was wir aus unserer Verfassung machen, hängt von den Menschen ab, die sie interpretieren. Das ist nicht nur Methodenfrage, sondern auch praktische Gerichtssoziologie. Das Gericht macht es sich nicht leicht. Gerade hinter Entscheidungen, die in der Öffentlichkeit kontrovers aufgenommen wurden, stehen sehr gründlich reflektierte Erwägungen. Baer illustriert dies an exemplarischen Entscheidungsthemen, etwa Klimaschutz, Pandemiemaßnahmen oder Kontroversen um Menschenwürde und Gleichheit.
Man muss natürlich nicht jede Rechtsprechungslinie überzeugend finden. Anerkennung verdient aber, wie gewissenhaft sich das Gericht seiner Aufgabe stellt, Verfassungsrecht zu sprechen. Unzufriedene Verlierer gibt es immer. Dass man sich gleichwohl immer ernst genommen fühlt, liegt an einer richterlichen Haltung, die Baer hier mit glaubwürdiger Leidenschaft vermittelt. Wer wissen will, warum die Wahl der Richterinnen und Richter für die Demokratie von kardinaler Bedeutung ist und auf welchen Esprit es letztlich ankommt, sollte das Buch lesen. KLAUS FERDINAND GÄRDITZ
Susanne Baer: "Rote Linien". Wie das Bundesverfassungsgericht die Demokratie schützt.
Herder Verlag, Freiburg 2025. 384 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.