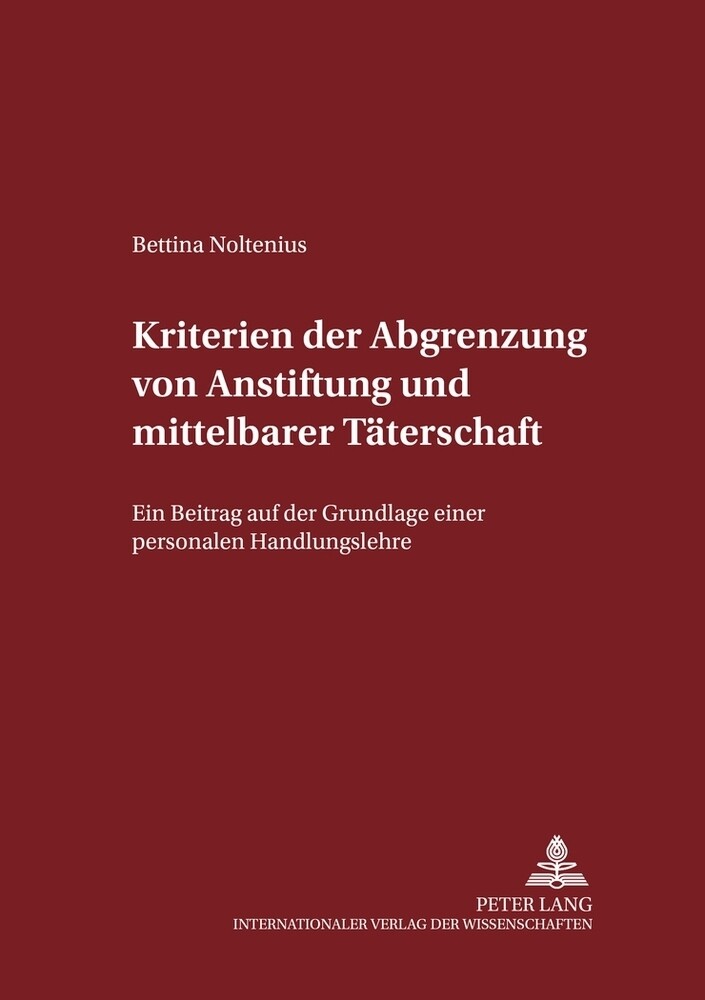
Zustellung: Do, 17.07. - Sa, 19.07.
Versand in 4 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Bei jeder Art der Beteiligung geht es um Formen der Zurechnung bzw. Mitzurechnung von Handlungen anderer. Grundlage für das Strafrecht und damit auch für die Abgrenzungskriterien von Anstiftung und mittelbarer Täterschaft ist die Person in ihrer Selbstverantwortlichkeit. Wie kann es dann eine mittelbare Täterschaft überhaupt geben, bei der jemand "durch einen anderen" handelt und wie lässt es sich begründen, dass der Anstifter "gleich einem Täter" bestraft wird, obwohl die Hauptverantwortung doch der Angestiftete trägt? Einmal anerkannt, dass es mittelbare Täterschaft und Anstiftung als unterschiedliche Beteiligungsformen "gibt" - wie grenzt man sie voneinander ab? Die Arbeit behandelt diese Fragen und überprüft die scheinbar unumstößlichen Auffassungen von Rechtsprechung und Literatur auf der Basis einer Rechtsphilosophie der Freiheit.
Inhaltsverzeichnis
Aus dem Inhalt: Kritische Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Diskussionsstand - Möglichkeit der Zurechnung von Handlungen anderer auf der Basis der Philosophie Kants und Fichtes - Strafrechtliche Begriffsbestimmungen auf der Grundlage einer personalen Handlungslehre - Kriterien für die Unterscheidung des Unrechtstatbestandes von Anstiftung und mittelbarer Täterschaft.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. November 2003
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
338
Reihe
Schriften zum Strafrecht und Strafprozeßrecht
Autor/Autorin
Bettina Noltenius
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
450 g
Größe (L/B/H)
18/148/210 mm
ISBN
9783631515204
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Kriterien der Abgrenzung von Anstiftung und mittelbarer Täterschaft" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









