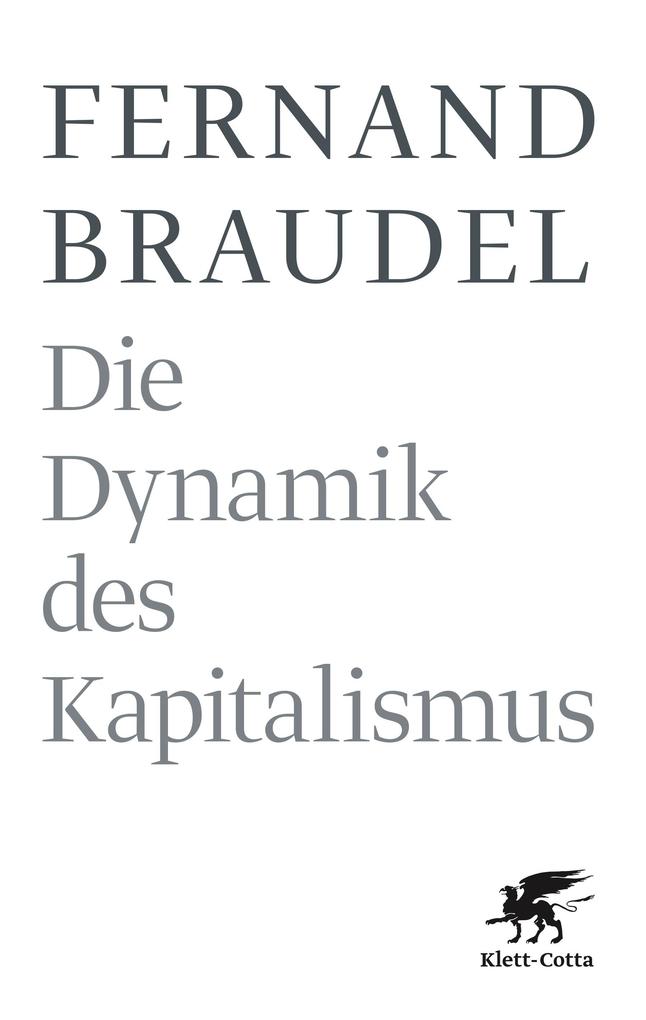
Zustellung: Di, 08.07. - Do, 10.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Dieses Buch enthält den Text dreier Vorlesungen, die Fernand Braudel im April 1976 an der Johns Hopkins University in Baltimore gehalten hat.
Über den unmittelbaren Anlass hinaus stellen sie eine leicht zu lesende exemplarische Einführung in den Braudelschen Ansatz der Geschichtsschreibung dar.
Braudel präsentiert und resümiert in diesen drei Vorlesungen seine jahrzehntelangen Forschungen zur Geschichte der materiellen Zivilisation und des Kapitalismus: Ausgehend von den alltäglichen Lebensbedingungen der Menschen ihrer biologischen Vermehrung, ihren Essgewohnheiten, Arbeitsbedingungen, Wohnverhältnissen usw. wird die weltweite Entwicklung marktwirtschaftlicher Strukturen zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert betrachtet, die in einem "ungleichzeitigen", keineswegs linearen Prozess zur Durchsetzung und Hegemonie der kapitalistischen "Weltwirtschaft" führte.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
23. Mai 2011
Sprache
deutsch
Auflage
7. Druckaufl. 2018
Seitenanzahl
106
Autor/Autorin
Fernand Braudel
Übersetzung
Peter Schöttler
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
125 g
Größe (L/B/H)
206/126/9 mm
Sonstiges
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur
ISBN
9783608946512
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Normal
0
21
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normale Tabelle";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";}
Normal
0
21
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normale Tabelle";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";}
Ȇberallhin gehen, sehen und berichten
Sie sind lustvolle Erzähler,
wildern in Nachbardisziplinen und bleiben doch strenge Analytiker: Die
französischen »Annalisten«, die bereits 1929 dem deutschen Historismus eine
Absage erteilten, werden nun endlich auch in der Bundesrepublik gelesen.
Ein Musterbeispiel für ihre Art der Geschichtsschreibung ist die dreibändige
Sozialgeschichte von Fernand Braudel.
Den Enkeln und Urenkeln Leopold von Rankes, der gemeinhin als Vater der
wissenschaftlichen Geschichtsschreibung gilt, waren sie stets verdächtig: jene
Querdenker und Avantgardisten aus Frankreich, die seit 1929 mit der Gründung
der Zeitschrift »Annales« den
Traditionen des deutschen Historismus eine radikale Absage erteilten. Das
Programm, das sie entwickelten, schenkte den großen Männern und den
Ereignissen auf der Bühne der Politik geringere Beachtung als den dahinter
verborgenen, langfristig wirksamen Strukturen. Ihr Interesse richtete sich auf
die Konjunkturen der Wirtschaft, auf Produkte und die Schwankungen der Preise,
auf Techniken, Moden und Mentalitäten, auf Klimazonen und Räume der Natur: Eine
Ausweitung des Blickfeldes, zugleich eine Verschiebung der Akzente, die
hierzulande auf eisige Ablehnung stieß.
Typisch für die Berührungsängste, die eine rationale Auseinandersetzung
zunächst erschwerten, war die Haltung Gerhard Ritters, dem wortgewaltigen
Nestor der bundesdeutschen Zunft nach 1945. Wer die Vergangenheit auf
Gesetzmäßigkeiten abklopfe, so lautete sein Verdikt, wer allein die Analyse,
nicht aber das »Verstehen« im Sinn
habe, der verfehle die alles entscheidende Dimension der menschlichen Freiheit.
Und die Sorge, die Ritter umtrieb, fiel in der Ära des »Kalten Krieges« auf
fruchtbaren Boden: "Die kausalistische Entmenschlichung der Geschichte führt
zum Marxismus."
Derart schweres Geschütz fährt
heute niemand mehr auf. Der Wind hat sich gedreht, die Debatte ist offener
geworden, befreite sich von ideologischen Scheuklappen und provinzieller
Selbstgenügsamkeit, auch von theoretischem Ballast, der das Publikum
eher vergraulte als anzog. Historiker, die sich nicht in den Zitadellen ihres
Faches verschanzen, profitieren von den Fragen der Anthropologen und
Ethnographen. Und wichtiger noch: Sie beginnen wieder zu entdecken, daß ihr
Metier etwas zu tun hat mit Geschichten, deren Reiz sich nur dann entfaltet,
wenn strenge Analyse mit anschaulicher Erzählung verwoben wird.
Historiker sollen sehen und
zeigen, beobachten und klassifizieren, ohne sich im Dickicht allzu vieler
Vorüberlegungen zu verlieren. So jedenfalls hat Fernand Braudel seine
Aufgabe begriffen, bis zu seinem Tod im November 1985 einer der brillantesten
Vertreter der »Annalisten«. Daß er und
seine Kollegen diese Forderung beherzigen, daß sie Geschichte schreiben, die
sich eben sosehr durch analytischen wie durch sinnliche Qualitäten
auszeichnet: dies in erster Linie dürfte es sein, was ihnen derzeit in
Deutschland so enormen Zulauf beschert. Ihre Bücher, in Frankreich häufig schon
Klassiker, werden seit kurzem auch bei uns heimisch, bei Namen Georges Duby,
Jaques le Goff und Emmanuel le Roy Ladurie horcht mittlerweile nicht nur eine
kleine Schar von Eingeweihten auf, und das monumentale dreibändige Werk
Braudels über die Zivilisation der vorindustriellen Welt, das den Bogen vom 15.
bis 18. Jahrhundert spannt und nun geschlossen vorliegt, braucht seine Leser
nicht erst zu erobern: sie sind längst gewonnen.
Braudels Thema ist die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die Dialektik von
Wandel und Beharrung, oder, wie er das selbst in einem seiner Vorträge
formulierte: die »Koexistenz zwischen
der Starrheit, Trägheit und Schwerfälligkeit einer noch elementaren Wirtschaft
und den zwar begrenzten und noch selten auftretenden, aber zugleich machtvollen
Bewegungen eines modernen Wachstums. Da gibt es einerseits die Bauern,
die einem fast völlig autonomen und
autarken Milieu verhaftet sind, und da gibt es andererseits eine Marktwirtschaft
und einen expandierenden Kapitalismus, die sich wie Ölflecken ausbreiten«,
gewissermaßen die Vorboten der Ordnung, die uns gegenwärtig gefangenhält
und unsere Existenz bestimmt.
Braudels Art, sich in die
Vergangenheit zu versenken, so hat ein amerikanischer Beobachter angemerkt, gleicht
der Gargantuas. Er ergötzt sich an den allgemeinsten Umrissen wie an den
intimsten Details. Er hat eine nicht zu stillende Lust, überallhin zu gehen,
alles zu sehen und alles zu berichten.
Das Gebäude, mehr eine
Pyramide, in die der Autor uns einläßt, besteht aus drei Etagen, verbunden
durch breite Treppen oder schmale Stiegen. Im Souterrain herrscht der
Alltag, herrschen die gwöhnlichen Verrichtungen, die sich gegen
Veränderungstendenzen über Jahrhunderte in »majestätischer Unbeweglichkeit« behaupten und uns so fremd erscheinen
wie ein fremder Planet.
Der Alltag: Das sind die
winzigen Fakten, die räumlich und zeitlich
kaum ins Gewicht fallen, und doch den Kern des »materiellen Lebens ausmachen.
Während das Ereignis Einmaligkeit und Individualität beansprucht, ist das
Alltägliche eine endlose Kette von Wiederholungen. Dadurch freilich wird
es zum »Allgemeingültigen, zur »Struktur«,
erfaßt die Gesellschaft, prägt »Lebensformen und Handlungsweisen«.
Alltagsgeschichte wird in dieser Perspektive zur Strukturgeschichte, eine
Perspektive, die den bei uns aufgefochtenen Streit um Nutzen und Zweck
der Alltagshistorie mit einem Schlag aus seinem sterilen Entwederoder erlösen
könnte. Über das materielle Leben wölben sich Marktwirtschaft und Kapitalismus,
zwei Sphären mit verwandten, aber nicht identischen Merkmalen. Marktwirtschaft
ist eng verflochten mit dem Untergrund des Alltäglichen, ist gekennzeichnet
durch einfache Verfahren des Tausches, durch Transparenz und Konkurrenz.
Kapitalismus hingegen, ein Begriff, den Braudel relativ unbefangen benutzt,
beschränkt sich auf die Welt der Handelsherren, der Finanziers und
Fernkaufleute. Er ist komplex, das Element der Dynamik schlechthin und - was
manchen überraschen mag - bereits lange vor der Wende zum 20. Jahrhundert
hochgradig organisiert und monopolisiert.
Er ist es, der das Gefüge des Abendlandes von oben nach unten allmählich
verändert, ältere Hierarchien für seine Ziele einspannt und zermürbt,
traditionelle Abhängigkeiten sprengt, um national wie international neue zu
schaffen. In sämtliche Bezirke des Lebens dringt er allerdings während der
Inkubationszeit zwischen 1400 und 1800 nicht vor. Prozesses des Wandels
mobilisieren hier ungeahnte Wachstumspotentiale und brechen sich dort an
festverriegelten Türen. Die Gesellschaften des »Ancien Régime« bleiben buntscheckig. Fortschritt und Stillstand
liegen dicht beieinander.
Die Zentren der ökonomischen Entwicklung verlagern sich vom Mittelmeer zum
Atlantik, von den Städten Oberitaliens und der Niederland auf die nationalen
Volkswirtschaften, von Venedig, Antwerpen, Genua und Amsterdam auf London und
New York. Die Bewegung hat einen Anfang, aber kein Ende. Der Kapitalismus, so
Braudel, setzt sich trotz aller Rückschläge und Sprünge »ins Unendliche fort«. An diesem Punkt freilich verläßt der Autor das
vertraute Feld gesicherter Beobachtungen und wechselt über auf das
schwankende Terrain der Spekulation: wenn auch viel dafür spricht, daß er recht
behält.«
Jens Flemming (Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 05.10.1986)
0
21
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normale Tabelle";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";}
Normal
0
21
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normale Tabelle";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";}
Ȇberallhin gehen, sehen und berichten
Sie sind lustvolle Erzähler,
wildern in Nachbardisziplinen und bleiben doch strenge Analytiker: Die
französischen »Annalisten«, die bereits 1929 dem deutschen Historismus eine
Absage erteilten, werden nun endlich auch in der Bundesrepublik gelesen.
Ein Musterbeispiel für ihre Art der Geschichtsschreibung ist die dreibändige
Sozialgeschichte von Fernand Braudel.
Den Enkeln und Urenkeln Leopold von Rankes, der gemeinhin als Vater der
wissenschaftlichen Geschichtsschreibung gilt, waren sie stets verdächtig: jene
Querdenker und Avantgardisten aus Frankreich, die seit 1929 mit der Gründung
der Zeitschrift »Annales« den
Traditionen des deutschen Historismus eine radikale Absage erteilten. Das
Programm, das sie entwickelten, schenkte den großen Männern und den
Ereignissen auf der Bühne der Politik geringere Beachtung als den dahinter
verborgenen, langfristig wirksamen Strukturen. Ihr Interesse richtete sich auf
die Konjunkturen der Wirtschaft, auf Produkte und die Schwankungen der Preise,
auf Techniken, Moden und Mentalitäten, auf Klimazonen und Räume der Natur: Eine
Ausweitung des Blickfeldes, zugleich eine Verschiebung der Akzente, die
hierzulande auf eisige Ablehnung stieß.
Typisch für die Berührungsängste, die eine rationale Auseinandersetzung
zunächst erschwerten, war die Haltung Gerhard Ritters, dem wortgewaltigen
Nestor der bundesdeutschen Zunft nach 1945. Wer die Vergangenheit auf
Gesetzmäßigkeiten abklopfe, so lautete sein Verdikt, wer allein die Analyse,
nicht aber das »Verstehen« im Sinn
habe, der verfehle die alles entscheidende Dimension der menschlichen Freiheit.
Und die Sorge, die Ritter umtrieb, fiel in der Ära des »Kalten Krieges« auf
fruchtbaren Boden: "Die kausalistische Entmenschlichung der Geschichte führt
zum Marxismus."
Derart schweres Geschütz fährt
heute niemand mehr auf. Der Wind hat sich gedreht, die Debatte ist offener
geworden, befreite sich von ideologischen Scheuklappen und provinzieller
Selbstgenügsamkeit, auch von theoretischem Ballast, der das Publikum
eher vergraulte als anzog. Historiker, die sich nicht in den Zitadellen ihres
Faches verschanzen, profitieren von den Fragen der Anthropologen und
Ethnographen. Und wichtiger noch: Sie beginnen wieder zu entdecken, daß ihr
Metier etwas zu tun hat mit Geschichten, deren Reiz sich nur dann entfaltet,
wenn strenge Analyse mit anschaulicher Erzählung verwoben wird.
Historiker sollen sehen und
zeigen, beobachten und klassifizieren, ohne sich im Dickicht allzu vieler
Vorüberlegungen zu verlieren. So jedenfalls hat Fernand Braudel seine
Aufgabe begriffen, bis zu seinem Tod im November 1985 einer der brillantesten
Vertreter der »Annalisten«. Daß er und
seine Kollegen diese Forderung beherzigen, daß sie Geschichte schreiben, die
sich eben sosehr durch analytischen wie durch sinnliche Qualitäten
auszeichnet: dies in erster Linie dürfte es sein, was ihnen derzeit in
Deutschland so enormen Zulauf beschert. Ihre Bücher, in Frankreich häufig schon
Klassiker, werden seit kurzem auch bei uns heimisch, bei Namen Georges Duby,
Jaques le Goff und Emmanuel le Roy Ladurie horcht mittlerweile nicht nur eine
kleine Schar von Eingeweihten auf, und das monumentale dreibändige Werk
Braudels über die Zivilisation der vorindustriellen Welt, das den Bogen vom 15.
bis 18. Jahrhundert spannt und nun geschlossen vorliegt, braucht seine Leser
nicht erst zu erobern: sie sind längst gewonnen.
Braudels Thema ist die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die Dialektik von
Wandel und Beharrung, oder, wie er das selbst in einem seiner Vorträge
formulierte: die »Koexistenz zwischen
der Starrheit, Trägheit und Schwerfälligkeit einer noch elementaren Wirtschaft
und den zwar begrenzten und noch selten auftretenden, aber zugleich machtvollen
Bewegungen eines modernen Wachstums. Da gibt es einerseits die Bauern,
die einem fast völlig autonomen und
autarken Milieu verhaftet sind, und da gibt es andererseits eine Marktwirtschaft
und einen expandierenden Kapitalismus, die sich wie Ölflecken ausbreiten«,
gewissermaßen die Vorboten der Ordnung, die uns gegenwärtig gefangenhält
und unsere Existenz bestimmt.
Braudels Art, sich in die
Vergangenheit zu versenken, so hat ein amerikanischer Beobachter angemerkt, gleicht
der Gargantuas. Er ergötzt sich an den allgemeinsten Umrissen wie an den
intimsten Details. Er hat eine nicht zu stillende Lust, überallhin zu gehen,
alles zu sehen und alles zu berichten.
Das Gebäude, mehr eine
Pyramide, in die der Autor uns einläßt, besteht aus drei Etagen, verbunden
durch breite Treppen oder schmale Stiegen. Im Souterrain herrscht der
Alltag, herrschen die gwöhnlichen Verrichtungen, die sich gegen
Veränderungstendenzen über Jahrhunderte in »majestätischer Unbeweglichkeit« behaupten und uns so fremd erscheinen
wie ein fremder Planet.
Der Alltag: Das sind die
winzigen Fakten, die räumlich und zeitlich
kaum ins Gewicht fallen, und doch den Kern des »materiellen Lebens ausmachen.
Während das Ereignis Einmaligkeit und Individualität beansprucht, ist das
Alltägliche eine endlose Kette von Wiederholungen. Dadurch freilich wird
es zum »Allgemeingültigen, zur »Struktur«,
erfaßt die Gesellschaft, prägt »Lebensformen und Handlungsweisen«.
Alltagsgeschichte wird in dieser Perspektive zur Strukturgeschichte, eine
Perspektive, die den bei uns aufgefochtenen Streit um Nutzen und Zweck
der Alltagshistorie mit einem Schlag aus seinem sterilen Entwederoder erlösen
könnte. Über das materielle Leben wölben sich Marktwirtschaft und Kapitalismus,
zwei Sphären mit verwandten, aber nicht identischen Merkmalen. Marktwirtschaft
ist eng verflochten mit dem Untergrund des Alltäglichen, ist gekennzeichnet
durch einfache Verfahren des Tausches, durch Transparenz und Konkurrenz.
Kapitalismus hingegen, ein Begriff, den Braudel relativ unbefangen benutzt,
beschränkt sich auf die Welt der Handelsherren, der Finanziers und
Fernkaufleute. Er ist komplex, das Element der Dynamik schlechthin und - was
manchen überraschen mag - bereits lange vor der Wende zum 20. Jahrhundert
hochgradig organisiert und monopolisiert.
Er ist es, der das Gefüge des Abendlandes von oben nach unten allmählich
verändert, ältere Hierarchien für seine Ziele einspannt und zermürbt,
traditionelle Abhängigkeiten sprengt, um national wie international neue zu
schaffen. In sämtliche Bezirke des Lebens dringt er allerdings während der
Inkubationszeit zwischen 1400 und 1800 nicht vor. Prozesses des Wandels
mobilisieren hier ungeahnte Wachstumspotentiale und brechen sich dort an
festverriegelten Türen. Die Gesellschaften des »Ancien Régime« bleiben buntscheckig. Fortschritt und Stillstand
liegen dicht beieinander.
Die Zentren der ökonomischen Entwicklung verlagern sich vom Mittelmeer zum
Atlantik, von den Städten Oberitaliens und der Niederland auf die nationalen
Volkswirtschaften, von Venedig, Antwerpen, Genua und Amsterdam auf London und
New York. Die Bewegung hat einen Anfang, aber kein Ende. Der Kapitalismus, so
Braudel, setzt sich trotz aller Rückschläge und Sprünge »ins Unendliche fort«. An diesem Punkt freilich verläßt der Autor das
vertraute Feld gesicherter Beobachtungen und wechselt über auf das
schwankende Terrain der Spekulation: wenn auch viel dafür spricht, daß er recht
behält.«
Jens Flemming (Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 05.10.1986)
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Dynamik des Kapitalismus" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









