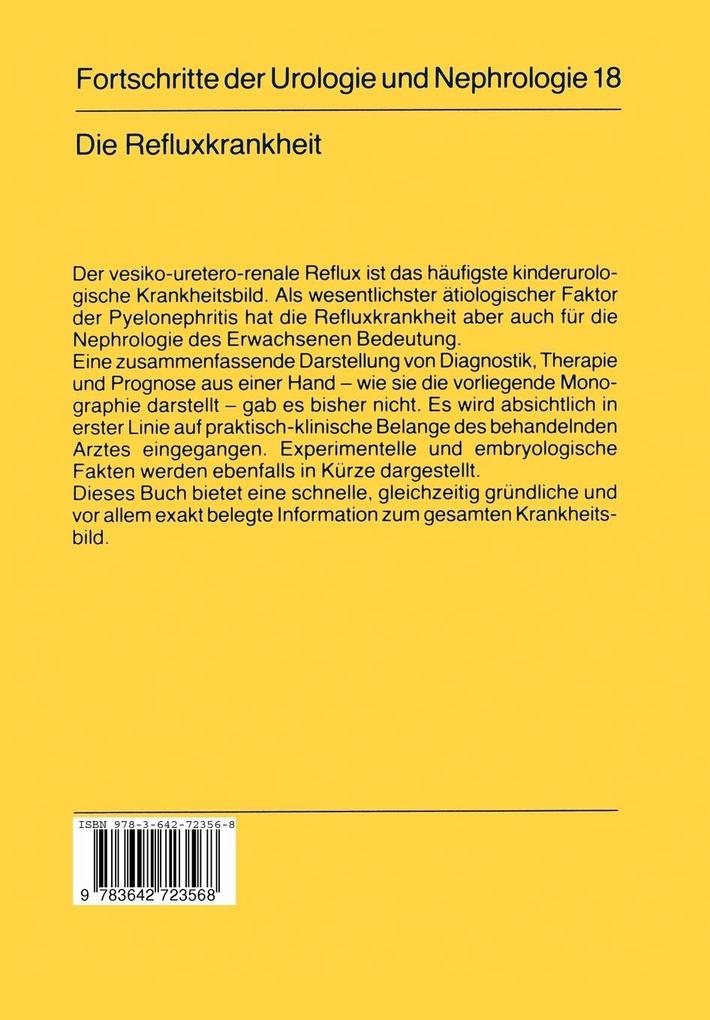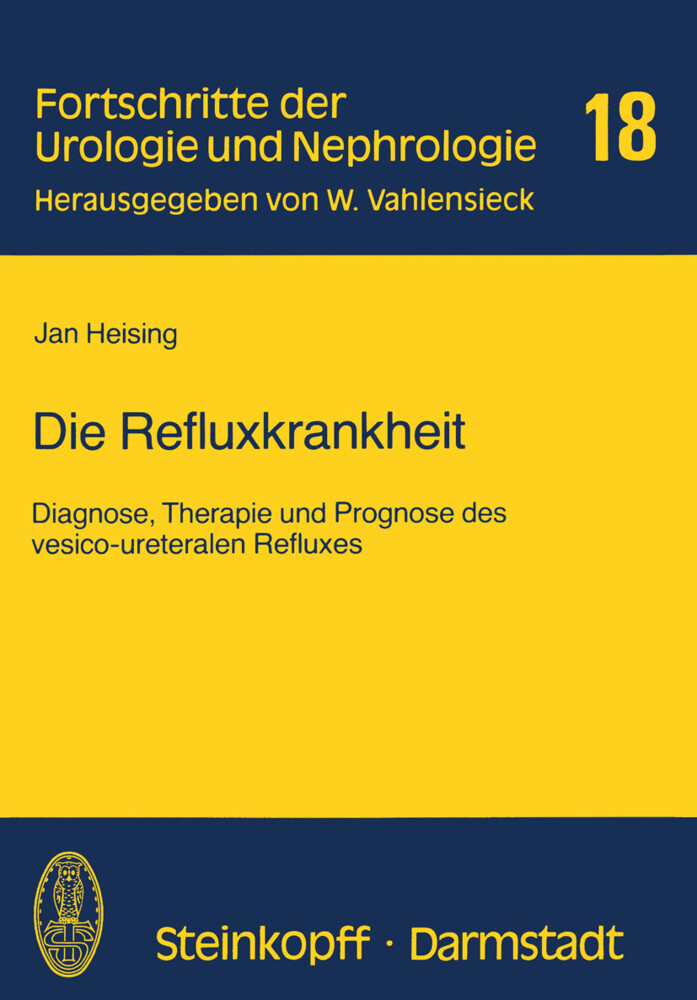
Zustellung: Di, 22.07. - Do, 24.07.
Versand in 2 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
- Primare und sekundare VUR sind zu differenzieren, sekundare VUR mtissen kausaI be handelt werden; flir sie gelten die folgenden Oberlegungen nicht. - Wenn auch ein Einzelbefund fur die Wahl der Therapieform nie entscheidend sein darf, so hat sich die radiologische Graduierung nach Heikel u. Parkulainen (1966) in die Grade I-V (Abb. 11-16) doch aIs bedeutsam fur die Prognose erwiesen. Die Stadien I und II soIl ten konservativ behandelt werden, wenn keine Golflochostien vorliegen. Bei konservativer Behandlung ist die niedrig dosierte dauernde der intermittierenden antibiotischen Behandlung deutlich tiberlegen. Unter niedrig dosierter antibiotischer Dauertherapie ist in den Stadien I und II nur sel ten mit einer Verschlechterung zu rechnen. Bisher sind nennenswerte, ernsthafte Nebenwirkungen der niedrig dosierten antibioti schen Dauertherapie nicht zu erwarten. Bei zusatzlichei, auch geringgradiger Harnrohrenenge soUte bei VUR der Grade I-III immer die moglichst frtihe Beseitigung des distalen Abflu~hindernisses vorgenommen werden (vgl. nachfolgendes Kapitel und Tab. 7 und 8). Operieren sollte man vor Vollendung des 3. Lebensjahres nur bei vitaler Indikation. Da andererseits nach dem ersten Lebensjahr kein signiflkanter Unterschied in der Hei lungsrate bezogen auf die Altersgruppen besteht, sollten VUR der Grade IV und V moglichst frtih durch ARP bzw. Nephroureterektomie versorgt werden (vgl. 10.4. Ope rative Therapie). Paraureterale Divertikel sind eine Kontraindikation zur konservativen Therapie. 10.4. Operative Therapie Vor dem umfangreichen Tell tiber die Antirefluxplastiken (ARP) wird zuniichst besprochen, wann eine ARP noch nicht (distaIes Abflu~hindernis) oder nicht mehr (Nephroureter ektomie) sinnvoll ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Medizinhistorische Entwicklung. - 2. Die uretero-vesikale Verbindung beim Menschen. - 2. 1. Normale Anatomie und Physiologie. - 2. 2. Pathologische Anatomie und Physiologie. - 3. Experimentelle Befunde zum VUR beim Versuchstier. - 3. 1. Die uretero-vesikale Verbindung und Häufigkeit bei geeigneten Arten. - 3. 2. Experimentelle Refluxerzeugung. - 3. 3. Experimentelle Refluxerzeugung und Nierendurchblutung. - 3. 4. Experimenteller vesiko-ureteraler Reflux und Harnwegsinfektion. - 3. 5. Experimenteller intrarenaler Reflux. - 3. 6. Alloplastische Ventile zur Refluxverhütung. - 4. Vorkommen und Häufigkeit beim Menschen. - 4. 1. Bei Gesunden . - 4. 2. Bei urologisch Kranken . - 4. 3. In den verschiedenen Altersgruppen. - 4. 4. Die sog. Maturationstheorie. - 4. 5. Bei beiden Geschlechtern. - 4. 6. Familiäre Häufung. - 5. Die verschiedenen pathogenetischen Deutungen bzw. Einteilungen. - 5. 1. Hoch-und Niederdruckreflux. - 5. 2. Am Röntgenbefund orientierte Schemata. - 5. 3. Okkulter Reflux. - 5. 4. Infizierter und steriler Reflux. - 5. 5. Primärer und sekundärer Reflux. - 5. 6. Zusammenfassende Beurteilung der Einteilungen. - 6. Ursachen des vesiko-ureteralen Refluxes. - 7. Folgen des vesiko-ureteralen Refluxes. - 7. 1. Folgen der Begleitinfektion. - 7. 2. Folgen des intrarenalen Refluxes. - 7. 3. Die VUR-assoziierte Hypertonie. - 7. 4. Folgen sekundärer vesiko-ureteraler Refluxe. - 7. 5. Zusammenfassung. - 8. Symptomatik. - 9. Diagnostik. - 9. 1. Labor. - 9. 2. Röntgen. - 9. 3. Urethro-Cystoskopie. - 9. 4. Nuklearmedizinische Diagnostik. - 9. 5. Urodynamische Diagnostik. - 9. 6. Sonographie. - 9. 7. Zusammenfassende Wertung der präoperativen Diagnostik. - 9. 8. Besonderheiten der postoperativen Diagnostik. - 10. Therapie. - 10. 1. Überhaupt behandeln oder Zuwarten ? . - 10. 2. Derzeitige Indikation und Ergebnisse derkonservativen Therapie. - 10. 3. Konservative Therapie, Zusammenfassung. - 10. 4. Operative Therapie. - 11. Prognose bzw. Therapieempfehlungen. - 11. 1. Prognose einzelner Therapieformen. - 11. 2. Prognose einzelner Befunde und Problemgruppen. - 11. 3. Prognose der Grade I bis V. - 11. 4. Prognose, Zusammenfassung. - Sachwortverzeichnis.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
10. Dezember 2011
Sprache
deutsch
Auflage
Softcover reprint of the original 1st edition 1982
Seitenanzahl
152
Reihe
Fortschritte der Urologie und Nephrologie
Autor/Autorin
J. Heising
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
276 g
Größe (L/B/H)
244/170/9 mm
ISBN
9783642723568
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Refluxkrankheit" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.