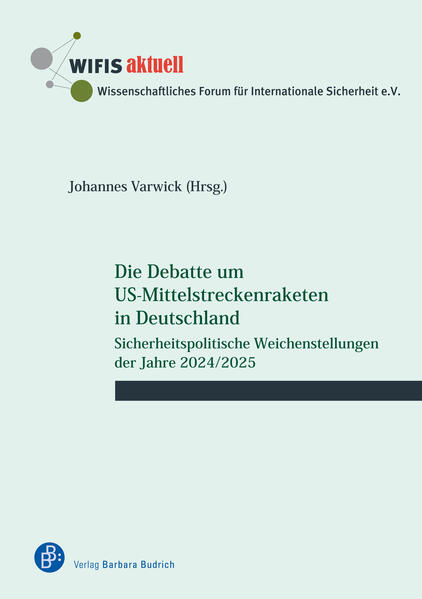
Zustellung: Mi, 09.07. - Fr, 11.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Entscheidung zur Stationierung von US-Mittelstreckenraketen ist eine der folgenreichsten sicherheitspolitischen Entscheidungen seit Jahren. Sie wird von der Bundesregierung als notwendige Reaktion auf russische Bedrohungen gewertet. Andere befürchten, dass sich damit das strategische Gleichgewicht verändert und die Konfrontation zwischen der NATO und Russland verschärft. Der Band versammelt kontroverse Positionen und soll zur Versachlichung der Debatte beitragen.
Inhaltsverzeichnis
Johannes Varwick: Vorwort
Stationierungserklärung im Wortlaut
Wortlaut des Schreibens der Staatssekretäre des Auswärtigen Amts und des Verteidigungsministeriums vom 19. 07. 2024
Wolfgang Richter: Stationierung von U. S. Mittelstreckensystemen in Deutschland. Konzeptioneller Hintergrund und Folgen für die europäische Sicherheit
Joachim Krause: Wie gefährlich ist die geplante Stationierung amerikanischer Mittelstreckenwaffen in Deutschland?
Michael Staack: Raketenstationierung, außenpolitischer Handlungsspielraum und deutsche Interessen
Hans-Peter Bartels/Rainer Glatz: Konventionelle Abschreckung erfordert Glaubwürdigkeit
Oscar Prust: Raketenstationierung: Rolle und Möglichkeiten des Deutschen Bundestages
Wolfgang Hellmich: Ein wichtiger Beitrag für mehr Abschreckung
Florian Hahn: Schlüsselelement glaubwürdiger Abschreckung
Alexander Müller: Freiheit muss verteidigt werden
Rüdiger Lucassen: Abschreckung und Dialog aus der Krise ein INF 2. 0 schaffen
Dietmar Bartsch: Aufrüstung ohne Dialogangebot
aklin Nasti : Verunsicherung statt Sicherheit
Autorenverzeichnis
Stationierungserklärung im Wortlaut
Wortlaut des Schreibens der Staatssekretäre des Auswärtigen Amts und des Verteidigungsministeriums vom 19. 07. 2024
Wolfgang Richter: Stationierung von U. S. Mittelstreckensystemen in Deutschland. Konzeptioneller Hintergrund und Folgen für die europäische Sicherheit
Joachim Krause: Wie gefährlich ist die geplante Stationierung amerikanischer Mittelstreckenwaffen in Deutschland?
Michael Staack: Raketenstationierung, außenpolitischer Handlungsspielraum und deutsche Interessen
Hans-Peter Bartels/Rainer Glatz: Konventionelle Abschreckung erfordert Glaubwürdigkeit
Oscar Prust: Raketenstationierung: Rolle und Möglichkeiten des Deutschen Bundestages
Wolfgang Hellmich: Ein wichtiger Beitrag für mehr Abschreckung
Florian Hahn: Schlüsselelement glaubwürdiger Abschreckung
Alexander Müller: Freiheit muss verteidigt werden
Rüdiger Lucassen: Abschreckung und Dialog aus der Krise ein INF 2. 0 schaffen
Dietmar Bartsch: Aufrüstung ohne Dialogangebot
aklin Nasti : Verunsicherung statt Sicherheit
Autorenverzeichnis
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
11. November 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
92
Reihe
WIFIS-aktuell, 79
Autor/Autorin
Joachim Krause, Wolfgang Richter, Michael Staack, Hans-Peter Bartels, Alexander Müller
Herausgegeben von
Johannes Varwick
Unter Mitwirkung von
Wolfgang Richter, Joachim Krause, Michael Staack, Hans-Peter Bartels, Alexander Müller
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
146 g
Größe (L/B/H)
210/148/7 mm
ISBN
9783847431305
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Donald Trump stellt die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland bisher nicht infrage. Unter Fachleuten gibt es indes auch Kritik. [ ] In dem im November erschienenen Buch Die Debatte um US-Mittelstreckenraketen in Deutschland: Sicherheitspolitische Weichenstellungen der Jahre 2024/2025 streiten Fachleute über das Für und Wider der Stationierung.
Gregor Grosse, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. 03. 2025, Politik, Seite 6
Gregor Grosse, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. 03. 2025, Politik, Seite 6
 Besprechung vom 11.03.2025
Besprechung vom 11.03.2025
Sie sollen Putin abschrecken
Donald Trump stellt die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland bisher nicht infrage. Unter Fachleuten gibt es indes auch Kritik.
Es war eine Entscheidung von großer Tragweite: Erstmals seit Jahrzehnten sollen wieder amerikanische Raketen und Marschflugkörper in Deutschland stationiert werden, die bis nach Russland reichen. Noch vor der Amtseinführung des neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump veröffentlichten Berlin und Washington im Juli 2024 eine Erklärung, die von 2026 an die "zeitweilige" Verlegung von weitreichenden konventionellen Waffen vorsieht: SM-6-Mehrzweckraketen, Tomahawk-Marschflugkörper und in Entwicklung befindliche Hyperschallraketen Dark Eagle. Sie sollen über weitaus größere Reichweiten als die bisherigen Systeme in Europa verfügen. Dark Eagle kann laut amerikanischen Angaben mehr als 2700 Kilometer weit fliegen. Zum Vergleich: Der luftgestützte Taurus-Marschflugkörper, der als modernster Flugkörper der deutschen Luftwaffe gilt, kann "nur" mehr als 500 Kilometer zurücklegen.
Ob Donald Trump an den Stationierungsplänen festhält, ist nicht bekannt. Er hat sich dazu noch nicht offiziell geäußert. Es wird jedoch befürchtet, dass er zumindest einen Teil des amerikanischen Militärs aus Europa abziehen könnte. Der Eklat im Weißen Haus zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat die Zweifel an Washington gestärkt. Als sicher dürfte gelten, dass die künftige, wahrscheinlich unionsgeführte Regierung die Verlegung der amerikanischen Waffen unterstützt. Nichtsdestoweniger wird die Entscheidung der damaligen Ampelregierung in Deutschland kontrovers diskutiert: Die Hintergründe seien nicht ausreichend erläutert, der Bundestag sei zu wenig eingebunden worden und die Stationierung vergrößere die Gefahr einer militärischen Eskalation.
In dem im November erschienenen Buch "Die Debatte um US-Mittelstreckenraketen in Deutschland: Sicherheitspolitische Weichenstellungen der Jahre 2024/2025" streiten Fachleute über das Für und Wider der Stationierung. Der Oberst a. D. und Fachmann am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik, Wolfgang Richter, spricht sich ausdrücklich dagegen aus. Er sieht darin eine Verschärfung der Konfrontation zwischen der NATO und Russland und befürchtet das Ende der europäischen Rüstungskontrolle. Moskau habe bereits eine Gegenstationierung von Mittelstreckensystemen angekündigt, schreibt Richter. Russland werde die amerikanischen Waffen nicht als defensive Abschreckung wahrnehmen, "sondern als Aufbau der Fähigkeit zum regionalen Überraschungsangriff". Er kritisiert, dass die Entscheidung nicht mit einer Dialogbereitschaft gegenüber Moskau einhergegangen sei. Die Behauptung, dass Rüstungskontrolle mit der russischen Führung nicht möglich sei, sei "historisch nicht haltbar".
Richter mahnt, dass das nukleare Gleichgewicht zwischen Moskau und Washington gefährdet werde. Tieffliegende Marschflugkörper und Hyperschallraketen könnten auch mit konventionellen Sprengköpfen das Atomwaffenpotential des Gegners reduzieren - etwa durch Angriffe auf nukleare Raketenstellungen oder Frühwarnradare. "Für die nuklearstrategische Gleichung spielen daher konventionelle Angriffsraketen mit ihrer hohen Präzision eine wichtige Rolle."
Das sei "eine wirklich steile These", die Angst produzieren solle, meint dagegen Joachim Krause. Er ist Politikwissenschaftler und früherer Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Krause weist die Positionen Richters scharf zurück und wirft ihm "russische Propaganda" vor. Mit der Stationierung in Deutschland sei "definitiv" keine Veränderung des nuklearen Gleichgewichts verbunden, schreibt Krause. Regionale Angriffe reichten nicht aus, um das gegnerische Kernwaffenpotential auszuschalten. "Insbesondere nicht bei einem Land wie Russland, in dem der Großteil der strategischen Angriffskräfte (...) sich im asiatischen Teil befindet." Krause betont, dass Moskau eben nicht an einer seriösen Rüstungskontrolle interessiert sei. Er begründet das unter anderem mit angekündigten neuen Nuklearwaffen.
Die Stationierung wurde von der Bundesregierung mit einer "Fähigkeitslücke" bei landgestützten Mittelstreckenwaffen begründet. In einem Schreiben an den Verteidigungsausschuss und den Auswärtigen Ausschuss des Bundestags hieß es, dass Russland in diesem Bereich "massiv" aufgerüstet habe. Dies beobachte man über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hinaus: "Mit diesen Waffen bedroht Russland die Länder Europas", steht in dem Schreiben aus dem Verteidigungsministerium und dem Auswärtigen Amt vom 19. Juli 2024. Die Verlegung der amerikanischen Waffen trage "zu einer effektiven und glaubwürdigen Abschreckung und zum Schutz Deutschlands und seiner Verbündeten bei".
Richter lässt diese Argumentation nicht gelten. Zwar gesteht er ein, dass Europa nicht über landgestützte Mittelstreckensysteme verfüge - dafür aber über "ein breites Arsenal" an weitreichenden Waffen, die aus der Luft oder von See abgefeuert werden können. Die Luft- und Seestreitkräfte der NATO seien denen Russlands "weit überlegen". So wie Moskau Ziele im Baltikum oder in Deutschland angreifen könne, sei auch die NATO in der Lage, Kaliningrad oder Sankt Petersburg zu attackieren. Die Annahme einer "Fähigkeitslücke" überzeuge nicht. Krause sieht das anders. Für eine effektive Abschreckung müsse die NATO auch über landgestützte Waffen verfügen, schreibt er. Diese erlaubten "flexiblere, präzisere und vor allem zeitkritische Angriffe". Russland würde laut Krause in einem Krieg gegen die NATO wie in der Ukraine militärische und zivile Ziele im Hinterland angreifen. "Wollte man der Argumentation von Richter folgen, wäre das geradezu eine Einladung an Russland, (...) weil die westlichen Vergeltungsmaßnahmen nur gebremst erfolgen dürften." Demnach wäre die NATO auf den Einsatz von Bombern beschränkt, die womöglich Probleme mit der russischen Flugabwehr hätten. Oder das Bündnis müsse auf Systeme zurückgreifen, die lange benötigten, um Russland zu erreichen.
Richter findet es "befremdlich", dass der Bundestag und die deutsche Öffentlichkeit "durch eine dürre exekutive Mitteilung" vor vollendete Tatsachen gestellt worden seien. Der Politikwissenschaftler Michael Staack sieht das ähnlich: Dies könne als "Meisterstück dilettantischer strategischer Kommunikation" bewertet werden. Oscar Prust, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Halle-Wittenberg, schreibt hingegen, dass es bei dieser Entscheidung keiner formellen parlamentarischen Beteiligung bedürfe - auch wenn der Bundestag nicht völlig machtlos sei. Dennoch konstatiert er, dass vor dem Hintergrund der amerikanischen und der Bundestagswahl eine "rechtzeitige und breitere" Debatte zur langfristigen politischen Absicherung sinnvoll gewesen wäre.
Während die anderen Autoren darüber streiten, ob Washington im Ernstfall allein über den Waffeneinsatz entscheidet oder Berlin ein Wörtchen mitzureden hat, kommt Prust zu einem differenzierten Schluss: "Eine alleinige Entscheidung der USA erscheint ebenso wenig vorstellbar wie ein reines Konsensverfahren." Ein Zustimmungsvorbehalt der Bundesregierung sei eine realistische Option. Dies würde auch dem Bundestag einen gewissen Einfluss ermöglichen - den politischen Willen der Abgeordneten vorausgesetzt. GREGOR GROSSE
Johannes Varwick: Die Debatte um US- Mittelstreckenraketen in Deutschland. Sicherheitspolitische Weichenstellungen der Jahre 2024/2025.
Verlag Barbara Budrich, Leverkusen-Opladen 2024. 92 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Debatte um US-Mittelstreckenraketen in Deutschland" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.













