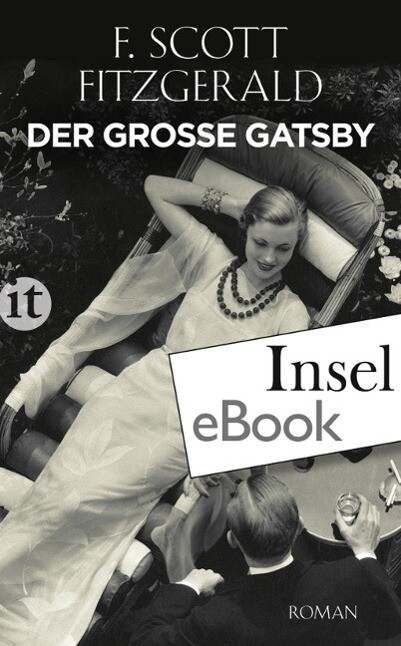Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Sie haben den falschen Mann
Nick Carraways steile Story: Hundert Jahre nach der Erstveröffentlichung erscheint F. Scott Fitzgeralds "Der große Gatsby" in Neuübersetzung als Jubiläumsausgabe. Der große Reiz des Romans ist, dass darin ein Hochstapler einen anderen beschreibt.
Von Jan Wiele
Von Jan Wiele
Das grüne Licht, es leuchtet noch immer. Im Herbst 1924 motivierte sich Francis Scott Fitzgerald - dessen Frau Zelda es bevorzugte, wenn er lukrative Kurzgeschichten schrieb, während sein Freund Ernest Hemingway dies für "Hurerei" hielt - zum Abschluss seines dritten Romans. Das im Frühling 1925 veröffentlichte Buch handelt von einem neureichen Emporkömmling mit dubioser Lebensgeschichte, der sich ein märchenhaftes Anwesen auf Long Island leisten kann und dort rauschende Partys mit glamourösen Gästen feiert, sich aber in eine Frau verliebt, die er trotz allem nicht erreichen kann, und schließlich Opfer eines Rachemords wird. Zu seiner Beerdigung kommen nur zwei Menschen.
Dem Lektor Maxwell Perkins ist zu verdanken, dass dieses Buch im Original nicht den vom Autor vorgeschlagenen absurden Titel "Trimalchio in West Egg" trug und auch nicht den Märchentitel "Gold-Hatted Gatsby" ("Goldhütiger Gatsby"), sondern viel höher zielte mit dem Titel "The Great Gatsby". Dass es sich, trotz der relativen Kürze, dabei um eine "Great American Novel" handeln könnte, erkannten einige Kritiker und manche Schriftstellerkollegen Fitzgeralds früh, andere erst etwas verspätet.
Inzwischen gilt das Buch als Inbegriff der goldenen, dabei moralisch hohlen Zwanziger und Gatsby als der eines amerikanischen Selfmademan und Hochstaplers, der zur tragischen Figur wird. Es gibt mehrere Verfilmungen und andere Adaptionen, ständig entdeckt man von Neuem Gatsbys Einflussreichtum, nur zum Beispiel in der Figur des Don Draper in der Serie "Mad Men".
Mit Bernhard Robbens nun vorliegender Neuübersetzung in einem schön gestalteten Jubiläumsband nebst viel Material existieren nun sage und schreibe neun Übertragungen ins Deutsche in Publikumsverlagen: die von Maria Lazar (1928), Walter Schürenberg (1953), Lutz W. Wolff (2001), Bettina Abarbanell (2006), Reinhard Kaiser (2011), Kai Kilian (2011), Johanna Ellsworth (2011) und Hans-Christian Oeser (2012).
Dass Jay Gatsby ein Hochstapler und der Buchtitel somit auch ironisch zu verstehen ist, erhellt sich aus verschiedenen kritischen Beschreibungen seines "Self-Fashionings". Gatsbys Reise- und Kriegsanekdoten nehmen sich aus Sicht des Romanerzählers fast aus wie Münchhausiaden, zumindest als die eines "Turban tragenden 'Helden', dem aus jeder Pore Sägespäne rannen".
Besonders verräterisch erscheint Gatsby angesichts der Frage, aus welcher Gegend des Mittleren Westens er stamme. Dass er darauf antwortet: "Aus San Francisco", deuten manche als Entlarvung seines Mangels an Bildung, andere als Witz, mit dem er die richtige, womöglich zu sehr nach Provinz klingende Antwort kaschiert. Rührender wirkt Gatsbys Selbstentwurf, als bei seiner Beerdigung sein Vater von jugendlichen Kritzeleien des Sohnes berichtet, die dessen ambitionierten Tagesplan in die Tradition von Benjamin Franklins Erfolgsmenschentum stellen.
Der Titel "Der große Gatsby" hat allerdings auch einen Nachteil: Er lenkt von einer anderen Romanfigur ab, von der manche sagen, sie sei die eigentliche Hauptfigur. Die Rede ist vom Erzähler Nick Carraway. Bis Kritik und Literaturwissenschaft auf seine Rolle stärker abhoben, hat es ebenfalls gedauert; dafür rückte sie hernach umso deutlicher in den Fokus, wie im vorliegenden Band auch der Manesse-Verleger Horst Lauinger und Claudius Seidl in seinem Nachwort betonen ("Bilder und Zeiten" vom 8. März).
Noch bevor er von Jay Gatsby erzählt, erzählt Nick Carraway erst einmal von sich, und die moralische Fallhöhe der Geschichte ergibt sich vor allem aus dem Gegensatz zwischen beiden Männern. Carraway stammt zwar ebenfalls aus dem kargen Mittelwesten, hat es aber trotz Studiums in Yale nicht zu Geld gebracht, und er logiert neben Gatsbys Märchenschloss in einer kleinen Hütte. Nick Carraway tritt explizit als auktorialer Erzähler hervor, er lässt uns wissen, dass er früher Leitartikel für die "Yale News" geschrieben hat und wir nun "sein Buch" über Gatsby lesen - und doch ist er zugleich auch handelnde Figur in dieser Geschichte, vielleicht sogar für ihren Ausgang entscheidend.
Als Erzähler gibt Carraway der Handlung ihren großen Rahmen mit gnostischen Kommentaren, mit Bewertungen der anderen Figuren, hintergründigen Allegorien und vor allem der Schlussbemerkung, es handele sich um eine Geschichte von Menschen des Westens, die zur Anpassung an den Osten unfähig sind.
Wenn man Carraways Rolle begriffen und erkannt hat, dass er voller starker Emotionen ist - er verachtet Tom und vor allem Daisy Buchanan, an deren Kälte und Indifferenz Gatsby letztlich scheitert, ebenso wie Jordan Baker, mit der er anfangs verkuppelt werden soll -, dann stellt man sich irgendwann auch die Frage, wie verlässlich er als Erzähler überhaupt ist. Inzwischen gilt er in der Literaturwissenschaft als Paradebeispiel eines "unzuverlässigen Erzählers", und wenn man einmal auf dieser Spur ist, kann man sogar bald in Carraway selbst einen Hochstapler erkennen. Auch er hat schließlich eine unklare Vergangenheit im Ersten Weltkrieg, und zu dem Gerücht, dass er schon einmal verlobt war, sagt er nichts. Carraway selbst ist an die Ostküste gezogen, "um das Börsengeschäft zu erlernen", dies erklärt die Faszination von Gatsby und den Wunsch, zu ergründen, wie der es geschafft hat.
Dabei scheint Nick über Andeutungen von Gatsbys Kriminalität hinwegsehen und trotz Skepsis an dessen Selbsterfindung glauben zu wollen - vielleicht sogar aus unterdrückter Liebe zu ihm, wie einige es deuten. Zugespitzt gesagt, besteht der große Reiz des Buches jedenfalls darin, dass darin ein Hochstapler einen anderen beschreibt. Oder sogar mehrere andere, denn aufs Täuschen und Betrügen verstehen sich noch weitere Figuren. (Dass die Frauen dabei sehr schlecht wegkommen und es im Grunde ein Männerbuch ist, hat Fitzgerald schon selbst erkannt.)
Je detektivischer man an die Interpretation der Erzählung herangeht, desto offensichtlicher werden allerdings die Defizite ihrer Binnenlogik. So stark die Symbole und die großen Linien des Buches wirken - also etwa das grüne Licht, das Gatsby zu Daisy auf die andere Seite der Bucht lockt, das "Aschetal" zwischen New York City und den reichen Gegenden auf Long Island, der Abgesang auf die dekadente Ostküstengesellschaft -, so schwach wirkt die literarische Konstruktion, wenn man sie genauer anschaut.
Dass Nick als auktorialer Erzähler fungiert, aber zugleich einer der Protagonisten ist, wirft häufig die Frage auf, woher er denn den detaillierten Ablauf der Ereignisse kennen will, an denen er gar nicht beteiligt ist, und sogar lange Dialoge in wörtlicher Rede wiedergeben kann, bei denen er nicht anwesend war.
Und dennoch möchte man den Lobpreisungen des Lektors Perkins nach Erstlektüre 1924 sowie den folgenden von Hemingway, Dos Passos, Gertrude Stein und vielen anderen bis hin zu Haruki Murakami (die vorliegende Ausgabe bietet hier reiches Material) weiterhin recht geben - denn trotz diesen Schwächen nimmt einen die Lektüre jedes Mal von Neuem wieder ein. Man liest sich sofort fest, wenn man das Buch nach Jahren wieder aufgreift.
Während man bei seiner Übersetzung eigentlich nicht viel falsch machen kann und es höchstens an einigen Stellen schwer hat, an denen das Original etwas vage formuliert ist, sind die charakteristischen Stellen, an denen Carraway besonders blumig schreibt oder besonders stark wertet, natürlich für den Vergleich besonders interessant. Bernhard Robben scheint daran gelegen, dass Sprachbilder in sich stimmig bleiben, selbst wenn sie dafür etwas redundant werden. Das zeigt sich etwa an der lyrischen Anfangsstelle, die Gatsbys Ende schon vorwegnimmt und an der Carraway konstatiert: "It is what preyed on Gatsby, what foul dust floated in the wake of his dreams that temporarily closed out my interest in the abortive sorrows and short-winded elations of men." Wo andere teils "faulen Dunst" sahen (Abarbanell), teils "im Kielwasser der Träume" (Kaiser), heißt es bei Robben: "Vielmehr war es, was Gatsby plagte, dieser stickige Staub, der im Gefolge seiner Träume aufgewirbelt wurde und mein Interesse am fruchtlosen Leid und den kurzlebigen Freuden der Menschen zeitweilig erstickte." Aus Gatsbys Lieblingsanrede "Old Sport", die bei Lazar und Schürenberg "alter Junge" hieß und bei Abarbanell "alter Knabe", bei Oeser etwas doppelt gemoppelt "alter Sportsfreund", macht Robben den einfachen "Sportsfreund", während in seiner Übersetzung Nick angesichts von Gatsbys Partygästen diesem zuruft: "Sie sind mehr wert als dieses ganze Pack."
Und natürlich ist man gespannt auf Carraways allerletzte Weisheit ("So we beat on, boats agains the current . . ."). Ob wir uns durchschlagen (Lazar), uns in die Riemen legen (Kilian) oder uns weiter mühen gegen die Strömung (Robben), fortwährend zieht es uns (Kilian), treibt es uns (Abarbanell), wirft es uns zurück (Lazar) - wohin? Dorthin, wo noch immer das grüne Licht leuchtet.
F. Scott Fitzgerald: "Der große Gatsby". Roman.
Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Hrsg. und kommentiert von Horst Lauinger, Nachwort von Claudius Seidl.
Manesse Verlag, München 2025. 352 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.