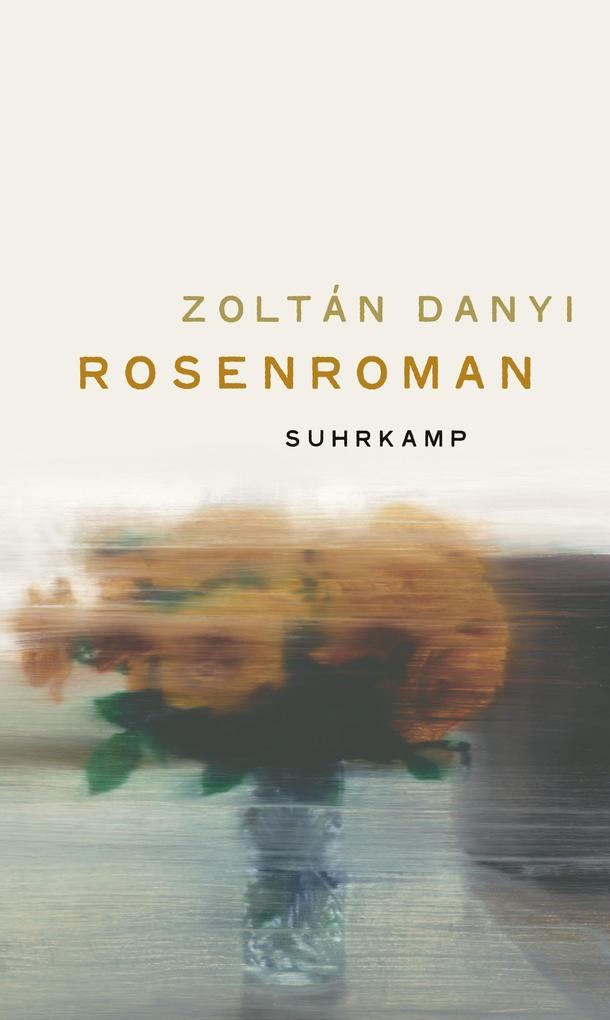Besprechung vom 24.06.2025
Besprechung vom 24.06.2025
Willkommen im Niezurückland
Was ist ein Nest? Ein Nest ist aller Anfang: Esther Kinsky setzt mit dem Band "Heim.Statt" ihr literarisches Großprojekt fort
Das Wort "Route" bezeichnet nicht einfach eine bestimmte Wegstrecke zwischen zwei Punkten, sondern schließt im Blick auf die Wegstrecke auch alles Charakteristische mit ein: Abzweigungen, Steigungen, Kreuzungen, Unwegsamkeiten. Für Esther Kinskys Schreiben sind Beschaffenheiten von bestimmten Geländen und Routen, die durch diese Gelände führen, seit Langem zentral. In Gedichtbänden wie "Aufbruch nach Patagonien" von 2012 oder zuletzt "Morârs - Amôrs. Maulbeerzeilen" von 2024, aber auch in ihrem Roman "Hain" von 2018, der den Untertitel "Geländeroman" trägt, oder in "Rombo" von 2022 verwandeln sich im Schreiben geographische Landschaften mit ihrer Materie und charakteristischen Wegstrecken in Textlandschaften. Darin finden gegenläufige Bewegungen von Befremdung und Erkundung statt, verwandeln sich reale, auf Landkarten verzeichnete Gegenden in traumähnliche innere. Schon in "Aufbruch nach Patagonien" hieß es in einem der Gedichte: "Mitgenommen hat uns das bloße / wort / patagonien / hat die zunge verzerrt / und der anblick der feuer im traum oder / halbtraum jedenfalls / bei geschlossenen augen / hat den blick erschöpft". Zeit wird in tastenden und suchenden Bewegungen der Verse zu einem Raum, zum "unwegsamen gelände der zeit", in dem ein "fremdlein" zu Hause ist.
Solche "fremdlein" trifft man auch in "Heim.Statt", es sind Gestalten, die in ihren Bewegungen des Fremdseins und -bleibens in der Sprache Halt suchen und oft an ihr abgleiten, diesmal in Gegenden Schottlands und Norditaliens, wo auch die Autorin zeitweise lebt. Die bestimmende Route im jüngsten Band ist allerdings die Balkanroute. Er enthält sieben Kapitel, die von Auf- und Umbrüchen, von Unbehaustheit und Sehnsucht nach Verankerung ebenso sprechen wie sie antike Mythen, etwa den von Orpheus, biblische und literarische Texte aufrufen.
Am Ende jedes Zyklus steht ein Gedicht, das mit "Balkanroute" überschrieben ist. Insbesondere entlang dieser Route betrachten die Gedichte bestimmte Kulturtechniken, wie das Rosenzüchten, als Wechselverhältnisse von Kultivierung und Gewaltsamkeit. "Heim.Statt" versammelt Gedichte über Formen von Landschaft und Geformtwerden durch Landschaft. Die Verse setzen sich dabei intensiv auseinander mit dem Werk des unbedingt noch mehr zu entdeckenden Lyrikers und Romanciers Zoltán Danyi. Dessen "Rosenroman" (2023) und "Aus dem Tagebuch des Gärtners" (2023) schildern ebenfalls das Spannungsverhältnis von Kultivierung und Gewalt und mit ihm auch das Leben im ungarisch-serbischen Grenzgebiet, in dem die Rosenzucht traditionell verbreitet und von Wanderarbeitern weitergetragen wird.
Mit Versen wie "Hinterland - im rücken liegengebliebenes land hinter die augen hinter die schlafwändigen lider verschoben und hinter alles jetzt verschickt ein niezurückland des hinlebens am anderen ort" aus dem ersten Zyklus "Heim.Statt" ist man beim Lesen von Kinsky unterwegs mit Landlosen in Nordschottland. Es entsteht vor dem inneren Auge der schmerzlich leere Anblick einer entsiedelten Fläche: "das land ist der hinterbliebene aller heimischkeit". In sieben Langgedichten des fünften Zyklus "Pavillon 11. Nester von Sant' Osvaldo" erkunden die Verse dagegen das Schicksal von Frauen, die von ihren Männern, Wanderarbeitern, allein zurückgelassen wurden. Die Frauen, die zu verstummen drohen, gleichen sich Vögeln an, solchen, denen man die Zunge herausschneidet, aber auch Schwalben, deren Nester denen von Wespen gleichen.
Esther Kinskys poetisches Sprechen nähert sich in extremster Genauigkeit den Phänomenen und Kontexten an. Es ist ein Ausloten von Natur- und Kulturgeschichte als Gewaltgeschichte, nimmt Analogien in der Natur, Landschaften und Tradition nicht nur staunend und fasziniert wahr, sondern spitzt diese Analogien noch zu, über Bekanntes hinaus, in bisweilen extrem verstörenden narrativen Splittern: "Was ist ein Nest, fragt man mich, ein Nest ist aller Anfang, antworte ich", heißt es in "Bau" aus dem fünften Zyklus, und dann: "Wenn die Wespeneier in den Kammern zu Larven geworden sind, schwärmt ein Teil der Wespen aus auf der Suche nach Zucker, der die Jungen ernährt. Der andere Teil der Wespenschar legt sich indessen schützend um den Bau, so dass er aussieht wie eine Halbkugel, die ganz und gar aus Wespen besteht", und dann: "So tarnend jedenfalls täuschen sie die Welt ringsum", um dann in einem weiteren narrativen Splitter zu schildern, wie Wespen, von Salz angezogen, in Tränenkanäle von Trauernden schlüpfen: "Das ist ihr Verderben, doch auch das der Trauernden, die am Ausbleiben der Tränen erblinden".
Das Ausbilden von zunächst arterhaltenden Strategien zeigt sich hier als menschlichen Kulturtechniken Verwandtes, als ein Muster, das neben dem Erhalt nicht selten Zerstörung in sich trägt, gleichsam Fehler im System. Obwohl sich die ordnende Instanz in den vielstimmigen Gedichten, die eine enthierarchisierende Sicht auf das Verhältnis von Mensch und Natur befördern, weitestmöglich in den Hintergrund zurückzieht, der subjektive Anteil gleichsam selbst Mimikry betreibt wie die Wespen am Bau, gewinnt das sprechende Ich in der Gänze des Bandes doch Kontur als eines, das staunend und melancholisch die Befremdung noch bis in den Sprachgebrauch hineinträgt. Das Moment von Heimat und Ortlosigkeit wird in "Heim.Statt" nicht nur in Form von Sprachwechseln ins Englische oder Friaulische, sondern bis in die Neuschöpfung von Worten realisiert, es realisiert sich in einem Gleiten von Ort- und Wortlosigkeit und Manifestationsbestreben: "Streifen am abgrund / trachten nach dem freien fall / die hand noch nach letzten sprösslein greifend fehlversprechenden / stängeln im geröll / was soll da wurzeln für halt - und doch kehrt sie zurück die hand / noch blau um einen brocken fels / gekrallt und hinterm ohr ein bund / von silbergrauem kraut / gegen den bösen blick / die sprache hats ihr verschlagen". Indem es Sprachverlust und Störungen derart poetisch dokumentiert, hält Esther Kinskys Werk auch in ihrem jüngsten Band den "Gestörten Geländen" - so der Titel ihrer Grazer Frühlingsvorlesung aus dem Jahr 2023 - etwas entgegen. BEATE TRÖGER
Esther Kinsky: "Heim.Statt". Gedichte.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 155 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.