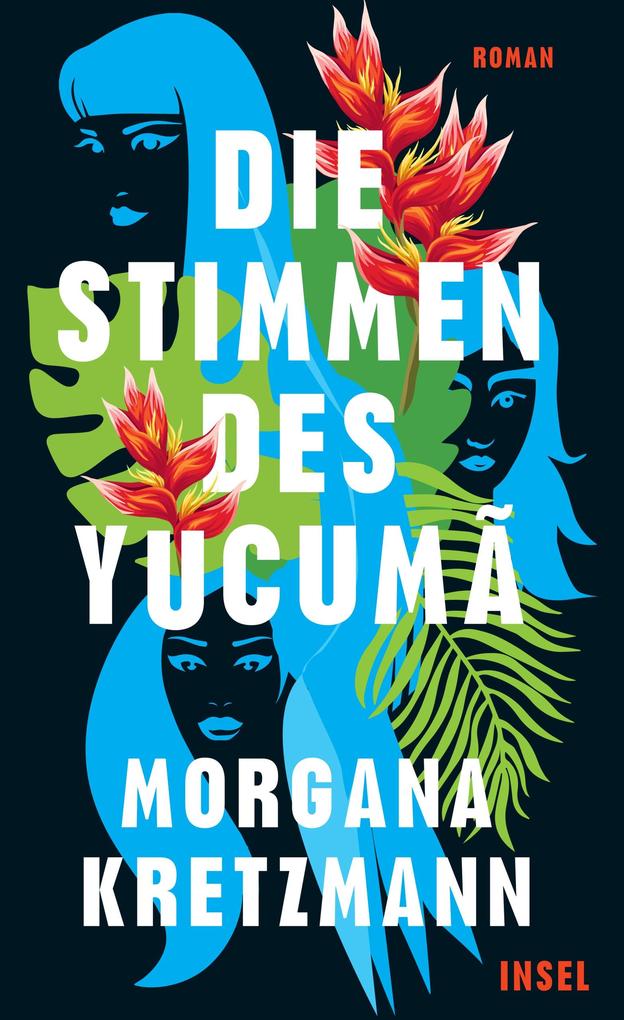
Sofort lieferbar (Download)
Was muss geschehen, damit drei verfeindete Frauen zu Verbündeten werden? Die Stimmen des Yucumã erzählt mit der Wucht eines Wasserfalls von willensstarken Frauen, verfeindeten Familien und einem gemeinsamen Kampf um das Überleben der Natur.
Turvo-Nationalpark, Rio Grande do Sul, an der brasilianisch-argentinischen Grenze: Hier stoßen drei Frauen aufeinander, die gemeinsam aufgewachsen sind und deren Familien sich bis aufs Blut hassen: die Parkrangerin Chaya, ihre Cousine Preta, die Anführerin einer gefürchteten Gruppe von Jägerinnen und Schmugglern, und Olga, die Assistentin eines gierigen Kongressabgeordneten. Ein umstrittenes Bauprojekt, das das gesamte Ökosystem des Parks und der Bewohner in Gefahr bringt, sorgt für ein unerwartetes Wiedersehen der drei Frauen. Nach Jahrzehnte währenden Fehden müssen sie plötzlich für eine gemeinsame Zukunft ihrer Heimat kämpfen. Wer sie dabei immerzu begleitet: der Geist des Urahnen Sarampião, der den Nationalpark vielleicht nie verlassen hat . . .
Produktdetails
Erscheinungsdatum
14. April 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
300
Dateigröße
1,74 MB
Autor/Autorin
Morgana Kretzmann
Übersetzung
Nicolai von Schweder-Schreiner
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
portugiesisch
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783458782957
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Indem sie die Geschichte von drei starken Frauen und deren beinahe mystischer Verbindung zu einem Wald, seinen Tieren und dem Wissen seines Volkes erzählt, gelingt Morgana Kretzmann eine beeindruckende literarische Ökokritik. « Folha de S. Paulo
»Der Naturschutz ist hier das Rohmaterial für eine kraftvolle und mehrstimmige Erzählung, deren Konflikte sich von Seite zu Seite mehr zuspitzen. « Pensar
»Lesenswert ist der Roman Die Stimmen des Yucuma vor allem, weil die Autorin die Probleme und ökologischen Konflikte in einer brasilianischen Grenzregion realistisch schildert. Außerdem wirft sie einen schonungslosen Blick auf korrupte Netzwerke und die schamlose Bereicherung von Politikern. « Victoria Eglau, SWR
». . . die Erzählung [entwickelt] einen Sog, der gleichermaßen populär wie poetisch ist. « Florian Borchmeyer, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Der Naturschutz ist hier das Rohmaterial für eine kraftvolle und mehrstimmige Erzählung, deren Konflikte sich von Seite zu Seite mehr zuspitzen. « Pensar
»Lesenswert ist der Roman Die Stimmen des Yucuma vor allem, weil die Autorin die Probleme und ökologischen Konflikte in einer brasilianischen Grenzregion realistisch schildert. Außerdem wirft sie einen schonungslosen Blick auf korrupte Netzwerke und die schamlose Bereicherung von Politikern. « Victoria Eglau, SWR
». . . die Erzählung [entwickelt] einen Sog, der gleichermaßen populär wie poetisch ist. « Florian Borchmeyer, Frankfurter Allgemeine Zeitung
 Besprechung vom 01.07.2025
Besprechung vom 01.07.2025
Konfliktenergieerzeugung
Morgana Kretzmanns Ökothriller "Die Stimmen des Yucumã" ordnet am Grenzfluss Rio Uruguai Genre- und Geschlechtergrenzen neu.
Nicht mehr als trübes Wasser - "Água turva" - verspricht uns Morgana Kretzmann mit maximaler Lakonik bereits im Titel ihres Romans, der in deutscher Übersetzung exotistisch- poetisierend "Die Stimmen des Yucumã" hörbar zu machen verheißt. Beides verweist auf eine ungewöhnliche Erzählkonstellation. Wahrer Protagonist ist nicht der Mensch, sondern das Wasser - genauer gesagt: der Rio Uruguai (die spanische Schreibweise von Uruguay), der sich an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien parallel zum Ufer in Form des Salto do Yucumã, des breitesten Längswasserfalls der Welt, in die Tiefe stürzt. Ja, der Fluss und sein sedimentgetrübtes Wasser sind die eigentlichen Erzähler des gesamten Werks von Morgana Kretzmann: "Ich bin am Ufer dieses Flusses geboren, barfuß auf der roten Erde, die sein Wasser umgibt. Alle meine Geschichten sind dort entstanden und entstehen dort weiterhin."
Blicken wir auf die Menschen um diesen Fluss, wird das trübe Wasser in Dourado, dem Hauptort der Gegend, schnell zur Metapher. Ihre Schicksale sind über mehrere Generationen hinweg so komplex miteinander verwoben und zugleich durch eine Reihe von Fehden und Schweigekartellen getrennt, dass der Roman wie ein Drama mit einem Personenverzeichnis beginnt. Da ist Chaya, eine Rangerin, die den Turvo-Nationalpark und seine letzten freilebenden Jaguare bis aufs Blut gegen Eindringlinge verteidigt - notfalls mit Waffengewalt. Da ist ihre Cousine Preta, eine postmoderne Stammesmatriarchin, deren Familie auf der Flucht vor Strafverfolgung auf der argentinischen Seite des Flusses eine utopisch-rebellische Räuberbande gegründet hat, die durch Wilderei und Schmuggel immer wieder in Konflikt mit den Verwandten auf der anderen Seite gerät - aber auch in heimliche Komplizenschaft durch undurchsichtige Geschäfte. Und da ist Olga, die Verstoßene. Ehedem floh sie schmachvoll aus Dourado nach Auflehnung gegen die Anstandsregeln der dortigen Gemeinschaft; nun will sie als Journalistin in Porto Alegre arbeiten, muss sich dort jedoch zum Überleben für den korrupten Abgeordneten Heichma verdingen, der ihr halbes Gehalt in die eigene Tasche steckt, und dessen sexuelle Übergriffe erdulden.
Drei Frauen, als Jugendliche Freundinnen, nun aus zunächst schwer fassbaren Gründen verfeindet. Das schlummernde Konfliktpotential bricht doppelt offen aus: Chaya erschießt ungewollt ein wilderndes Mitglied von Pretas Bande, und Olga kehrt auf Geheiß des Abgeordneten nach Dourado zurück, um Propaganda für ein dubioses Staudammprojekt zu machen. Angeblich soll es der ganzen Region Entwicklung und neue Energien bringen - in Wahrheit füllt es nur die Taschen korrupter Unternehmer und Politiker. Den Preis zahlt die Natur: Zerstört wird das Ökosystem des Parks, und mit ihm zerstört werden auch seine Dorfgemeinschaften.
Doch es regt sich Widerstand - bald ausgerechnet durch die von allen brüsk zurückgestoßene Olga selbst. Sie beginnt, die vom trüben Wasser der Komplizenschaft verborgenen Fakten nach und nach ans Licht zu holen. Sichtbar werden dadurch auch die schrecklichen Familiengeheimnisse des Ortes, die immer auf eine nahezu mythische Figur zurückverweisen: den Stammvater Sarampião, den Begründer des Nationalparks, der vor Jahrzehnten beim Schutz eines Jaguars vor einer Jagdgemeinschaft unter mysteriösen Umständen verschwand und nun als Geist seinen Nachfahren schützend zur Seite steht, wenn sie bedroht sind.
Mit dieser Figur gleitet der Ort mitsamt seinem symbolträchtigen Namen "El Dorado" in eine Art magisch-realistisches Macondo im Stil von García Márquez - und macht greifbar, was für ein unwahrscheinlicher Gattungsmix Morgana Kretzmann mit diesem Buch gelingt. Angelegt ist es als Kriminalthriller, der sein Figurenarsenal wie ein Roman noir à la Chandler und Hammett entwickelt. Durch eine korrupte Welt irren der überforderte Polizist, der eigentlich noble Gangsterchef, der sozial marginalisierte Privatermittler. Nur sind all diese klassischen Männerprotagonisten hier durch Frauen ersetzt, die umso größere Energie aufbringen müssen, wenn sie Licht in die Trübnis patriarchal organisierter Komplotte bringen wollen.
Indem Kretzmann ein zutiefst urbanes Genre zur neuen Form des Ökothrillers umschreibt und in eine von Naturgewalten dominierte Peripherie verlagert, verschieben sich die Figuren zugleich vom Krimi zum Western - wo in Gestalt von Parkrangerin, Bandenchefin und freier Journalistin das Trio von Sheriff, Outlaw und Cowboy eine imposante weibliche Wiedergeburt erfährt. Dass dieser Genremix zuweilen in die Klischees jener Heftchenromane abgleitet, deren Elemente collagenhaft zusammengefügt werden, hat oft System - etwa wenn sich die Figuren seitenlange Klippklapp-Wortgefechte liefern. Zuweilen gleitet es auch in Kitschblüten ab: Dann reihen sich Satzhülsen wie "Chaya hüpft das Herz bis zum Hals" oder "Eine starke Frau, die sich von einem schwachen Moment wie diesem nicht entmutigen lassen sollte" aneinander.
Dennoch bewahren selbst diese auch stilistisch schwachen Momente ihren Reiz, weil es Kretzmann - gerade auch damit - gelingt, eine literarisch gefährlichere Falle zu vermeiden: die Dekonstruktion populärer Genres zur bloß blutleeren Montage von Versatzstücken, bei der Klischees vorsätzlich, quasi als Zitat, in ironischen Gänsefüßchen auftreten. Kretzmanns Remix der Populärliteratur ist kein bloß selbstreferenzielles Spiel, sondern authentisch: neue Energie im narrativen Sinn. Damit entwickelt die Erzählung einen Sog, der gleichermaßen populär wie poetisch ist - und im Brasilien des skrupellos korrupten Raubbaus an den Naturressourcen höchst politisch. FLORIAN BORCHMEYER
Morgana Kretzmann: "Die Stimmen des Yucumã". Roman.
Aus dem Portugiesischen von Nicolai von Schweder-Schreiner. Insel Verlag, Berlin 2025. 261 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 28.06.2025
Gier, Ränke, Familienfehden, Geheimnisse, etwas Magischer Realismus und starke Frauen, interessant gemacht
LovelyBooks-Bewertung am 10.06.2025
Ein Öko-Thriller









