Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
15% Rabatt11 auf ausgewählte eReader & tolino Zubehör mit dem Code TOLINO15
Jetzt entdecken
mehr erfahren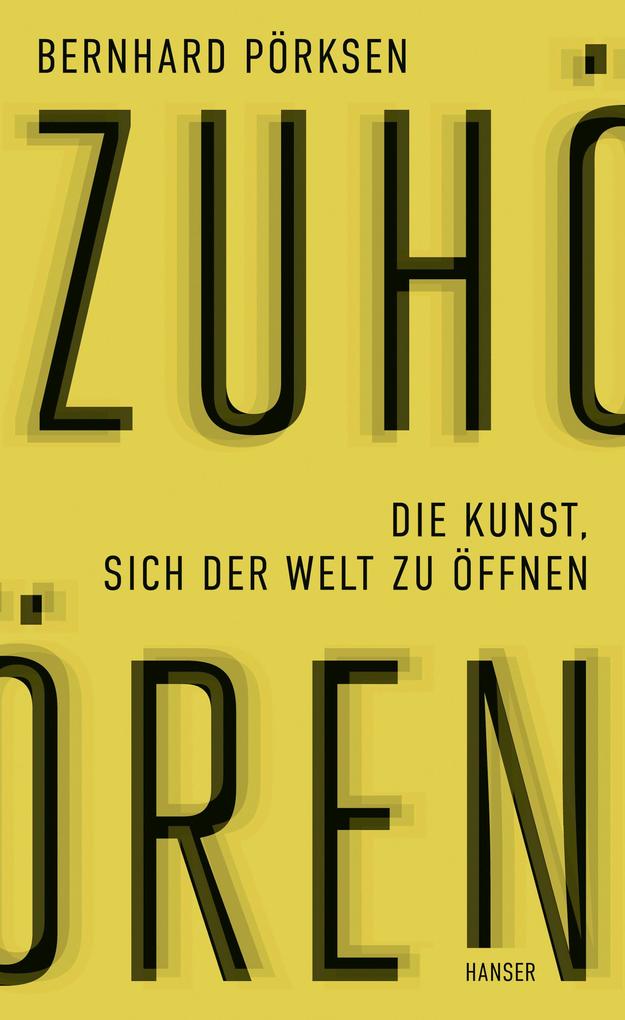
Sofort lieferbar (Download)
Warum hören wir nicht zu? Ein Plädoyer, sich der Welt zu öffnen, von Bernhard Pörksen, der bereits in seinem Buch "Die große Gereiztheit" Wege für positive gesellschaftlichen Debatten aufgezeichnet hat
Zuhören, Gehörtwerden, den Dialog auf Augenhöhe führen - das sind Schlagworte unserer Zeit, Leerformeln der politischen Rhetorik. Aber was heißt es, wirklich zuzuhören, die eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen, sich der Weltsicht des anderen auszusetzen? Warum hört man so lange nicht auf die Opfer sexuellen Missbrauchs, warum nicht auf die Warnungen vor dem Klimawandel? Bernhard Pörksen zeigt, welche Mechanismen das Zuhören verhindern - ob im privaten Umgang oder in der Öffentlichkeit. Und er präsentiert Ansätze und Methoden, die eine neue Offenheit, tieferes Verstehen und empathisches Zuhören ermöglichen. Wie erreicht man, so lautet die Schlüsselfrage, diejenigen, die man nicht mehr erreicht?
Zuhören, Gehörtwerden, den Dialog auf Augenhöhe führen - das sind Schlagworte unserer Zeit, Leerformeln der politischen Rhetorik. Aber was heißt es, wirklich zuzuhören, die eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen, sich der Weltsicht des anderen auszusetzen? Warum hört man so lange nicht auf die Opfer sexuellen Missbrauchs, warum nicht auf die Warnungen vor dem Klimawandel? Bernhard Pörksen zeigt, welche Mechanismen das Zuhören verhindern - ob im privaten Umgang oder in der Öffentlichkeit. Und er präsentiert Ansätze und Methoden, die eine neue Offenheit, tieferes Verstehen und empathisches Zuhören ermöglichen. Wie erreicht man, so lautet die Schlüsselfrage, diejenigen, die man nicht mehr erreicht?
Produktdetails
Erscheinungsdatum
28. Januar 2025
Sprache
deutsch
Untertitel
Die Kunst, sich der Welt zu öffnen.
Seitenanzahl
336
Dateigröße
1,73 MB
Autor/Autorin
Bernhard Pörksen
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783446283589
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Ein Plädoyer für Empathie, jenseits von Patentrezepten und Versöhnungskitsch, und gerade in Zeiten, in denen sich die Mächtigen am allerliebsten selbst zuhören, von erschreckender Aktualität. « Sacha Batthyany, NZZ am Sonntag, 30. 03. 25
»Bernhard Pörksen hat an diesem Buch zehn Jahre gearbeitet. Und ich muss jetzt beim Lesen sagen: Man merkt es. « Sieglinde Geisel, DLF Lesart, 01. 03. 25
»Der Mensch hört in zwei Modi, meistens mit dem Ich-Ohr, selten mit dem Du-Ohr. Das Ich-Ohr hört nur, um bestätigt zu werden, was es eh schon denkt und fu hlt. Das Du-Ohr dagegen öffnet sich seinem Gegenu ber und der Welt. Wie kann man wirklich anderen zuhören? Das ist die Frage, die der Tu binger Medienwissenschaftler in diesem brillanten Buch untersucht. « tazFuturzwei, 11. 03. 25
»Der Medienwissenschaftler füllt den Begriff so meisterhaft mit Leben, dass das Buch zum Wegweiser taugt, wie Kommunikation gelingen kann. Ein wunderbares, immer wieder abwägendes Buch. « Vera Linß, DLF Kultur, 23. 01. 25
»Der gelungene Versuch, die Basis unserer Kommunikation zu vermessen. « Bettina Baltschev, MDR Kultur, 31. 01. 25
»Ein feinsinniges Buch, das darüber nachdenkt, wem aus welchen Gründen zugehört wird, weshalb wir wann weghören und was gemeint ist, wenn Menschen darum bitten, dass ihnen endlich Gehör geschenkt werde. Zuhören als Akt der Freiheit und damit auch der Verantwortung - so deutlich habe ich das nie gesehen. Ein lehrreiches Buch. « Barbara Bleisch, SRF Sternstunde Philosophie, 09. 02. 25
»Bernhard Pörksen hat an diesem Buch zehn Jahre gearbeitet. Und ich muss jetzt beim Lesen sagen: Man merkt es. « Sieglinde Geisel, DLF Lesart, 01. 03. 25
»Der Mensch hört in zwei Modi, meistens mit dem Ich-Ohr, selten mit dem Du-Ohr. Das Ich-Ohr hört nur, um bestätigt zu werden, was es eh schon denkt und fu hlt. Das Du-Ohr dagegen öffnet sich seinem Gegenu ber und der Welt. Wie kann man wirklich anderen zuhören? Das ist die Frage, die der Tu binger Medienwissenschaftler in diesem brillanten Buch untersucht. « tazFuturzwei, 11. 03. 25
»Der Medienwissenschaftler füllt den Begriff so meisterhaft mit Leben, dass das Buch zum Wegweiser taugt, wie Kommunikation gelingen kann. Ein wunderbares, immer wieder abwägendes Buch. « Vera Linß, DLF Kultur, 23. 01. 25
»Der gelungene Versuch, die Basis unserer Kommunikation zu vermessen. « Bettina Baltschev, MDR Kultur, 31. 01. 25
»Ein feinsinniges Buch, das darüber nachdenkt, wem aus welchen Gründen zugehört wird, weshalb wir wann weghören und was gemeint ist, wenn Menschen darum bitten, dass ihnen endlich Gehör geschenkt werde. Zuhören als Akt der Freiheit und damit auch der Verantwortung - so deutlich habe ich das nie gesehen. Ein lehrreiches Buch. « Barbara Bleisch, SRF Sternstunde Philosophie, 09. 02. 25
 Besprechung vom 12.07.2025
Besprechung vom 12.07.2025
Gefühlvoll
Bernhard Pörksen weiß von einer Tugend
Gesellschaftliche Debatten sind Bernhard Pörksen zufolge immer stärker von Vorverurteilungen geprägt: Querdenker und Impffanatiker, woke Linke und alte weiße Männer, Russlandfreunde und die Ukraine unterstützende Kriegstreiber stehen sich, so der Medienwissenschaftler, unvereinbar gegenüber. Sie alle meinen zu wissen, was von der jeweiligen Gegenseite zu erwarten ist. Das Ergebnis: Pattsituationen in Diskussionen und gesellschaftliche Polarisierung. Wie ist das zu überwinden? In seinem Buch plädiert Pörksen, der Titel zeigt es an, für die Tugend des Zuhörens.
Um herauszufinden, wie Kommunikation funktionieren oder scheitern kann, fährt er zur Odenwaldschule, an der sich der Reformpädagoge Gerold Becker über Jahre an Schülern verging, und redet mit Margarita Kaufmann, die als Schulleiterin zur Aufklärung des Skandals beigetragen hat. Er spricht mit dem Ukrainer Misha Katsurin, der wegen des Krieges den Kontakt zu seinem in Russland lebenden Vater verloren hat. Im Silicon Valley widmet er sich der Frage, wie sich das Internet zum Ort der Kommerzialisierung und der Häme wandeln konnte. Zuletzt unterhält er sich mit Klimaaktivisten darüber, warum viele Menschen die seit Jahrzehnten bekannten Gefahren der Erderwärmung weitestgehend ignorieren.
Eine von Pörksens Thesen lautet: "Wir hören, was wir fühlen." Das anzuerkennen, bedeute, "von sich zu sprechen, sich berührbar zu zeigen, verbunden mit der Welt, die man beschreibt". Die Warnungen vor dem Klimawandel beispielsweise erscheinen neben Versprechungen des Konsums wenig attraktiv. Um auf die kritische Erderwärmung aufmerksam zu machen und diese zu stoppen, brauche es folglich Bilder, persönliche Geschichten und vertrauensvolle Botschafter - beispielsweise Kinder, die mit ihren Eltern und Großeltern sprechen.
Emotionale und eindringliche Erzählungen, die wir ohnehin schon sympathisch finden, bekommen viel Aufmerksamkeit, auch dann, wenn sie argumentativ schwächer sind als andere. Pörksens favorisierte Erzählformen folgen dieser Logik, und er reagiert auf das Problem mit dem Konzept des Ich- und Du-Ohrs. Das Ich-Ohr ist limitiert durch die eigene Weltanschauung: Anstatt andere Perspektiven kennenlernen oder eine andere Person verstehen zu wollen, wirken persönliche Auffassungen und Interessen wie ein Filter, der Unerwünschtes ausblendet. Beim Du-Ohr, so Pörksen, tritt die persönliche Perspektive in den Hintergrund: Der Zuhörer bemüht sich, in die Welt des anderen einzutauchen. Die Gesellschaft, so der fromme Wunsch, müsse wieder mehr mit dem Du-Ohr zuhören, um gegenseitiges Verständnis zu fördern.
Allerdings hat der Autor die Auswahl seiner Gesprächspartner für das Buch, denen er mit dem Du-Ohr lauschen will, einseitig getroffen. Sie stehen ausnahmslos auf der moralisch richtigen Seite. Deswegen schreibt Pörksen - eine Art argumentativer Notausgang -, niemand könne gezwungen werden, zuzuhören. Es liege im eigenen Ermessen, wem man Gehör schenkt. Nach welchen Maßstäben der Autor bestimmt, wem er zuhören möchte und wem nicht - das bleibt bis zuletzt unklar. GRETA ZIEGER
Bernhard Pörksen: "Zuhören". Die Kunst, sich der Welt zu öffnen.
Carl Hanser Verlag, München 2025. 336 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








