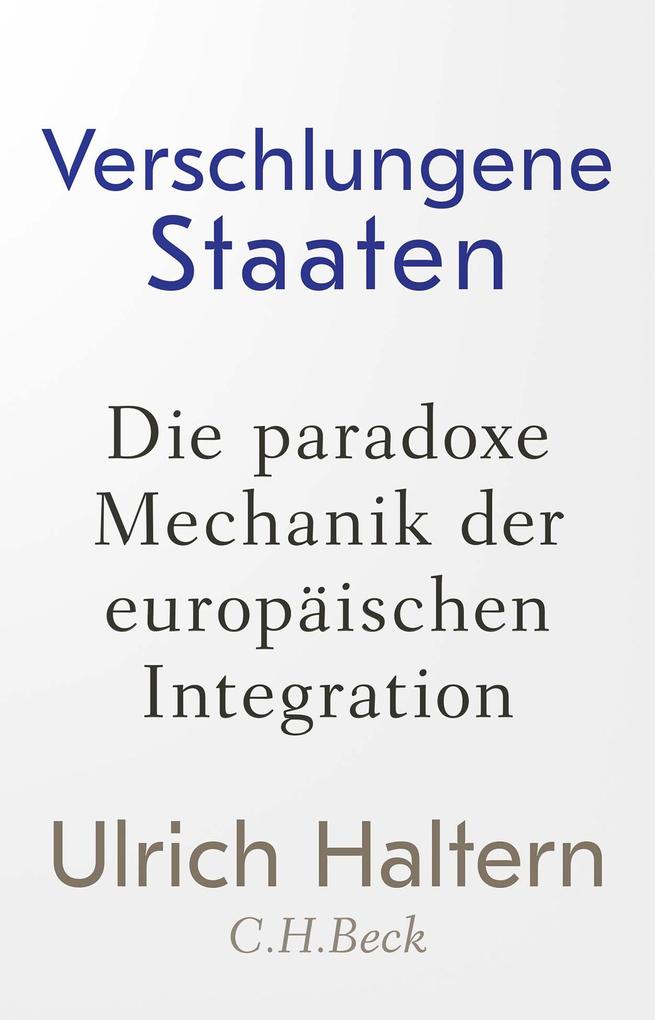Besprechung vom 11.11.2025
Besprechung vom 11.11.2025
Europas unerwartete Folgen
Ulrich Haltern untersucht die Übertragung von Kompetenzen an die EU. Herauskam selten das, was die Staaten ursprünglich wollten.
Wenn es darum geht, das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten begrifflich zu fassen, stößt man regelmäßig auf zwei entgegengesetzte Deutungen. Die eine stellt die staatliche Souveränität ins Zentrum und sieht die europäische Ebene als Handlungsraum, der zwar nach Autonomie strebt, aber deshalb umso enger eingehegt werden muss. Die andere sieht den Nationalstaat als defizitäre Ordnung, die den grenzüberschreitenden Herausforderungen nicht mehr gerecht werden kann, weshalb die europäische Ebene zum eigentlichen Raum von Politik und Rechtsetzung werden muss. Es ist die Stärke des rechtstheoretischen Ansatzes von Ulrich Haltern, dass er aus diesem Entweder-oder ausbricht und so die vielen Spannungen zwischen nationaler und europäischer Politik wie Gesetzgebung analysieren kann, ohne sie nach einer Seite hin aufzulösen.
Die europäische Integration beschreibt Haltern, der in München Öffentliches Recht, Europarecht und Rechtsphilosophie lehrt, als Prozess in drei Akten. Im ersten Akt überführen die Mitgliedstaaten - nicht selten widerstrebend - Entscheidungsbefugnisse auf die europäische Ebene, um Probleme besser und wirksamer lösen zu können. Im zweiten Akt führt diese Emanzipation jedoch zu einer gegenläufigen Entwicklung: Die europäische Ebene wird massiv gestärkt, mal unter aktiver Mitwirkung der Staaten, mal durch eigenmächtiges Handeln der EU-Institutionen. Im dritten Akt werden die Staaten mit den unerwarteten und unbeabsichtigten Konsequenzen ihrer Kompetenzübertragung konfrontiert. Diese Ambivalenz führt zu Spannungen, die nicht aufzulösen sind, wohl aber politisch und rechtlich gemanagt werden müssen.
Das beste Beispiel dafür ist der Übergang von der Einstimmigkeit im Rat zu Mehrheitsentscheidungen als Regelfall europäischer Gesetzgebung. In der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war zwar schon eine schrittweise Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen festgelegt, um den gemeinsamen Binnenmarkt zu errichten. Doch sträubte sich Frankreich in der Agrarpolitik dagegen, nahm nicht mehr am Rat der Mitgliedstaaten teil und legte ihn damit lahm. Diese Politik des leeren Stuhls mündete 1996 in den Luxemburger Kompromiss. Der stellte Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit unter den Vorbehalt, dass ein Staat nicht ohne Weiteres überstimmt werden durfte, wenn er "sehr wichtige Interessen" geltend machte. Dadurch verlor der Rat jedoch stark an Handlungsfähigkeit, zumal sich die Zahl der Mitgliedstaaten auf zwölf verdoppelte. Daraufhin wurde das Mehrheitsprinzip mit der ersten Vertragsreform von 1986 gestärkt und effektiv durchgesetzt - der erste Akt.
In der Folge wurden viel mehr Entscheidungen auf europäischer Ebene getroffen. Mit dem Vertrag von Lissabon 2009 wurden Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit im Rat zur Regel - der zweite Akt. Allerdings führte dies im dritten Akt zu erheblichen Spannungen. So entstand ein Demokratieproblem, weil die Regierungen in Brüssel Gesetze beschließen, dafür aber innerstaatlich nicht mehr parlamentarisch zur Verantwortung gezogen werden können.
Zwar wurde auch das Europäische Parlament als Mitgesetzgeber gestärkt, doch weist Haltern zu Recht daraufhin, dass die politische Heimat der Bürger nach wie vor ihr Staat und nicht die Union sei.
In die so entstandene Legitimationslücke stieß das Bundesverfassungsgericht, indem es für sich die Prüfung beanspruchte, ob Unionsorgane ihre Kompetenzen überschreiten. Das führte schließlich im Jahr 2020 zu jener umstrittenen Entscheidung, mit der die Karlsruher Richter ein Staatsanleihekaufprogramm der EZB für rechtswidrig erklärten und zugleich den Vorrang des Europarechts bestritten. Haltern beleuchtet diese Entscheidung aus unterschiedlichen Perspektiven. Er kritisiert den Furor der deutschen Richter und arbeitet argumentative Schwächen in ihrem Urteil heraus. Andererseits kreidet er aber auch dem Europäischen Gerichtshof eine dogmatische Haltung an, weil er die höhere demokratische Legitimation des Bundesverfassungsgerichts verkenne. Zudem verweist er auf die fast einhellige Überzeugung in den Mitgliedstaaten, dass die Art und Weise, wie sich Unionsrecht in die nationale Rechtsordnung einfüge, durch das nationale Verfassungsrecht bestimmt werde.
Dieses Urteil hätte die europäische Integration sprengen können, weil es mit politisch gefärbten Urteilen des polnischen Verfassungsgerichts zusammenfiel, welche den Vorrang europäischen Rechts grundsätzlich bestritten und damit die gemeinsame Rechtsordnung infrage stellten. Tatsächlich ist es dann aber doch ein Beispiel für kluges Spannungsmanagement geworden.
Die Bundesregierung beendete das von der Kommission begonnene Vertragsverletzungsverfahren, indem sie grundsätzlich den Anwendungsvorrang des Europarechts bekundete, während Karlsruhe zwei Jahre später den Eigenmittelbeschluss, mit dem der Corona-Wiederaufbaufonds ermöglicht wurde, weniger streng beurteilte. So wurde nicht nur der Primat einer europafreundlichen Politik wiederhergestellt. Letztlich gewann auch Karlsruhe dadurch Autorität zurück, dass es Leitplanken einzog, statt einfach die Straße zu sperren.
Es ist eine Stärke von Halterns Ansatz, dass er die politische Bedingtheit der Rechtsprechung herausarbeitet. Er gelangt auch sonst zu allerlei bemerkenswerten Einsichten. Das betrifft etwa die zentrale Bedeutung des Vorlageverfahrens, mit dem untere nationale Gerichte den EuGH in Vertragsverfahren und Angelegenheiten, die Unionsentscheidungen betreffen, einschalten können, während letztinstanzliche Gerichte dies tun müssen. Dem EuGH sichert es eine Durchgriffstiefe, die er sonst niemals hätte, während es den Einfluss unterer Gerichte auf wichtige Rechtsfragen erhöht. Daraus ist eine erstaunliche Symbiose entstanden - mehr als ein Fünftel aller Vorabentscheidungsersuchen kommen aus Deutschland, obwohl gerade Karlsruhe mit der Vorlagepflicht hadert.
Der Autor zieht daraus die Schlussfolgerung, dass "die Stärkung der institutionellen Stellung des EuGH gegenüber deutschen Gerichten und des materiellen Einflusses des Unionsrechts auf das deutsche Recht (...) auch in besonderem Maße das Werk der deutschen Gerichte" sei. Das verweist auf jene "paradoxe Mechanik der europäischen Integration", die Haltern in den Blick nimmt. Der Titel des Buches führt allerdings etwas in die Irre: Verschlungen sind in der Optik des Autors nicht die Staaten untereinander, sondern zwei Stränge, die staatsrechtliche und die unionsrechtliche Ordnung. THOMAS GUTSCHKER
Ulrich Haltern: Verschlungene Staaten. Die paradoxe Mechanik der europäischen Integration.
Verlag C.H.Beck, München 2025. 303 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.