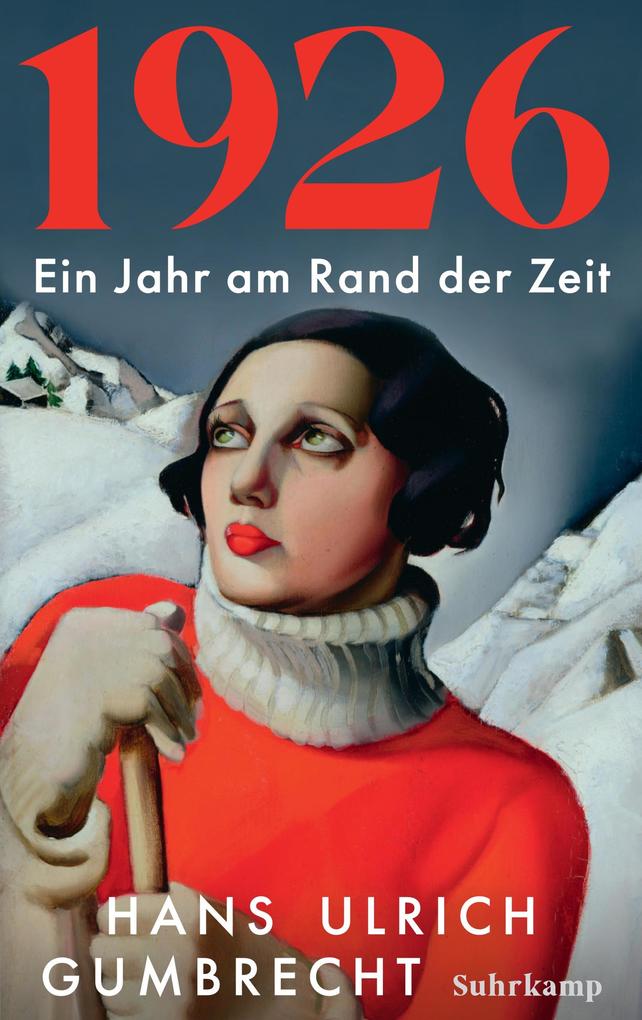Besprechung vom 30.09.2025
Besprechung vom 30.09.2025
Was sich von Weimar lernen lässt
In der Politik haben Vergleiche mit der Weimarer Republik derzeit Konjunktur. Historiker sind überwiegend skeptisch. Diese vier Bücher helfen weiter.
Die Frage, wieweit sich aus "Weimarer Erfahrungen" lernen lässt, ist aktuell, aber umstritten. Gerade Historiker sind überwiegend skeptisch. Sie verweisen auf die Einmaligkeit geschichtlicher Konstellationen und die Gefahren allzu normativ unterlegter Parallelisierungen. Auch ist in der neueren Weimar-Forschung die früher dominante Frage nach den Ursachen des Scheiterns in den Hintergrund getreten. Wichtiger wurden etwa Untersuchungen zur kulturellen Moderne und ihren Erfahrungsräumen. Dies erzeugte eine Kluft zwischen der Geschichtsschreibung und der öffentlich verhandelten Frage nach der Gegenwartsrelevanz Weimars. Um hier klarer zu sehen, lohnt sich ein Blick in die ältere wie die neuere Literatur.
Hans Ulrich Gumbrechts Werk "1926. Ein Jahr am Rand der Zeit", erschienen 1997 (englisch) und 2003 (deutsch), verzichtet bewusst auf jeden Bezug zum Jahr 1933. Der Autor möchte die Leser völlig in das Jahr 1926 eintauchen lassen; die Kategorien Kausalität und Entwicklung schiebt er dagegen robust beiseite. Um 2000, als die großen Geschichtserzählungen dekonstruiert wurden, schlug die Stunde des Kontingenten, des Nicht-Relationalen und Nicht-Linearen. Relevant war nicht der Blickwinkel der Gegenwart, sondern allein die erzählerische Repräsentation der Vergangenheit. Zu ihr bestand keine Verbindung und damit auch kein geschichtlicher Interpretationsrahmen.
Gumbrecht schildert in einzelnen Einträgen die vielfältige, sinnlich fassbare Alltagswelt. So stehen Bars und Revuen neben der Entwicklung des Flugzeugs und des Automobils. Lichtspielhäuser und Filmstars, Boxen und Radsport gesellen sich zu den Mühen des Fließbands und den Lohnstreiks der Arbeiter. Zusammengehalten wird das Disparate durch zeittypisch-synchrone, zugleich fragile Codes wie die Sehnsucht nach Authentizität oder die allgegenwärtige Geschlechterpolarität. Konsequent verwirft Gumbrecht die Vorstellung, man könne "aus der Geschichte lernen". Gerade Berufshistoriker müssten erkennen, dass die Zeit der pädagogischen Rituale und der sterilen Festansprachen vorüber sei. Zwar wirkt dieser Versuch, die Vergangenheit von der Gegenwart radikal zu entkoppeln, auf den ersten Blick bestechend, aber er beruht auf einem präsentistischen Fehlschluss.
Denn unverkennbar spiegeln sich im "Jahre 1926" eben doch unsere ganz gegenwärtigen Erfahrungen mit beschleunigter Modernisierung, einer überbordenden Flut von Medien, Bildern und anderen Sinnesreizen und nicht zuletzt auch die Unsicherheit über den eigenen Ort in der Geschichte. Insofern ist das Buch ein sprechendes Beispiel für die Zeitgebundenheit auch der "postmodernen" Erzeugnisse. Denn in der neoliberalen Epoche der Globalisierung zählte der Erkenntniswert der Vergangenheit tatsächlich kaum etwas. Heute dagegen, im Angesicht neuer Demokratiefeindschaft, ist die öffentliche Nachfrage nach möglichen Lehren der Geschichte und ihrem hermeneutischen Zusammenhang mit der Gegenwart wieder höchst lebendig geworden.
Erneut in den Mittelpunkt rückt daher ein echter Klassiker, nämlich Karl Dietrich Brachers "Auflösung der Weimarer Republik". 1955 erschienen und vielfach neu aufgelegt, ist das Buch ein Standardwerk zur Geschichte des Demokratieverlusts. Im Zentrum steht die Aufgabe der parlamentarischen Macht durch den Reichstag, das damit entstehende Machtvakuum und dessen Füllung durch den Reichspräsidenten und seine Kamarilla. Diesen Prozess begriff Bracher als "ein in bestimmten Grenzen 'typisches' Modell für die Probleme der Erringung und Erhaltung, des Abbaus und Verlusts politischer Macht".
Brachers Darstellung liest sich wie ein historischer Kommentar dazu, warum das Grundgesetz die politische Willensbildung exklusiv an den Parteienparlamentarismus band. Keinesfalls sollte die Bundesrepublik wie der Weimarer Staat über eine "präsidiale Reserveverfassung" verfügen, die in Zeiten multipler Krisen den Weg in die Diktatur würde ebnen können. Für Bracher kam es vor allem auf die politischen Parteien an. Demzufolge gab es keine ausweglose "Krise des Parteienstaates" (Werner Conze) und keine politische Sackgasse, sondern eine durchaus offene Situation, die allerdings von konkreten Partei- und Machtinteressen abhing.
So scheiterte die Große Koalition im März 1930 daran, dass sich die SPD-Führung dem Willen ihrer Mitgliederschaft und der Gewerkschaften unterwarf, während zugleich die wirtschaftsnahe Deutsche Volkspartei aus interessenpolitischen Gründen aus der parlamentarischen Regierung herausdrängte. Dies war, so Bracher, eine ",tragische' Schuld" der Parteien, die damit die "erste Stufe der Auflösung" der Weimarer Demokratie auslösten.
Die heutigen demokratischen Parteien besitzen zweifellos einen starken Willen zur parlamentarischen Macht. Eine andere Frage betrifft aber ihre Fähigkeit, über den Tellerrand der Parteiräson hinaus zu blicken, übergreifende politische Führung anzubieten und sie dann auch zu beglaubigen. Hier liegt die entscheidende, vielleicht existenzielle Zukunftsaufgabe der demokratischen Parteien. Erfüllen sie sie nicht, gewinnt Weimars Warnung an Brisanz: Denn der damalige fatale Kreislauf zwischen parlamentarischem Funktionsverlust, Delegitimierung der parlamentarischen Demokratie und dem korrespondierenden Ruf nach autoritären Alternativen bleibt ein Paradigma für die Selbstgefährdung der Demokratie. Das gilt allemal für das heutige Deutschland, das die historische Komfortzone der demokratischen Volksparteien längst verlassen hat und in dem sich erneut ein polarisiertes Vielparteiensystem etabliert.
Bracher und Gumbrecht bilden gleichsam die äußersten Pole der möglichen Weimar-Geschichtsschreibung: dort ein Buch, das ausschließlich unter der Frage nach ihrem Scheitern steht; hier eine geschichtliche Vergegenwärtigung, die den Blick auf 1933 systematisch und konzeptionell ausblendet. Neuere Forschungen bewegen sich meist irgendwo dazwischen. Sie stellen konkrete Fragen an abgegrenzte Gegenstände, weichen aber der Diskussion übergeordneter, gegenwartsrelevanter Erkenntnisse nicht aus.
Im Besonderen gilt dies für die großen Themen der Weimarer Wirtschafts- und Sozialgeschichte wie Inflation und Rationalisierung, Deflation und Bankenkrise, Sozialstaat und Konjunkturschwäche. Über sie informiert zuverlässig das Studienbuch von Heike Knortz über "Deutsche Wirtschaftsgeschichte der Weimarer Zeit". Zwar erzeugt materielle Not allein noch keinen Radikalismus; dieser entsteht nicht ohne spezifische politisch-kulturelle Deutungsmuster. Aber niemand wird leugnen, dass Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit eine eminente Rolle für Hitlers Aufstieg spielten.
Auch wenn sich die Bundesrepublik wirtschaftlich fundamental von der Weimarer Erfahrung unterscheidet, weist Heike Knortz auf die paradigmatischen Aspekte ihres Themas hin. Auch die Wirtschaftsgeschichte der Weimarer Republik sei insofern ein "Lehrstück", als sie exemplarisch zeige, wie sich ein Staat durch übermäßige Verschuldung und sozialpolitische Überregulierung seiner Handlungsmöglichkeiten beraubt. Am Ende könne dieser Prozess "trotz wohlgemeinter Fürsorge" schnell in ein "Staatsversagen" münden.
Diese unverkennbar aktualitätsbezogenen Schlussfolgerungen führen mitten hinein in die Konflikte unserer Gegenwart. Man muss sie nicht unbedingt teilen, und ob Weimars Wirtschaft mit ihren so spezifischen Kriegsfolgelasten tatsächlich als Lehrstück taugt, bleibt fraglich. Aber die Weimarer Republik liefert weiterhin wichtige Erkenntnisse für das Verständnis der Beziehungen zwischen Staat und Wirtschaft, Gesellschaft und Individuum. Neben Kultur, Politik und Wirtschaft ist das Rechtswesen ein zentrales Subsystem jeder Demokratie. Dass die Justiz dem Weimarer Staat überwiegend kritisch gegenüberstand, ist bekannt. Wie problematisch aber ein allzu kurzschrittiges "Lernen aus der Geschichte" sein kann, weist das Buch des brasilianischen Juristen Rodrigo Borges Valadão nach.
Denn die "Bête noire" in der innerjuristischen Diskussion über das Scheitern der Weimarer Republik war lange Zeit der sogenannte Rechtspositivismus. Extrem einflussreich war zunächst die Kritik des früheren sozialdemokratischen Reichsjustizministers Gustav Radbruch. Schon 1945 meinte er, das formalistisch-ausschließliche Festhalten der Juristen am positiv gesetzten Recht, das keine andere Rechtsquelle akzeptiere, daher jedes Gesetz befolge und Recht und Moral epistemisch voneinander trenne, habe die Juristen gegenüber dem Pseudolegalismus des NS-Unrechtsstaates "wehrlos" gemacht.
Der Autor unterstreicht, dass es sich umgekehrt verhielt: Die überzeugten Republikaner wie Hans Kelsen, Richard Thoma und Gerhard Anschütz, waren durchweg Positivisten. Indes traf sie nach Weltkrieg und Revolution der Vorwurf, politische Begleitumstände und legitime Bedürfnisse des deutschen Volkes mit dem formalistischen Verweis auf die geltende Rechtsordnung abzublocken. Hinter dieser Kritik standen ausgesprochene Antipositivisten wie Carl Schmitt, Erich Kaufmann, und Ernst Rudolf Huber, aber auch zahllose Richter, die das formelle Recht der Republik dem "Lügengeist" des Parlamentarismus zurechneten. Die wirklichen Steigbügelhalter Hitlers waren mithin jene demokratiefeindlichen Antipositivisten, die republikanische Gesetzestreue durch "höherwertige" völkische Rechtsquellen zu ersetzen suchten.
Heute steht die Dialektik zwischen gesetztem Recht und dem möglichen Rekurs auf überpositive, naturrechtliche Rechtsquellen auf andere Weise wieder auf der Tagesordnung. Dem Grundgesetz selbst wurde diese Spannung ja mit seiner "Ewigkeitsklausel" eingeschrieben. Die Existenz des Rechtsextremismus wirft die alte Frage neu auf, wieweit die "wehrhafte Demokratie" auch ihren Feinden die ungeschmälerten "positiven" Freiheitsrechte samt deren verfassungsgerichtlicher Interpretation zugestehen kann. Heute stellt sich diese Frage nicht nur in dem großen und wohl zu abstrakten Thema eines Verbots der AfD.
Vielmehr geht es um die Pragmatik der kleinen Schritte: Stellen rechtsextreme Demonstrationen per se möglicherweise eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar? Können sie mit dieser Begründung verboten oder mit starken Auflagen versehen werden? Wieweit sollte der Handlungsspielraum von Verfassungsfeinden beschränkt werden? Konfrontiert mit solchen und anderen Fragen muss die Justiz abwägen zwischen der Positivität der Grundrechte, deren Gebrauch sich gegen die Demokratie selbst zu wenden droht, und den überpositiven Quellen des Grundgesetzes. Wenn Letztere die freiheitliche Demokratie schützen sollen, dann können sie gegenüber den Extremisten auch grundrechtliche Einschränkungen legitimieren.
Zwar ist dies eine dilemmatische Situation, für die der Streit um den Rechtspositivismus der Weimarer Zeit kaum konkrete Lehren bereithält. Aber die erneut aufscheinende Verletzlichkeit der Demokratie bleibt ein Jahrhundertthema. Sie zeigt, wie viel uns die Geschichte der Weimarer Republik auch heute noch zu sagen hat. ANDREAS WIRSCHING
Hans Ulrich Gumbrecht: 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 554 S., 20,- Euro.
Karl Dietrich Bracher: Die Auflösung der Weimarer Republik.
Droste Taschenbücher
Geschichte, Düsseldorf 1984. 710 S., 47,74 Euro. (Erhältlich über booklooker.de).
Heike Knortz: Deutsche Wirtschaftsgeschichte der Weimarer Zeit.
UTB, Stuttgart 2021. 352 S., 30,- Euro.
Rodrigo Borges Valadão: Rechtspositivismus und Nationalsozialismus. Entstehung, Widerlegung und Überwindung der Positivismuslegende.
Duncker & Humblot, Berlin 2024. 396 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.