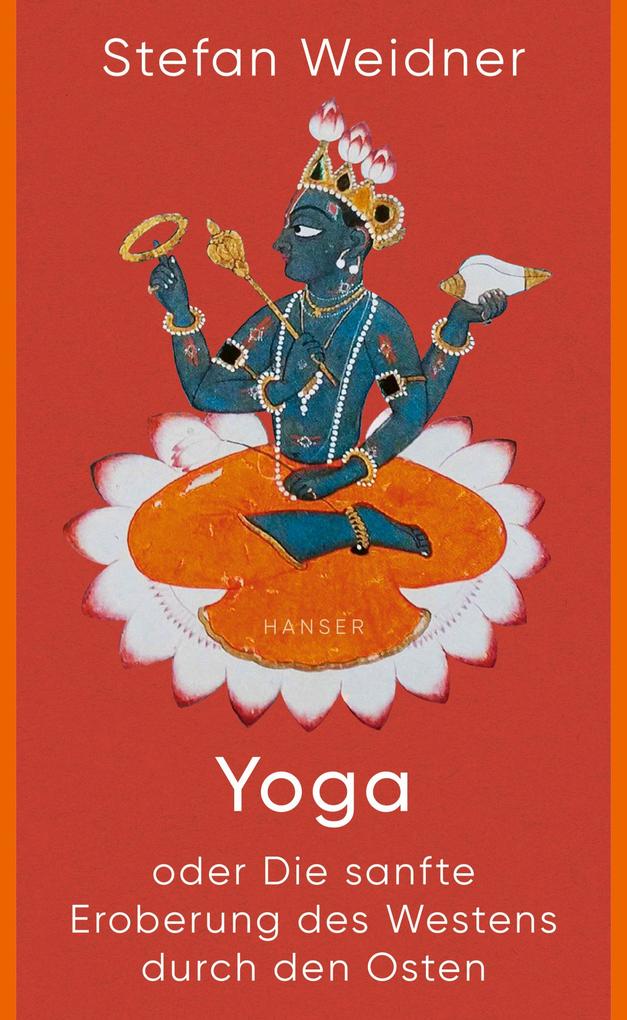Besprechung vom 12.10.2025
Besprechung vom 12.10.2025
Wie Yoga in die Welt kam
Mit den Körperübungen erreicht ein frühes kosmopolitisches Denken den Westen: Stefan Weidner stellt die Vorgeschichte des Massenphänomens dar.
Von Mark Siemons
Das Interesse des Westens an Yoga fing früher an, als man meinen sollte. Schon Alexander der Große wollte auf seinem Indienfeldzug, als er im Fünfstromland angekommen war, die legendären Gymnosophen kennenlernen, von denen man ihm gesagt hatte, dass sie in der Nähe hausten. Doch die nackten Weisen entgegneten Alexanders Gesandten und seiner Gesprächseinladung, sie würden lieber dort bleiben, wo sie sind. Also schickte Alexander, um in einen Gedankenaustausch zu kommen, eigens einen professionellen Philosophen, den Kyniker Onesicritus. Dieser fand laut dem Geschichtsschreiber Strabo fünfzehn nackte Männer vor, die in unterschiedlichen Stellungen unter der brennenden Sonne verharrten. Als der Philosoph sein Interesse an einem Dialog bekundete, forderten ihn die Männer auf, sich erst einmal auszuziehen und nackt auf einen Stein zu legen, dann könne man weitersehen.
Spätere Yogis zeigten eine aktivere Bereitschaft zum Kulturaustausch, wie Stefan Weidners neues Buch, das auch diese Alexander-Anekdote überliefert, deutlich macht. Ein Schlüsseldatum für den nachfolgenden Triumph von Yoga im Westen war der 11. September 1893. An diesem Tag trat der indische Wandermönch Swami Vivekananda auf dem "Weltparlament der Religionen" in Chicago auf, einer Begleitveranstaltung der Weltausstellung, die eigentlich die Überlegenheit des Westens und dessen Fortschrittsvorstellungen erweisen sollte. Doch unverhofft geschah etwas ganz anderes. Der mit rotem Turban und violetter Robe erscheinende Inder verkündete mit seiner jugendlichen Energie dem amerikanischen Publikum eine Botschaft, nach der es sich insgeheim sehnte: eine Religion, die alle anderen Religionen in sich umfasst und keine ausschließt, eine "Mutter der Religionen" gewissermaßen, die einen praktischen Weg verheißt, wie sich Gott nicht bloß denken, sondern buchstäblich "erfahren" lasse. Yoga sei eine verlässliche Methode, um die illusionäre Welt des Maya zu verlassen und jenes "Selbst" (Atman) zu realisieren, mit dem man Anteil am göttlichen großen Ganzen, am Brahman, habe.
Vivekananda wurde zum Überraschungsstar des Weltparlaments. Man hätte denken können, da sei eine urtümliche Lehre aus unvordenklicher geographischer und zeitlicher Ferne unversehens in die westliche Moderne eingebrochen. Doch dieser Eindruck trügt: Was Weidners Buch mit großer Sorgfalt demonstriert, ist, dass schon das, was Vivekananda verkündete, in Wirklichkeit das Ergebnis jahrhundertelanger kultureller Begegnungen, Anpassungen und Überformungen war.
Der Islamwissenschaftler spannt dabei einen weiteren Bogen, als man von dem Titel "Yoga oder Die sanfte Eroberung des Westens durch den Osten" her annehmen würde. "Yoga" ist für ihn nicht bloß eine speziell indische Geistes- und Körperübung, sondern der "Codename" für die "schöne alte Mystik und Philosophie, die Europa überwunden zu haben glaubte" und die nun "im indischen Kleid heimlich, still und leise" in den Westen zurückgekehrt sei. Vorausgesetzt ist dabei, dass die verschiedenen hinduistischen, muslimischen und christlichen Traditionen im Lauf der Geschichte nur deshalb immer wieder in einen so engen Austausch rund um die Yoga-Rezeption kommen konnten, weil sie alle einen gemeinsamen Erfahrungskern hatten. Der spirituelle, auf die intuitive Erkenntnis eines alles überwölbenden Zusammenhangs zielende Hintergrund dieser Erfahrung sei für den heutigen Westen jedoch kaum noch nachzuvollziehen, schreibt Weidner: "Wir, die vom medialen Maya kontaminierten Menschen des 21. Jahrhunderts, sind Experten im Vergessen und Verdrängen von Kenntnissen, die Früheren und Anderen längst geläufig waren."
Das Buch will nun eine Anamnese, eine "Wiedererinnerung" des Verdrängten leisten, indem es die Geschichte der wechselseitigen Berührungen am Beispiel von Yoga rekonstruiert. In den USA des 19. Jahrhunderts findet Weidner etwa intellektuelle Zirkel vor, die vom "Transzendentalismus" eines Ralph Waldo Emerson und eines Henry David Thoreau geprägt waren und bei denen er eine "Verbindung zur orientalischen, indischen, neuplatonischen Mystik" feststellt. "Ich bade morgens meinen Geist in der wunderbaren, kosmogonischen Philosophie der Bhagavad-Gita", schrieb Thoreau in seinem Buch "Walden". Der perfekt Englisch sprechende Vivekananda hatte sich vor seinem großen Auftritt mit diesem amerikanischen Synkretismus vertraut machen und sich auf ihn einstellen können.
Er selbst war als Mitglied der vernunftorientierten "Gesellschaft der Gottgläubigen" durch die Schule eines reformierten Hinduismus gegangen; Weidner porträtiert deren prägende Gelehrten Rammohan Roy und Kehab Chandra Sen als fortschrittlich gesinnte Kosmopoliten. Später wurde Vivekananda Schüler des berühmten Yogi Ramakrishna Paramahamsa, der eine sehr volkstümliche Religiösität mit einer universellen Haltung verband, die auch muslimische und christliche Elemente mit einbezog. Das Ergebnis all dieser verschiedenen Einflüsse entsprach schon vom Phänotyp her nicht dem Bild, das man sich im Westen von authentisch indischer Weisheit gemacht hatte; der seinerzeit berühmte deutsche Indologe Paul Deussen beschrieb Vivekenanda, mit dem er 1896 zusammentraf, als "jungen Mann, strotzend von Gesundheit, mit vollen rosigen Wangen, sehr verschieden von dem, wie wir uns einen Heiligen vorstellen". Und dann rauchte er auch noch!
Aber Weidner holt noch viel weiter aus, bis hin zu einer Region im Nordosten Persiens namens Chorasan, die heute zu Afghanistan gehört, wo, von Europa unbemerkt, im 11. Jahrhundert "die bedeutendsten Dichter, Denker und Gelehrten des Erdballs" gewirkt hätten. Der muslimische Universalgelehrte Abu Rayhan al-Biruni fertigte dort die erste Übersetzung der rund 2000 Jahre alten "Yoga-Sutren" von Patanjali an; die erste englische Übertragung folgte erst acht Jahrhunderte später. Al-Biruni sei es gelungen, den kryptisch dichten Text in seiner arabischen Version zu "entpacken" und dadurch seine Bedeutung auch jenseits der geschlossenen Zirkel der indischen Brahmanen freizulegen. Damit sei er zu einem Pionier jenes "spirituellen Kosmopolitismus" geworden, um den Weidners Buch in immer neuen Anläufen kreist. Al-Biruni ging selber von der Wahrheit des Islam aus, doch zugleich stellte er eine frappierende Verwandtschaft der unterschiedlichen religiösen Erfahrungen fest: "Wenn man auf die Sutren hört", schrieb er, "erkennt man eine Zusammensetzung von Glaubensinhalten der alten Griechen, der verschiedenen christlichen Glaubensrichtungen und der Wortführer der Sufis."
Die muslimischen Mogul-Herrscher über Nordindien schlossen im 16. und 17. Jahrhundert an diese Einsicht an. Der Kaiser Djalal ad-Din Mohammed Akbar (1542-1605) schätzte Yoga als Methode der spirituellen Selbstführung. Und sein Urenkel Dara Shikoh (1615-1659) übersetzte die indischen Upanischaden ins Persische sogar, um den Koran besser verstehen zu können. Die Grenzen eines engstirnigen Kulturalismus, so macht dieses Buch eindrucksvoll deutlich, wurden schon viel früher und weit entfernt von Europa gesprengt, als zu der Zeit, als die westliche Moderne eine solche Horizonterweiterung für sich gepachtet zu haben glaubte. Sehr entschieden wird da aller kolonialen und nach-kolonialen Überheblichkeit der Boden entzogen.
Allerdings erzeugt die immer neu variierte Annahme, die verschiedenen spirituellen Traditionen liefen im Grunde aufs Gleiche hinaus, und zwischen Plotin, Ibn Sina, Boethius, Patanjali, Dante und den Sufis könne alles mit allem jederzeit zusammengebracht werden, auf Dauer einen leicht beliebigen Eindruck. In der Schwerelosigkeit eines solchen Zusammenmixens droht das spezifische Eigengewicht der einzelnen Perspektiven etwas verloren zu gehen. Insbesondere die Perspektive des gegenwärtigen Westens, in dem Yoga in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts zu einem Massenphänomen wurde. Das Buch bricht seine genaue Beschreibung etwas unvermittelt nach Vivekanandas Auftritt in Chicago ab und begnügt sich danach mit einer summarischen Darstellung. Wie genau Yoga in den USA und Europa Platz griff, über welche Autoren, Institutionen, Lebensstilveränderungen und geistigen Strömungen, wird daher nicht erzählt. Weidner deutet an mehreren Stellen an, dass das westliche Interesse an Yoga neben seiner progressiven, weltoffenen Seite auch eine dunkle, reaktionäre hatte, die das alte Indien als Gegenentwurf zur westlichen Moderne stilisiert. Wie ist das zu erklären, und wie genau äußert sich diese rechte Projektion? Auch darüber hätte man gern mehr gewusst.
Doch gegenüber dem großen, häufig überraschenden Erkenntnisgewinn, den diese Tour durch die globale Geistesgeschichte bietet, sind das nur marginale Einwände. In Weidners Lesart ist Yoga weit über die reinen Körperübungen hinaus ein Vehikel für die Auflösung allzu starrer kultureller Identitäten. Eine gewisse historische Ironie liegt darin, dass der Triumph von Yoga im Westen nun mittlerweile auf sein Ursprungsland zurückwirkt und dort aber wieder zu einer identitären Erstarrung zu führen droht. Seit zehn Jahren betreibt der indische Premierminister Narenda Modi eine Art Nationalisierung von Yoga. Er ernannte einen Yoga-Minister, verbreitet staatliche Videos über korrektes Yoga und erreichte, dass die Vereinten Nationen den 21. Juni zum "Welt-Yoga-Tag" erklärten.
Schon bei Vivikananda zeigte sich allerdings, dass seine Mission von Anfang an auch eine nationale Komponente hatte. Weidner, der auf Modi und das heutige Indien nicht eingeht, zitiert aus einem Brief, den Vivekananda auf seiner Reise nach Amerika 1893 aus Bombay schrieb: "Wir (Inder) sollten alle reisen, fremde Weltgegenden erkunden. Wir müssen verstehen, wie die Maschinerie der Gesellschaft in anderen Ländern funktioniert und frei und offen debattieren, was in den Köpfen anderer Nationen vorgeht, wenn wir selbst wahrhaft wieder eine Nation werden wollen." Das hat offensichtlich geklappt; heute ist Indien eine führende Macht des sogenannten globalen Südens. Als herausragendes Element von dessen Soft Power hat Yoga heute nicht nur eine kosmopolitische, sondern auch eine geopolitische Bedeutung.
Stefan Weidner: "Yoga oder Die sanfte Eroberung des Westens durch den Osten". Hanser, 416 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.