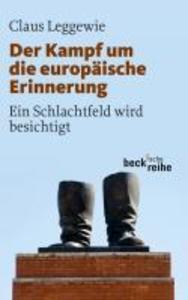
Sofort lieferbar (Download)
In diesem Buch analysiert Claus Leggewie die europäische Erinnerungslandschaft und besucht zusammen mit Anne Lang Erinnerungsorte, an denen sich aktuelle Geschichtskonflikte verdeutlichen lassen. Dabei steht die europäische Peripherie im Mittelpunkt, das Baltikum, die Ukraine, Jugoslawien, die Türkei, aber auch die europäische Kolonialvergangenheit und die Geschichte der Migranten. Auf diese Weise wird deutlich, dass der Weg zu einer politischen Identität Europas nicht über die Konstruktion einer inhaltlich eindeutigen europäischen Tradition führen kann. Nur in der Durcharbeitung und Anerkennung der konfliktreichen und blutigen Vergangenheit kann eine Gemeinsamkeit wachsen, die Europa politisch handlungsfähig werden lässt - ein wichtiger Baustein zur europäischen Selbstaufklärung.
Inhaltsverzeichnis
1;Cover;1 2;Zum Buch;2 3;Über den Autor;2 4;Titel;3 5;Widmung;4 6;Impressum;4 7;Inhalt;5 8;Einleitung: Warum es so schwer ist, Europäer zu sein;7 9;Erstes Kapitel: Sieben Kreise europäischer Erinnerung;15 9.1;1. Der Holocaust als negativer Gründungsmythos Europas;15 9.2;2. Sowjetkommunismus gleichermaßen verbrecherisch?;21 9.3;3. Vertreibungen als gesamteuropäisches Trauma;27 9.4;4. Kriegs- und Krisenerinnerungen als Motor Europas;32 9.5;5. Schwarzbuch Kolonialismus;36 9.6;6. Europa als Einwanderungskontinent;40 9.7;7. Europas Erfolgsgeschichte nach 1945;45 10;Zweites Kapitel: Erinnerungsorte der europäischen Peripherie;49 10.1;1. Aljoscha und die baltische Ambivalenz;56 10.2;2. Karadic in Den Haag oder: Europa begann nicht in Sarajevo;81 10.3;3. Artikel 301: Anerkennung des Genozids als Beitrittskriterium?;103 10.4;4. Holodomor: die Ukraine ohne Platz im europäischen Gedächtnis?;127 10.5;5. Tervuren: das schwache Kolonialgedächtnis Europas;144 10.6;6. Deutz tief: Europa als Einwanderungskontinent;162 11;Ausblick: Ein Haus der Geschichte: Wie Europa politische Identität gewinnen kann;182 12;Koautorenschaft und Danksagung;189 13;Anmerkungen;190 14;Bildnachweis;218 15;Personen-, Orts- und Sachregister;219
Produktdetails
Erscheinungsdatum
18. April 2011
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
224
Dateigröße
3,09 MB
Reihe
Beck'sche Reihe
Autor/Autorin
Claus Leggewie, Anne Lang
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783406619960
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Der Kampf um die europäische Erinnerung" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









