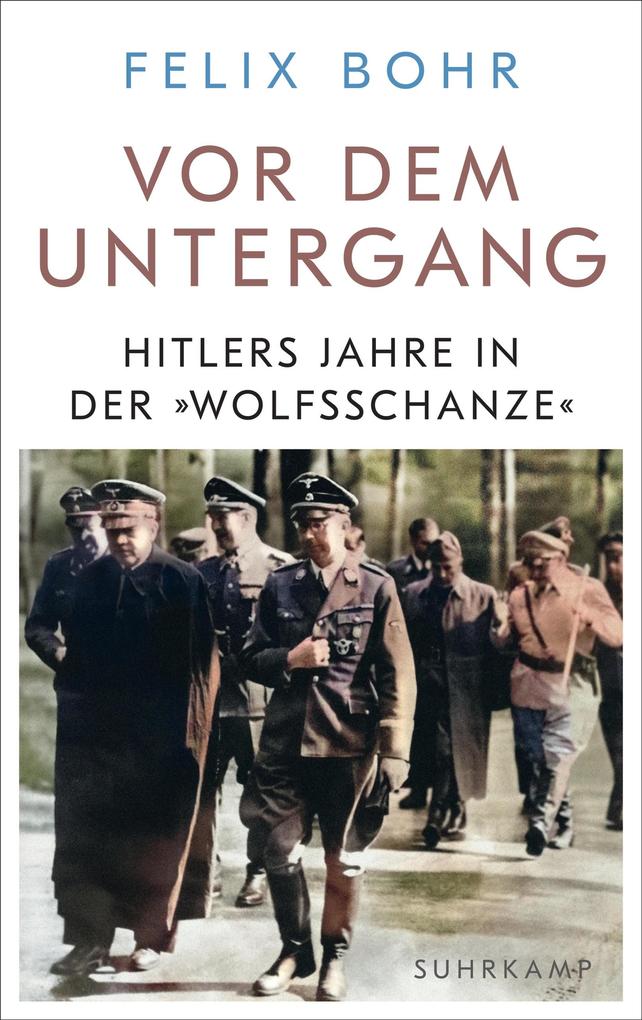Besprechung vom 06.11.2025
Besprechung vom 06.11.2025
Von Mördern und Stechmücken
In den ostpreußischen Wäldern ging Hitler im Zweiten Weltkrieg in Deckung: Felix Bohr erzählt die Geschichte der "Wolfsschanze" und ihrer Bewohner.
Drei Orte waren der sichtbare Inbegriff von Hitlers Herrschaft: die Neue Reichskanzlei in Berlin, der Obersalzberg bei Berchtesgaden und die Wolfsschanze bei Rastenburg in Ostpreußen. Zwei davon sind heute praktisch unsichtbar: Die Reichskanzlei ist bis auf wenige unterirdische Reste verschwunden; der "Berghof" mit seinem Panoramafenster und der Aussichtsterrasse wurde gesprengt, am Fuß der Anhöhe steht inzwischen ein vorbildliches Dokumentationszentrum. In den massiven, teils zerborstenen, teils aufrecht stehenden Trümmern der "Wolfsschanze" aber, dem einstigen Feldhauptquartier in der heutigen polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren, könnte man dem "Führer" und seinen Verbrechen immer noch auf die Spur kommen.
Das meint jedenfalls Felix Bohr, der sein Buch über "Hitlers Jahre in der 'Wolfsschanze'" mit dem Appell beschließt, die "Blackbox" in den masurischen Wäldern aus der "Peripherie des deutschen Gedenkens" ins Zentrum der Erinnerungspolitik zu holen und auch hier eine Dokumentationsstätte zu bauen - allerdings unter polnischer Regie: "Es wäre an der Bundesregierung, auf Polen zuzugehen und womöglich auch ausreichende Finanzmittel dafür bereitzustellen." Bohr, der das Geschichtsressort des "Spiegels" leitet, verknüpft seinen Aufruf mit dem festgefahrenen Streit über deutsche Reparationszahlungen an den polnischen Staat und den sich hinziehenden Planungen für ein "Polnisches Haus" als Gedenkort für die zivilen Opfer Polens im Zweiten Weltkrieg. Das Gelände, das er mit seinem Buch betritt, ist also in zweifacher Hinsicht symbolisch vermint, als Befehlszentrale des Diktators und als Knotenpunkt der deutsch-polnischen Geschichte.
In Bohrs Schilderung merkt man von dieser doppelten Codierung zunächst wenig. Der Autor betritt den historischen Schauplatz wie ein Tourist, umweht von "Modergeruch" und "Duft von Harz und Blüten" im feuchten Wald und gestärkt von einem Frühstück in seinem Quartier an einem nahen See. Eine polnische Historikerin führt ihn zu den Resten der Bunkergebäude innerhalb der drei Sperrkreise, die den Lagerkomplex militärisch absicherten, und Bohr zitiert einen Satz von Felix Hartlaub, der als Mitarbeiter am offiziellen Kriegstagebuch der Wehrmacht die Stimmung in der "Wolfsschanze" aus nächster Nähe beschrieben hat: "Hier ist noch kein scharfer Schuss, keine einzige Bombe gefallen, diese seltsame Ausgespartheit hier, manchmal kommt sie einem etwas unheimlich vor."
In dieser Ausgespartheit, könnte man sagen, liegt das Darstellungsproblem dieses Buches, denn auch Felix Bohr muss von einem Ort erzählen, an dem das Geschehen des Krieges und der Massenvernichtung nur als fernes Echo widerhallt. Um der Gefahr zu entgehen, die Kulisse aus Bäumen und Betonplatten bloß anekdotisch auszumalen, hat er seinen Schilderungen eine Zeitleiste eingezogen, die von der Errichtung des Hauptquartiers Ende Juni 1941 bis zu seiner hastigen Räumung im November 1944 reicht. Auf diese chronologische Schnur sind die Beschreibungsdetails aufgefädelt, die zur Geschichte des Machtzentrums unter ostpreußischen Tannen und Tarnnetzen gehören: die Architektur, die Wegeführung, die angelagerten Residenzen der Paladine Göring, Himmler und Ribbentrop, die Wachmannschaften, die Sekretärinnen, die Staatsgäste, die Rituale des Essens und Feierns, die Intrigen Bormanns, das Attentat vom 20. Juli und seine Folgen, die zunehmende Katastrophenstimmung hinter den Betonmauern und einiges mehr.
Wenig davon ist wirklich neu. Dass Hitler ausschließlich Fachinger-Mineralwasser trank, dass seine Diät aus Kohl- oder Gerstenschleimsuppe, Tomatentörtchen und Kartoffelbrei und einem Glas "Magenelixier" bestand, haben schon andere beschrieben, und dass er einen SS-Mann an die Ostfront versetzen ließ, weil dieser eine lästige Stechmücke nicht fangen konnte, und von seinem Leibarzt Theo Morell einen Extrakt aus Stierhoden gespritzt bekam, wenn Damenbesuch anstand, muss man vielleicht nicht wissen, auch wenn es die Phantasie des Lesers kitzelt. Auch die stundenlangen Monologe, die Hitler vor seinen Generälen hielt, seine Liebe zu Lagekarten mit Pfeilen und Strichen, sein Waffenkult ("was für ein elegantes Rohr!", jubilierte er vor einer Panzerkanone), seine Krankheiten und Wutausbrüche gehören zu jener Wolfsschanzenfolklore, an der seit achtzig Jahren beharrlich gestrickt wird.
Für Bohrs Darstellung spricht, dass er diesen Wust an notwendigen und überflüssigen Fakten in ein schlüssiges Korsett steckt, dass er das Innenleben der Anlage, zu der dreieinhalb Jahre lang alle Dienstwege des NS-Staats führten, dramaturgisch sortiert, bis alles an seinem Platz ist. Weniger überzeugend ist dagegen seine Analyse der Gründe, warum Hitler einen Großteil des Zweiten Weltkriegs an diesem entlegenen, im Sommer feuchtheißen und im Winter eisigen Ort verbrachte. Es stimmt, dass Hitler hier "in Deckung" ging (Bohr), wie er es in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs gelernt hatte. Aber die Abgeschiedenheit der "Wolfsschanze" war für ihn auch auf andere Weise lebenswichtig. Sie schützte seine Aura als Heilsbringer Deutschlands vor den störenden Einflüssen eines Regierungsapparats, der in den sechs Friedensjahren des Nationalsozialismus immer dysfunktionaler geworden war, und einer Kriegswirklichkeit, die spätestens ab 1942 für die Volksgenossen zum Albtraum wurde.
Typisch für diesen Mechanismus charismatischer Herrschaft ist das Wolfsschanzen-Erlebnis Heinz Rühmanns, der Anfang 1944 mit den Filmrollen der "Feuerzangenbowle" nach Ostpreußen fuhr, um Hitler zur Aufhebung des Verbots zu bewegen, das NS-Bildungsminister Rust über die Komödie verhängt hätte. Nachdem ihn der Diktator wie ein barocker Monarch zwei Tage lang hatte warten lassen, empfing er ihn für eine kurze Audienz, bei der er den Schauspieler nur fragte, ob der Film denn etwas zum Lachen sei. Rühmann bejahte, die "Feuerzangenbowle" durfte starten.
Das Hauptquartier bei Rastenburg war also nicht nur ein Instrument, sondern auch ein Symbol von Hitlers Regime. Aber soll man die "Wolfsschanze" deshalb topographisch erschließen und mit einem Museumsbau krönen, wie es Bohr am Ende des Buches fordert? Die Plausibilität dieses Vorschlags ruht auf Bohrs These, Hitler habe "die entscheidenden Beschlüsse zum Völkermord" in Ostpreußen getroffen. Aber außer einer Notiz von Hitlers Sekretärin Christa Schroeder und der Anekdote eines Nachrichtenfunkers, dessen Kollege ein Gespräch zwischen Himmler und Bormann belauscht hatte, liefert der Autor keinen Beleg für seine Behauptung.
Der aktuelle Konsens der historischen Forschung lautet, dass Hitler gerade keine ausdrücklichen Beschlüsse zum Holocaust gefasst, sondern seinen Großschergen nur vage mündliche Anweisungen erteilt hat. Eine Aufwertung der "Wolfsschanze" zum Gedenkort würde diesem mörderischen Raunen einen offiziellen Rahmen verleihen. Dabei gibt es genügend Orte des massenhaften Sterbens und Tötens, die noch der musealen Erschließung harren. Dass Hitler hinter den Betonmauern im Wald bei Rastenburg gehaust hat, ist Grund genug, ihre Trümmer dem weiteren Verfall preiszugeben. Das Gedenken gehört in die deutsche Hauptstadt - und dorthin, wo die Opfer der deutschen Völkermorde ihren Tod fanden. ANDREAS KILB
Felix Bohr: "Vor dem Untergang". Hitlers Jahre in der "Wolfsschanze".
Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 298 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.