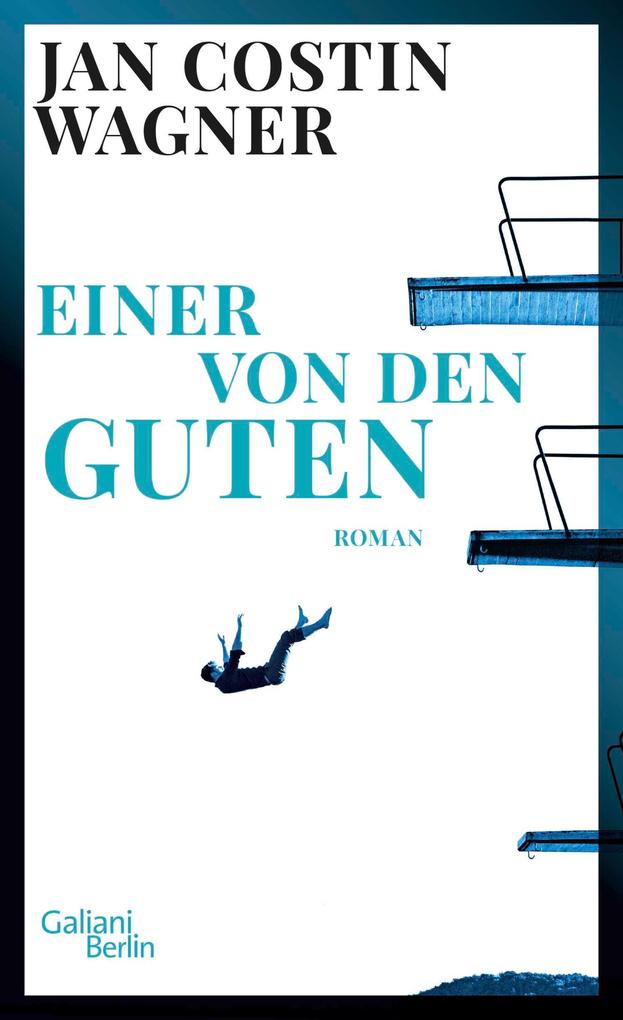
Während der Sommer verblasst und der Herbst anbricht, verstrickt sich Neven immer tiefer und auswegloser im Dickicht seines ungeheuerlichen Doppellebens. Und Adrian lernt die gleichaltrige Vera kennen, die ihm ein ganz anderes Leben zeigt. Ein Leben, das er nicht kannte und das er vor seinem Vater, der ihn zur Prostitution zwingt, verbergen muss.
Sowohl Ben als auch Adrian müssen radikale Entscheidungen treffen, um die unhaltbare Situation zu ändern. Doch jeder Schritt ist ein Schritt am Abgrund. Wenn Neven sich jemandem anvertraut, steht seine Existenz auf dem Spiel. Und Adrian müsste sich von seinen Wurzeln und seinem alten Leben komplett lossagen. Werden sie einen Ausweg finden? Und wenn ja, um welchen Preis?
Eine fein austarierte, hochmoralische Meditation über Menschen am Abgrund, die uns nach dem letzten Satz sprachlos und doch mit geschärftem Blick zurücklässt.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 18.08.2025
Besprechung vom 18.08.2025
"Das Böse löscht das Licht aus"
FRANKFURT Vertreibung aus dem Paradies: In seinem neuen Roman "Eden" erzählt Jan Costin Wagner von einem Attentat und seinen Folgen.
Von Florian Balke
Hier islamistische Terroranschläge, dort rechtsradikale Kampfhunde, die immer wilder herumbellen und lautstark an ihren Ketten zerren. Das Leben in Deutschland ist stressig geworden, obwohl noch immer durch ein Maß an Wohlstand und Normalität gepolstert, das anderswo undenkbar erscheint. Das Paradies auf Erden. Bis plötzlich etwas geschieht. So wie in "Eden", dem neuen Roman von Jan Costin Wagner, in dem ein Selbstmordattentäter ein junges Mädchen aus dem Leben reißt, woraufhin sein Vater und seine Mutter weder mehr ein noch aus wissen.
Seinen Namen hat das Buch, das Wagner am 20. August in Frankfurt vorstellt, von einem Album der britischen Gruppe Talk Talk, das früh ins Spiel kommt. Der kluge und freundliche Architektenvater Markus empfiehlt es Tobias, dem Klassenkameraden seiner Tochter Sofie. Ihm hat er bei einem Referat über Entenhausen und die "Lustigen Taschenbücher" geholfen. Später zückt er Konzertkarten für den Stuttgarter Auftritt von Ariana la Vega, einer Sängerin, deren Musik die zwölf Jahre alte Sofie liebt. Sie trägt in ihrer Popularität Züge von Taylor Swift, ihr Name legt aber auch eine leicht lesbare Spur in Richtung Ariana Grande aus, bei deren Konzert in Manchester ein Bombenattentäter vor acht Jahren 22 Fans ermordete.
In Stuttgart besucht Markus das Konzert zusammen mit seiner Tochter, seiner Schwester und seiner kleinen Nichte, wartet aber mit dem Arbeits-Laptop in einer Cafeteria auf die Damen. Nach dem Ende des Konzerts will er sie abholen, wird im Foyer gerade noch Zeuge des Explosionsblitzes und eilt die Rolltreppe in den grauen Nebel hinauf. Mit ihm habe laut Wagner der Roman begonnen. Der Vater, massiv getroffen von dem, was ihm widerfahren sei, müsse "begreifen, um bewältigen zu können", sagt Wagner: "Die Figur war zentral, die wollte ich vermutlich als Erste erzählen."
Schon vor zwei Jahren hatte er im Gespräch über "Einer von den Guten", den letzten seiner drei abgründigen Bände über einen pädophilen Polizisten, bemerkt, als nächstes folge vielleicht kein Roman über eine zerrissene Person, sondern einer über die zerrissene Gesellschaft. Jetzt ist der Roman da und zeigt, wie der Tod Sofies zuerst Markus, später aber auch ihre Mutter Kerstin in den Abgrund von Wut, Verdrängung, Sprachlosigkeit und Depression reißt. Und wie sich ein paar Straßen weiter der Vater von Tobias vor lauter Verärgerung über muslimische Zuwanderer so radikalisiert wie auf der Gegenseite der Selbstmordattentäter Ayoub. Ihm hat sein älterer Bruder Hamza, sonst ein pflichtbewusster Sohn und aufmerksamer Vater zweier kleiner Töchter, einmal zu oft erzählt, wie sehr er Dschihadisten bewundert, in denen er Rächer der Demütigung durch die Mehrheitsgesellschaft sieht. Bei Ayoub, einem aggressiven Schwächling, fällt das auf besonders fruchtbaren Boden.
Wie immer habe Wagner während der Arbeit am Roman dem nachgespürt, was sich nach und nach im Text einfand. "Es geht einerseits um Sprachfindung, andererseits um Figuren- und Ensemblefindung." Er habe abgewartet, ob die Worte die richtigen waren, und habe geprüft, was sie als Nächstes erforderten: "Im Schreiben lasse ich mich immer nur leiten von dem, was ich eigentlich sehe, und dem, was die Sprachfindung hervorbringt." Habe sie erst einmal so richtig begonnen, "kann ich weiter vordringen als in jeder anderen Form des Ausdrucks". Trotzdem hat Wagner, der auch Musiker ist und sich zur Buchpremiere in der Ausstellungshalle an der Schulstraße am Klavier begleiten wird, während der Arbeit am Roman die beiden Alben "violet tree" und "Unbelegte Reise" aufgenommen. Sie hängen thematisch mit "Eden" zusammen. Beim Schreiben aber sei für ihn entscheidend, dass die Figur stimme: "Was immer dann entsteht, entsteht."
Er habe ein "Mosaik" zeichnen wollen, das in gewisser Weise umfassend sei, sagt er: "Erzählenswert ist das, was die Gesellschaft zu zerreißen droht." Aber es sei ihm nicht darum gegangen, vom gewaltbereiten Islamismus über die verunsicherte Mitte zwischen Alltag und Ausnahmesituation bis zum rechtsradikalen Ausländerhass samt Remigrationsphantasie alles mit hinein zu holen, was Bundesbürger derzeit umtreibt: "Die Figuren entstanden aus dem Wunsch, das Mosaik zu zeichnen. So hat sich der Vater von Tobias herauskristallisiert."
Vom Anschlag in Manchester habe Wagner seinerzeit auf Lesereise in Südkorea erfahren. Wie andere islamistische Attentate der vergangenen Jahre und Jahrzehnte habe er ihn immer wieder beschäftigt: "Es war ein Anschlag auf ein Konzert, zu dem vor allem Jugendliche und Heranwachsende gegangen sind. Die Massivität des Kontrasts zwischen der puren Freude und dem Schrecken hat mich lange begleitet." Als Autor habe er den Wunsch gehabt, das zu sortieren. Trotz vieler kleiner Verschiebungen folgt "Eden" in zahlreichen Details den Ereignissen in Manchester: vom schweren, auffälligen Rucksack, den der Attentäter mit sich herumschleppt, bis zum 22. Mai als Tag der Tat, den Wagner ebenfalls bewahrt hat: "Das habe ich intuitiv getan, das wusste ich gar nicht mehr."
Ayoub und den Vater von Tobias eint das Gefühl, eine gesellschaftliche Täuschung durchschaut zu haben. Die Parallele zwischen den beiden Extremen mitschwingen zu lassen, sei Wagner wichtig gewesen: "Ganz subtil und assoziativ." Schließlich gehe es um die Frage, woraus sich Hass speise. Es geht aber auch viel um Väter, Söhne und Brüder. Ist das für Wagner alles ein Männerproblem? "Männer sind aus diversen Gründen eher empfänglich für das Abgleiten in ideologisierte, abgeschlossene Systeme und im schlimmsten Fall auch für die Gewalt beim Umsetzen und Durchsetzen dessen, von dem sie überzeugt sind." Während des Schreibens aber sei ihm das nicht präsent gewesen: "Im Roman sind es Männer, weil sie aus dem richtigen Leben gegriffen sind, was mir immer sehr wichtig ist."
Und Sofie? "Sofie ist das Licht. Und das auch ganz bewusst in diesem Kontext. Hier ist es wirklich das Böse, das das Licht auslöscht. Es geht dann darum, die Graustufen abzutasten." Mit dem Vater von Tobias und dem Attentäter gibt es Menschen, die sich von der Gesellschaft lossagen: "Und ich wollte Menschen, die versuchen, Brücken zu bauen. Das ist in gewisser Weise die Grundidee des Buches." Aber der Querdenkervater und Ayoub mit seiner Bombe begegnen sich nie. Und auch Markus ist mit Hamza, den er zweimal aufsucht, alles andere als versöhnt. "Brückenbauen ist mühselig", sagt Wagner: "Ich wollte keinen Roman, der dem Leben nicht standhält." Von der Hoffnung auf Versöhnung habe er erzählen wollen, nicht von der Versöhnung selbst: "Das wäre kein integres Erzählen gewesen. Nicht realistisch und damit nicht aufrichtig." Hoffnungsschimmer und erste Schritte hingegen findet er durchaus berichtenswert: "Ich wollte wohl ins Bewusstsein rücken, wie wichtig es ist, damit zu beginnen."
Deswegen lässt er die rechtsradikale Politikerin, der Markus vor Beginn einer Talkshow begegnet, dem Vater des toten Kindes auf eine Weise ihr Beileid aussprechen, die er als zutiefst aufrichtig wahrnehme: "Das sind Momente, die ich wirklich aufzuspüren versuche. Momente, in denen die Brücke gebaut wird. Und sei es nur für einen Augenblick." Ihm sei es wichtig, alle seine Figuren als Menschen zu zeichnen: "Mensch sein bedeutet ja nicht, gut oder schlecht zu sein. Es geht darum, dass es Menschen sind, die Menschen das Schrecklichste antun."
Schon Wagners Kimmo-Joentaa-Bücher und seine drei Ben-Neven-Romane waren keine reinen Krimis, sondern psychologische Romane, lebten vom Einblick in Herz und Hirn der Guten wie der Bösen. In "Eden" entfernt Wagner sich nun noch etwas weiter vom Modell, mit dem er begann. Es sind keine Ermittlungen und Ermittler mehr nötig, es sei denn, man wolle Markus, den suchenden Vater, als solchen sehen, wofür einiges spricht. "Ich sehe die Bücher nach wie vor als alle miteinander verbunden", sagt Wagner: "Sie bindet, dass ich Figuren erzählen möchte, die das Schlimmstmögliche erleben, und die Frage stelle, wie sie weiterleben können." Das neue Buch habe dem sehr entsprochen. Das Schreiben sei daher recht ebenmäßig vor sich gegangen: "Als ich einmal begonnen hatte, ist das Buch sehr aus sich selbst heraus gewachsen und entstanden." Zumindest das hat noch etwas von der Leichtigkeit des Paradieses.
Jan Costin Wagner Ausstellungshalle, Schulstraße 1a, Frankfurt, 20. August, 19 Uhr
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.










