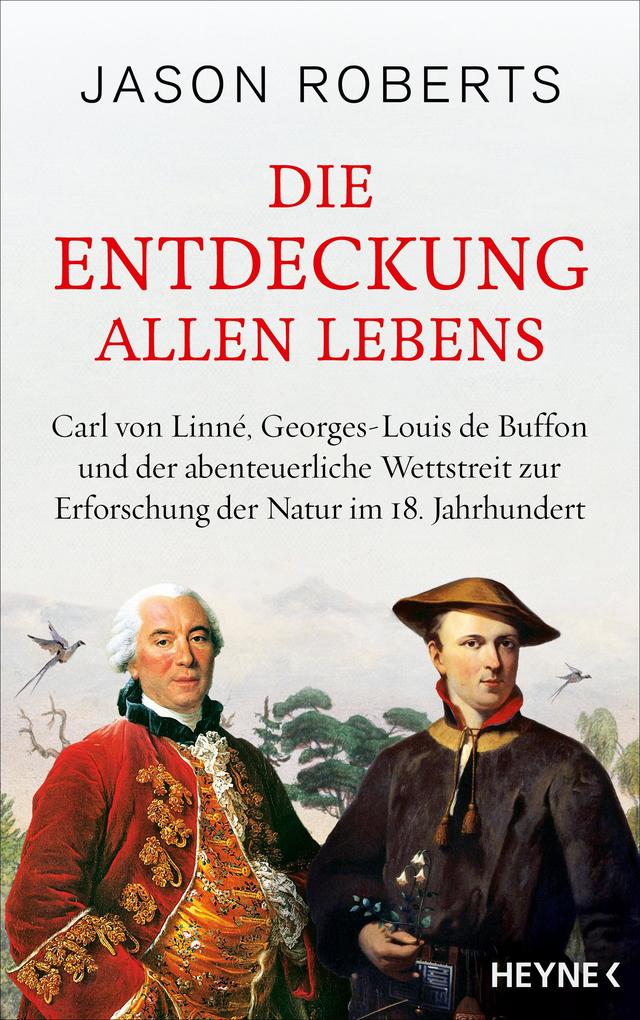Besprechung vom 28.01.2025
Besprechung vom 28.01.2025
Der Herr des Jardin des Plantes
Naturforscher im Vergleich: Jason Roberts gibt dem Comte de Buffon den Vortritt vor Carl von Linné.
Wer nicht so genau weiß, wer Georges-Louis de Buffon war, ist in guter Gesellschaft, Charles Darwin ging es ebenso. Ganz verlegen klang er, als er 1865 in einem Brief glaubhaft versicherte, von dessen Überlegungen "nichts gewusst" zu haben, obwohl sie seinen so ähnelten. Der Franzose Buffon ist der weniger bekannte der beiden Naturforscher, denen der Journalist Jason Roberts eine Doppelbiographie gewidmet hat, und jede Seite kündet: zu Unrecht. Der andere ist der im gleichen Jahr 1707 in Schweden geborene Carl von Linné, dessen Ehrgeiz es war, ein alle Lebensformen umfassendes Klassifizierungssystem zu entwickeln, und der die bis heute übliche binäre Nomenklatur bei der Benennung von Arten als Erster konsequent angewandt hat. Eine Bestandsaufnahme all dessen, was die Erde hervorgebracht hat, war auch das lebenslange Projekt des Comte de Buffon, den allerdings weniger Ordnungseifer anleitete als Faszination für die Vielfalt des Lebens und dessen visionäre und zu Lebzeiten teils ketzerische Gedanken ihn heute weit moderner erscheinen lassen als Linné.
Jason Roberts erzählt von den konkurrierenden Vorhaben mit viel Hinwendung zum biographischen Detail und eindeutiger Sympathieverteilung. Carl Linnaeus - zum Ritter geschlagen erfand er seinen Namen neu - ersteht als kurioser Charakter, pompös und prahlerisch, exzentrisch und konventionell zugleich. Er glaubt an die Schöpfung nach dem Buch Genesis, leistet mit seinen Gedanken zur Überlegenheit des weißen Mannes späteren Rassentheorien Vorschub und tut, was er kann, damit die Welt so beeindruckt von ihm ist wie er selbst: "Alles, was dieser begabte Mann denkt und schreibt, hat Methode", war einmal in einer Hamburger Zeitung zu lesen, den Artikel hatte er selbst verfasst. Ersten Ruhm hatte der Sohn eines Pfarrers, der sich nach einem auch nach den Maßstäben des frühen achtzehnten Jahrhunderts unseriösen Blitzstudium Arzt nennen durfte, da schon erlangt, durch ein System zur Identifikation von Pflanzen, ausgehend vom Bau ihrer Sexualorgane.
Auch Buffon war nicht prädestiniert für seinen Werdegang. Geboren als Georges-Louis Leclerc in einem Dorf im Burgund, kam er durch eine Erbschaft unverhofft zu Vermögen, legte sich ebenfalls einen klangvolleren Namen zu, entdeckte seinen Hang zum Hedonismus, den er zeitlebens mit einem disziplinierten Tagesablauf in Schach hielt, und seinen Forscherdrang, der ihn zu einem der bekanntesten Universalgelehrten seiner Zeit werden ließ. Mit 27 Jahren wurde er leitender Gärtner des als Hausapotheke des Königs geschaffenen Jardin du Roi in Paris, dem heutigen Jardin des Plantes, und blieb es über fünfzig Jahre lang: Berühmt machte ihn aber seine bei seinem Tod 36-bändige und längst nicht abgeschlossene "Naturgeschichte".
Linnaeus und Buffon waren zwei Ausnahmecharaktere, in denen sich ein Zeitgeist manifestierte. Doch die Chance, an ihnen den geistigen Horizont aufzuspannen, vor dem sie ihre ehrgeizigen Grundlagenwerke schufen, vergibt Jason Roberts. Dass das geradezu manische Einteilen, Ordnen, Hierarchisieren ein Akt der Selbstvergewisserung war in einer durch Schifffahrt, Handel und Expeditionen kleiner werdenden Welt und die Frage nach dem Wesen des Menschseins - die eigene Überlegenheit meist fraglos voraussetzend - eine der meistdiskutierten in den französischen Salons, wird höchstens gestreift. Andere Aufklärer tauchen kaum auf: Jean-Jacques Rousseau fällt einmal kurz ehrfürchtig auf die Knie, als er das Anwesen Georges-Louis de Buffons besucht. Die episodische, durchaus unterhaltsame Erzählweise addiert sich nicht zum großen Panorama, Anekdoten laufen ins Leere, zahlreiche Nebenfiguren werden eingeführt, um ein paar Seiten später wieder zu verschwinden.
Dass das Buch dennoch lohnend ist, liegt vor allem am letzten Viertel, das die große Linie schafft, die man sich auf den Seiten zuvor auch gewünscht hätte, und die Geschichte der Taxonomie, die auch immer eine der menschlichen Verortung war, bis ins Heute weiterverfolgt.
Nach der Revolution in Frankreich gelang es Linné-Jüngern, Buffon als Vertreter des Ancien Régime dastehen und seinen Ruhm bald verblassen zu lassen. Seine fortschrittlichen Gedanken musste man auch erst finden in der weitschweifigen, als Literatur rezipierten "Histoire naturelle", die auf eine Tierart mitunter Hunderte Seiten verwandte. Linnés eingängiges "Systema naturae" dagegen versinnbildlichte eine Demokratisierung des Wissens und kam mit der Elimination bereits vorhandener Artbezeichnungen auch bei der Aneignung fremder Weltgegenden zupass.
Linnés Einteilung in Reich, Klasse, Ordnung, Gattung, Art wurde zur Grundlage aller nachfolgenden Taxonomien in der Biologie, Bezeichnungen wie "Homo sapiens" sind geblieben. Während sich aber viele seiner Annahmen als falsch herausstellten, nahm Buffon Wegmarken der Forschung auf verblüffende Weise vorweg. Für ihn unterschieden sich Menschen nur äußerlich und Linnés Einteilung in "Typen", woraus später Rassen wurden, lehnte der Gegner der Sklaverei ab. Auf der Suche nach Kriterien, die zur Abgrenzung zwischen Arten taugen, kam er richtigerweise auf die Fähigkeit zur Reproduktion. Er vermutete, dass die Erde nicht in einem Schöpfungsakt entstanden war, dass Arten aussterben und sich verändern, und antizipierte die Entdeckung der DNA, indem er sich eine "moule interieure" vorstellte, eine innere Form, die die äußere festlegt. Auf diesen Gedanken Buffons machte Thomas Henry Huxley seinen Freund Charles Darwin aufmerksam, als der grübelte, wie physische Merkmale wohl weitergegeben werden. Diese Ideen seien "in lächerlicher Weise den meinigen ähnlich", schrieb Darwin, nachdem er Buffon gelesen hatte. Es war anerkennend gemeint. PETRA AHNE
Jason Roberts: "Die Entdeckung allen Lebens". Carl von Linné, Georges-Louis de Buffon und der abenteuerliche Wettstreit zur Erforschung der Natur im 18. Jahrhundert. Aus dem Englischen von Christina Hackenberg und Hans-Peter Remmler.
Heyne Verlag, München 2024. 444 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.