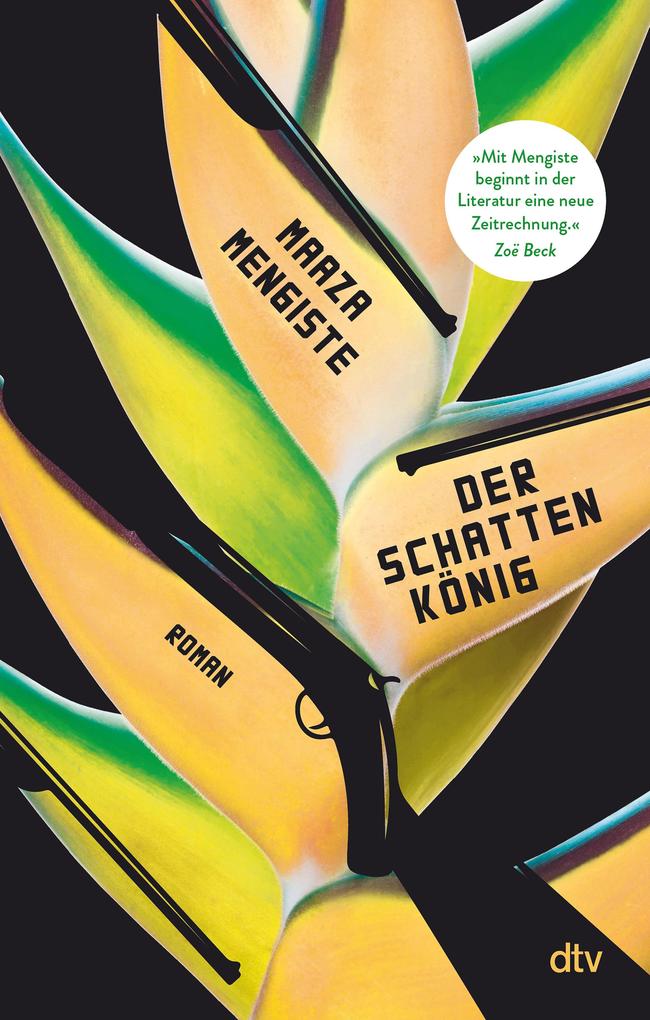
Sofort lieferbar (Download)
»Mit Mengiste beginnt in der Literatur eine neue Zeitrechnung. « Zoë Beck
Als Mussolini 1935 in Äthiopien einfällt, trifft er auf einen unerwarteten Widerstand: Krankenpflegerinnen, Köchinnen, Dienstmägde. Bereit, sich mit ihren Brüdern und Vätern gegen die Faschisten zu behaupten. Die junge Hirut, eine Waise in den Diensten eines Offiziers von Kaiser Selassie, ist eine von ihnen. Als Selassie sich ins englische Exil flüchtet, droht Äthiopien mit seinem Anführer auch die Hoffnung zu verlieren. Und ausgerechnet Hirut findet einen Weg, das Land zu inspirieren. An der Seite des Schattenkönigs, einem armen Musikanten, der dem Kaiser zum Verwechseln ähnlich sieht, rettet sie ihre Heimat vor der Selbstaufgabe und wird kurz zur Herrin ihres Schicksals.
Als Mussolini 1935 in Äthiopien einfällt, trifft er auf einen unerwarteten Widerstand: Krankenpflegerinnen, Köchinnen, Dienstmägde. Bereit, sich mit ihren Brüdern und Vätern gegen die Faschisten zu behaupten. Die junge Hirut, eine Waise in den Diensten eines Offiziers von Kaiser Selassie, ist eine von ihnen. Als Selassie sich ins englische Exil flüchtet, droht Äthiopien mit seinem Anführer auch die Hoffnung zu verlieren. Und ausgerechnet Hirut findet einen Weg, das Land zu inspirieren. An der Seite des Schattenkönigs, einem armen Musikanten, der dem Kaiser zum Verwechseln ähnlich sieht, rettet sie ihre Heimat vor der Selbstaufgabe und wird kurz zur Herrin ihres Schicksals.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. September 2021
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
576
Dateigröße
1,91 MB
Autor/Autorin
Maaza Mengiste
Übersetzung
Brigitte Jakobeit, Patricia Klobusiczky
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783423439411
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Mengiste erzählt ihre Geschichte des Abessinien-Krieges bildgewaltig und in atemlosem Tempo. Julia Raabe, Die Presse am Sonntag
Mengistes Werk ist mit 575 Seiten nicht nur reich an Umfang; es ist auch reich an Stilen, Formen, Farben. An Stimmen. Valeria Heintges, NZZ am Sonntag
Ein beeindruckendes, komplexes Panorama bei gleichzeitiger Tiefenschärfe. Pascal Fischer, SWR 2 Kaffee oder Tee
Der Roman erzählt aus den Perspektiven unterschiedlicher Figuren und in einer Prosa, die dicht, kraftvoll und lebendig ist. Sabine Rohlf, Berliner Zeitung
Ein düster strahlendes Stück außergewöhnlicher Literatur. Wilhelmshavener Zeitung
Jede Seite tut weh, dennoch konnte ich nicht aufhören zu lesen. Es lohnt sich! Andrea Benda, emotion
Besatzer und Besetzte, Herren und Diener, Männer und Frauen: Mengiste erzählt anhand dieser Oppositionen eine zeitlose, packende Geschichte von Widerstand und Selbstbestimmung. Jana Zahner, Südwest Presse
Der Schattenkönig ist ein packender, vielschichtiger Roman über Frauen in einem Krieg. Bücher Magazin
In der eigenwilligen Schönheit ihres Romans erobert sie sich die Geschichte zurück - in jeder Hinsicht eine Geschichte starker Frauen. Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung
So berührend wie bildgewaltig erzählt Maaza Mengiste von einem Kapitel der Geschichte. Buch-Magazin, 12/2021
Die US-Amerikanerin Mengiste hat mit dem Schattenkönig ein Monumentalwerk geschrieben, eine Heldensage, deren Heldinnendie Seite an Seite mit den Männern kämpfenden äthiopischen Frauen sind. Katia Schwingshandl, Buchkultur, Oktober 2021
Eindringlich und aufrüttelnd. SRF 2 Kultur, KW 39
Mengistes Werk ist mit 575 Seiten nicht nur reich an Umfang; es ist auch reich an Stilen, Formen, Farben. An Stimmen. Valeria Heintges, NZZ am Sonntag
Ein beeindruckendes, komplexes Panorama bei gleichzeitiger Tiefenschärfe. Pascal Fischer, SWR 2 Kaffee oder Tee
Der Roman erzählt aus den Perspektiven unterschiedlicher Figuren und in einer Prosa, die dicht, kraftvoll und lebendig ist. Sabine Rohlf, Berliner Zeitung
Ein düster strahlendes Stück außergewöhnlicher Literatur. Wilhelmshavener Zeitung
Jede Seite tut weh, dennoch konnte ich nicht aufhören zu lesen. Es lohnt sich! Andrea Benda, emotion
Besatzer und Besetzte, Herren und Diener, Männer und Frauen: Mengiste erzählt anhand dieser Oppositionen eine zeitlose, packende Geschichte von Widerstand und Selbstbestimmung. Jana Zahner, Südwest Presse
Der Schattenkönig ist ein packender, vielschichtiger Roman über Frauen in einem Krieg. Bücher Magazin
In der eigenwilligen Schönheit ihres Romans erobert sie sich die Geschichte zurück - in jeder Hinsicht eine Geschichte starker Frauen. Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung
So berührend wie bildgewaltig erzählt Maaza Mengiste von einem Kapitel der Geschichte. Buch-Magazin, 12/2021
Die US-Amerikanerin Mengiste hat mit dem Schattenkönig ein Monumentalwerk geschrieben, eine Heldensage, deren Heldinnendie Seite an Seite mit den Männern kämpfenden äthiopischen Frauen sind. Katia Schwingshandl, Buchkultur, Oktober 2021
Eindringlich und aufrüttelnd. SRF 2 Kultur, KW 39
Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 14.01.2022
Was wissen wir über Äthiopien? Nicht viel. Binnenstaat am Horn von Afrika, gebeutelt von Bürgerkriegen, Vielvölkerstaat, dessen Geschicke über viele Jahrzehnte von dem im westlichen Ausland hochangesehenen absolutistischen Herrscher Haile Selassie (1892 -1975), dem Negus Negest, gelenkt wurden. Unterbrochen wurde seine Regierungszeit lediglich während des Abessinienkriegs, in dem er 1936 das Land verließ und ins Exil nach England floh und erst 1941 mit Hilfe der Briten zurückkehrte.Und über den von 1935 bis 1941 dauernden Abessinienkrieg wissen wahrscheinlich die meisten von uns noch weniger. Im Oktober 1935 marschierten Mussolinis Truppen zur "Gewinnung neuen Lebensraums" in Äthiopien ein und nahmen das Land völkerrechtswidrig in die Zange. Trotz des Einsatzes von chemischen Massenvernichtungswaffen gelang es ihnen jedoch nicht, weite Teile im Norden, die von abessinischen Patrioten gehalten wurden, unter ihre Kontrolle zu bringen.Was noch weniger bekannt ist, in den Reihen der Widerständler kämpften auch Frauen an vorderster Front. Und davon erzählt die in Äthiopien geborene amerikanische Autorin Maaza Mengiste in ihrem Roman "Der Schattenkönig" (2020 auf der Shortlist des Booker Prize) und möchte damit diesen Frauen ein Denkmal setzen.Hundertprozentig gelungen ist dies allerdings nicht, auch wenn sie Hirut, eine junge Frau in Diensten eines kaiserlichen Offiziers, ins Zentrum rückt. Vielmehr macht es den Eindruck, dass Mengiste den historischen Gegebenheiten nicht die Aufmerksamkeit schenkt, die sie verdient hätten. Der Roman ist eher ein Heldengesang, in dem der abwesende Kaiser glorifiziert wird, obwohl er sein Volk in dieser schwierigen Zeit im Stich im gelassen hat. Denn es ist ein Doppelgänger Selassies, der dessen Rolle übernimmt, hoch zu Ross auf den Schlachtfeldern erscheint, als "Schattenkönig" den Kämpfenden Mut macht und sie antreibt.Etwas weniger Heldenverehrung, dafür konzentrierteres Schauen auf die Rolle der Frauen in diesem Krieg, hätte dem Roman sicher nicht geschadet.
LovelyBooks-Bewertung am 12.01.2022
Die Rolle der Frauen in einem vergessenen Krieg1935; der sogenannte Abessinienkrieg: die Truppen des italienischen Diktators Mussolini fallen in Äthiopien ein. Hirut, eine junge Waisin aus ärmlichen Verhältnissen, schließt sich den zahlreichen kämpfenden Frauen an und wird Soldatin - ihr Ziel: einem Schicksal in der Unterwerfung, Misshandlung und Unmündigkeit zu entfliehen. Aufgewachsen ist sie als unterdrücktes Dienstmädchen bei Kidane, einem hochrangigen Offizier und dessen Frau Aster, die Hirut stets in ihrer Wertigkeit degradiert, als Konkurrenz betrachtet und ihren Mann als Anführerin der weiblichen Kampftruppen unterstützt.Während die äthiopischen Kämpfer*innen unermüdlichen Widerstand gegen die italienischen Faschisten leisten und sich den Brutalitäten des Krieges stellen, flüchtet der äthiopische Kaiser Haile Selassie ins Exil. Hirut wird zur mutigen Identifikationsfigur der demoralisierten Kämpfer*innen: sie findet eine dem Kaiser ähnliche aussehende Person - Minim, verwandelt ihn zum authentischen Doppelgänger, wird seine Wächterin. Eine Kriegsstrategie, die neuen Mut spendet und den Kampfgeist neu entfacht.Maaza Mengiste erinnert in ihrem zweiten Roman "Der Schattenkönig", welcher 2020 auf der Shortlist des Booker Prize stand, auf eindrückliche Weise an die zahlreichen Frauen, die in den 1930er Jahren gegen die italienischen Soldaten gekämpft haben und setzt ihnen ein wichtiges literarisches Denkmal. Mengiste nimmt sich somit einer äußerst spannenden und komplexen Thematik an und zeigt auch, welche vielschichtigen und widersprüchlichen Rollen und Funktionen am Krieg beteiligte Frauen einnehmen (können). Ein weiterer Fokus liegt außerdem auf der Perspektive der italienischen Soldaten und jener des jüdischen Kriegsfotografens Ettore, der zum "Archivar der Toten" wird (S.480). Das klingt inhaltlich erstmal spannend und auch sprachlich hat der Roman einiges zu bieten. Mengiste erzeugt definitiv lebhafte, verstörende und somit authentische Bilder einer brutalen Kriegsrealität (Triggerwarnungen seien hiermit ausgesprochen). Dennoch: Mengiste verlangte mir als Leserin einiges ab - vor allem in Bezug auf das Zurechtfinden in den komplexen Beziehungsgeflechten und innerhalb der sehr besonderen Erzählstruktur. Der Roman ist für mich eines dieser Bücher, die erobert werden wollen und durch die man sich regelrecht durchkämpfen muss. Bei denen Gebanntheit, Faszination, emotionale Ansprache, leichte Verzweiflung, gedankliche Abschweifungen und mal stillere, mal lautere Abbruchswünsche nah beinander liegen. Es stellt sich nur die Frage, wann man den "Kampf" besser aufgeben sollte. Bei mir begann die Eroberung erst nach etwa 250 Seiten und hielt gute 250 Seiten an. Danach zog sich das Ganze für mich leider wieder zunehmend erneut wie Kaugummi. Mir fehlte es extrem an Fokus, Kohärenz und einem Spannungsbogen. Für mich abschließend nicht ganz beantworten, kann ich die Frage, ob der Roman letztendlich und - trotz der Perspektive auf die Gewalt, die Frauen erleiden und sich selbst gegenseitig zufügen - unterm Strich nicht doch zu sehr zu einer Art "Beschönigung" von Krieg-, Kriegserfahrungen- und beteiligung aus weiblicher Perspektive sowie einem nationalen Kriegspathos und Patriotismus tendiert. Eine kulturell und historisch wertvolle Leseerfahrung, die ich zwar nicht bereue, dennoch fällt mir eine uneingeschränkte Leseempfehlung schwer. Gewünscht hätte ich mir noch ein Glossar für die amharischen Begriffe, die zwar im Kontext verständlich sind, aber unterschiedlichen Interpretationen unterliegen und somit zu Fehldeutungen verleiten können.Aus dem amerikanischen Englisch von Brigitte Jakobeit und Patricia Klobusiczky.









