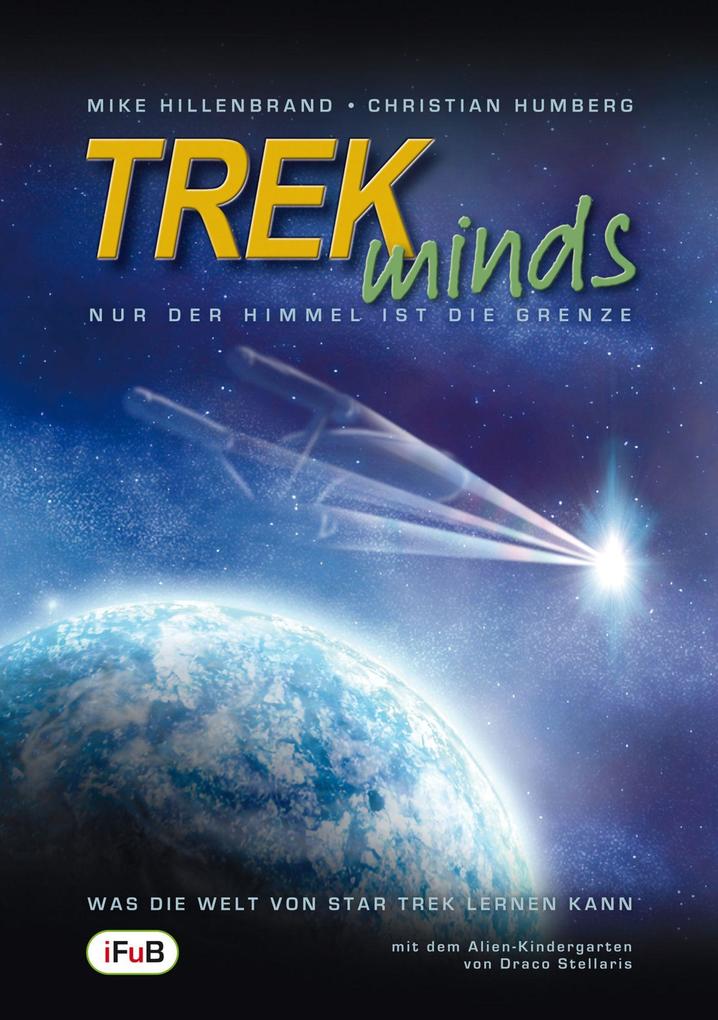
Sofort lieferbar (Download)
Star Trek ist mehr als Action und Abenteuer, mehr als nur gute Unterhaltung. Es ist eine Philosophie, ein Vorbild. . . ein Gefühl.
Das neue Buch "TREKminds - Nur der Himmel ist die Grenze" nimmt Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen und Schauplätze. Hin zu den Ideen, aus denen ein die Generationen überdauerndes Franchise entstand. Ideen des gemeinsamen Miteinanders und der Verständigung, des menschlichen Geistes. Ideen, die weltweit von Millionen von Trekminds gelebt - und geliebt - werden, im Großen wie im Kleinen. Star Trek lebt heute vielleicht mehr denn je - und mit ihm seine Ideale.
Begleiten Sie die Autoren Mike Hillenbrand (u. a. "Dies sind die Abenteuer - 40 Jahre Star Trek", HEEL) und Christian Humberg (u. a. Deutschland-Korrespondent von StarTrek. com) zu einer amüsanten und interessanten Tour jenseits der letzten Grenze. (Mit den Comics vom Alien-Kindergarten von Draco Stellaris.)
Das neue Buch "TREKminds - Nur der Himmel ist die Grenze" nimmt Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen und Schauplätze. Hin zu den Ideen, aus denen ein die Generationen überdauerndes Franchise entstand. Ideen des gemeinsamen Miteinanders und der Verständigung, des menschlichen Geistes. Ideen, die weltweit von Millionen von Trekminds gelebt - und geliebt - werden, im Großen wie im Kleinen. Star Trek lebt heute vielleicht mehr denn je - und mit ihm seine Ideale.
Begleiten Sie die Autoren Mike Hillenbrand (u. a. "Dies sind die Abenteuer - 40 Jahre Star Trek", HEEL) und Christian Humberg (u. a. Deutschland-Korrespondent von StarTrek. com) zu einer amüsanten und interessanten Tour jenseits der letzten Grenze. (Mit den Comics vom Alien-Kindergarten von Draco Stellaris.)
Produktdetails
Erscheinungsdatum
06. Oktober 2014
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
140
Dateigröße
1,43 MB
Autor/Autorin
Mike Hillenbrand, Christian Humberg
Verlag/Hersteller
Originalsprache
deutsch
Kopierschutz
ohne Kopierschutz
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783941864023
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "TREKminds - Nur der Himmel ist die Grenze - Was die Welt von Star Trek lernen kann" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









