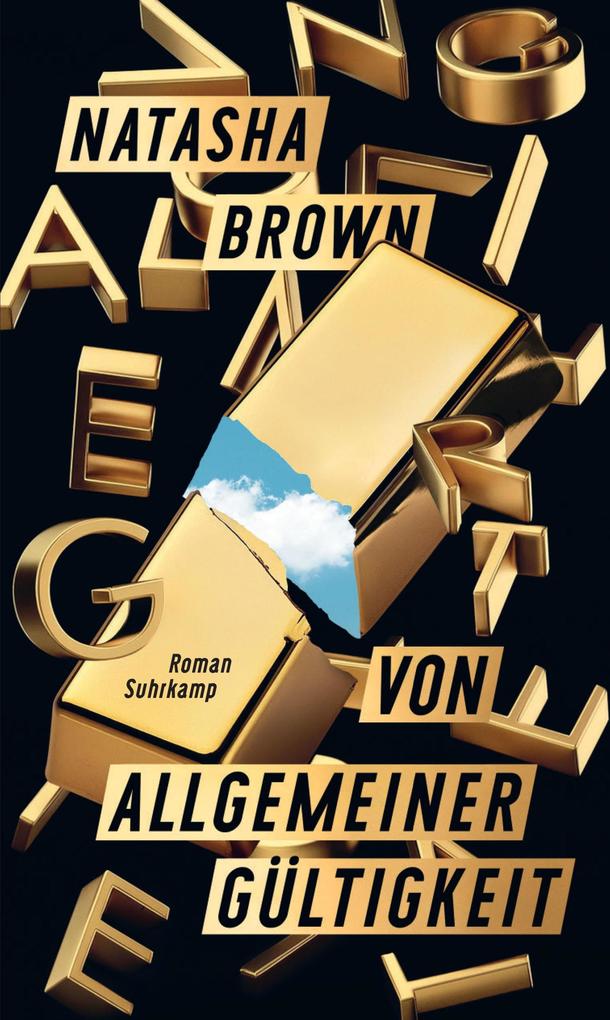Besprechung vom 24.04.2025
Besprechung vom 24.04.2025
Zu viele heiße Eisen für einen Kurzroman
Aus dem Bioladen an die Spitze der Medienmeute: Natasha Browns "Von allgemeiner Gültigkeit"
In dem legendären Interview, das François Truffaut einst mit Alfred Hitchcock führte, erklärt der Altmeister des Thrillers, wie er eine Filmhandlung am liebsten in Gang bringt: mit einem "MacGuffin". Das ist ein vorzugsweise rätselvolles Ding, das gleich zu Anfang Aufmerksamkeit fordert, das Interesse weiterhin erregt und bindet, dabei immer stärker spannungssteigernd wirkt und dennoch, wie sich zum Schluss zeigen wird, für die eigentliche Handlung unbedeutend bleibt. Damit ist der "MacGuffin" so etwas wie ein Lockvogel, dessen Spur sich irgendwann verliert und in Vergessenheit gerät, ein kalkulierter Aufreger ohne Belang, ein Zünder, dem der Funke an der Lunte schlicht verglimmt.
In Natasha Browns neuem Roman, der kürzlich unter reger Anteilnahme der medialen Öffentlichkeit in mehreren Sprachen zugleich herausgekommen ist (auf Deutsch in Eva Bonnés kompetenter Übersetzung), bildet ein massiver Goldbarren von zwölfeinhalb Kilo den MacGuffin. Das darf man getrost verraten, weil es bald in der Geschichte selbst schon ausgeplaudert wird. Der Goldbarren gehört einem Londoner Banker, der ihn sich aus Gründen narzisstischer Gefälligkeit zum vierzigsten Geburtstag geschenkt und fortan auf dem Kaminsims seines Landhauses in Yorkshire aufbewahrt hat. Dort gerät er in die Hände eines jungen Aussteigers, der während des Corona-Lockdowns mit Gleichgesinnten auf der Farm eine antikapitalistische Ökokommune gründet, doch bei einem unerlaubten Rave im Streit und Rausch einem Mitkommunarden mit besagtem Goldbarren auf den Schädel schlägt. Das Opfer fällt ins Koma, die Polizei stürmt den Rave, Täter samt Tatwaffe verschwinden im Getümmel.
Daraus, so soll man meinen, wird sich ein kunstgerechter Krimiplot entwickeln. Doch der Roman hat anderes im Sinn. Ihm geht es um mediale Aufmerksamkeitsmanöver, um die Frage also, was öffentliche Erregung auslöst und in Gang hält, wie die Effizienz von Klicks und Likes am profitabelsten zu steigern ist, wer davon am meisten profitiert und wer in solcherart Bewirtschaftung gesellschaftlicher Aufgeregtheit letztlich auf der Strecke bleibt. Dazu wechselt der Roman mehrfach die Gangart. Er beginnt mit einer investigativen Story, die in voller Länge präsentiert wird: Der Rave, die Farm und ihr Besitzer, die Landkommune und ihre Mitglieder, das soziale Umfeld, der fatale Streit, die tätliche Auseinandersetzung in der Partynacht und natürlich der ominöse Goldbarren werden im Magazinstil vorgestellt. So weit der MacGuffin.
Der nächste Abschnitt wird szenisch erzählt und leitet über ins Milieu der Digitalboheme, der Medienmacher und Talkshow-Routiniers. Hier lernen wir die junge Journalistin kennen, die mit dieser Story aufgestiegen ist. Ihr Leben als Freelancer war so lange von Geldsorgen und Existenznöten geplagt, dass sie schon einen Job im Bioladen angenommen und die Medienkarriere aufgegeben hat. Überdies fehlen ihr, da sie aus einfachen Verhältnissen stammt, nützliche Verbindungen in die Society und die üblichen Gefälligkeitsnetzwerke. Da erhält sie überraschend einen Tipp zu dem Vorfall in Yorkshire und macht sich an die Recherchen. Die führen sie bald in Insider-Kreise und decken unerwartete Verbindungen auf. Die Story geht viral, die Journalistin kommt zu Geld und Ansehen. Zu spät erst kommt ihr die Erkenntnis, dass sie bei der ganzen Sache selbst benutzt worden ist: Sie ist immer noch das bloße Instrument in einer Profihand, die mit der Medienmaschinerie gekonnt zu spielen weiß.
Noch zweimal setzt der Roman erneut an und wechselt Erzählweise wie Perspektive. Der Effekt ist jedes Mal, als bögen wir um eine Ecke und erhalten eine neue Sicht, bis schließlich die Strippenzieher-Person selbst ins Zentrum tritt und das Erzählen übernimmt. Auf nicht mal 160 Seiten sollen uns so offenbar diverse Blicke auf ein komplexes zeitgenössisches Gesellschaftspanorama eröffnet werden: Breitleinwandformat in schmalen Streifen. Dabei geht es um lauter große aktuelle Fragen: Diversität, Wokeness, Sexismus, Rassismus, Klassismus, Kapitalismus, diese Dinge. Offen aber bleibt die Frage, ob die erzählerischen Mittel dieses Romans für so viel heiße Eisen hinreichen.
Vor vier Jahren begann Brown - eine britische Person of Colour, von der nur zu lesen ist, dass sie nach einem Mathematik-Studium in Cambridge zehn Jahre in der Londoner Finanzbranche gearbeitet hat - ihre literarische Karriere mit einem Senkrechtstart: "Zusammenkunft", eine hundertseitige Geschichte über eine schwarze Erfolgsfrau in der Lebenskrise, erzählt in fragmentarischen Notaten, traf einen Nerv der Zeit, wurde ein Welterfolg und sicherte der Autorin 2023 einen Platz unter den Best of Young British Novelists des einflussreichen "Granta"-Magazins. Vor einem Jahr wurde über ihren zweiten Roman schon berichtet, dass sechs Verlage sich darum einen Bieterwettbewerb geliefert haben. Auch an weiterem Vorschusslorbeer hat es nicht gefehlt.
Doch die Lektüre enttäuscht. Zu unentschieden und beliebig wirkt die Aneinanderreihung der vier bis fünf einzelnen Erzählstücke, in die der Text zerfällt; zu angestrengt der kritisch-satirische Tonfall, den er anschlagen will, zu flach und erwartbar die Figuren und allzu steif der moralische Zeigefinger, der sich andauernd über sie erhebt. Ihre politischen Ansichten tragen sie wie Spruchbänder vor sich her, Merksätze werden einprägsam ausbuchstabiert, und Binsenweisheiten gibt es gratis dazu: "Menschen sind kompliziert, ja, aber am Ende werden sie womöglich alle von derselben Liebe und denselben Ängsten angetrieben."
Zweifellos ist es riskant, einen kritischen Medien-Roman zu schreiben, der von Anfang an ein solches Medienereignis ist, dass er an den Mechanismen, die er ausstellt, seinerseits partizipiert. In diesem Fall setzt er dazu noch alles auf einen MacGuffin und erscheint am Ende doch nur selbst wie einer: spannungs- und erregungsfördernd, aber wohl ohne bleibenden Belang. TOBIAS DÖRING
Natasha Brown: "Von allgemeiner Gültigkeit". Roman.
Aus dem Englischen von Eva Bonné. Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 160 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.