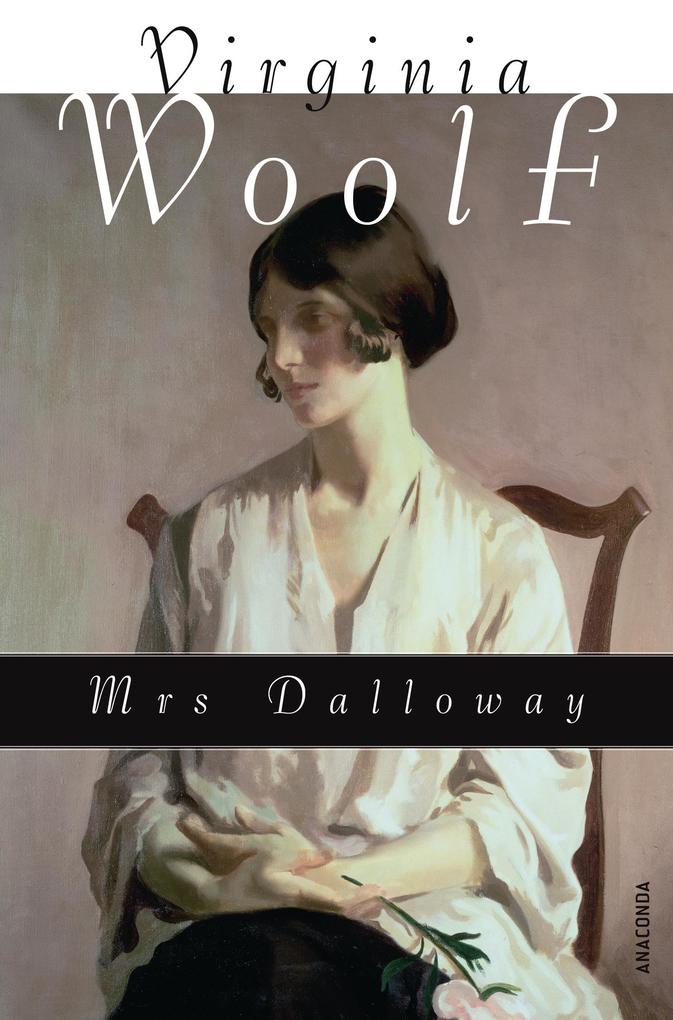Schwieriger Schreibstil - damals hochmodern, heute eher anstrengend.
Mrs. Dalloway liest sich wie ein weiblicher Ulysses: Wir erleben einen Tag im Leben von Clarissa Dalloway, blicken aber auch tief in die Gedankenwelt anderer Figuren: ihrer frühen Jugendliebe Peter Walsh oder beispielsweise Septimus Warren Smith, einem traumatisierten Veteran des 1. Weltkriegs und seiner Frau Lucrezia Smith, die verzweifelt (und wie sich herausstellt irrtümlicherweise) ärztliche Unterstützung für ihren Mann sucht. Die Figuren flanieren durch London, begegnen einander sowie anderen Figuren, in deren Gedankenwelt hineingezoomt wird. Manchmal ist unklar, in wessen Perspektive die Lesenden gerade eintauchen. Für meinen Geschmack ist das zu wirr, zu anstrengend zu lesen (allerdings immer noch etwas verständlicher als bei Joyces Ulysses). Was Virginia Woolf gut gelingt ist das Einfangen von Emotionen und Perspektiven von Personen völlig verschiedenen Charakters, Klassenzugehörigkeit, Alters und Geschlechts. Die Themen sind immer noch modern: In wie weit sind Frauen frei in ihrer Berufs- und Partner(innen)wahl? Wo hört gesellschaftliche Anpassung auf und wo beginnt Opportunismus? Wie geht eine Gesellschaft mit (psychisch) Kranken und Versehrten um? Was bedeuten verschiedene Lebensentwürfe für den gesellschaftlichen Stand? So macht es bei diesem Text durchaus Sinn, hundert Jahre nach seiner Entstehung eine neue Übersetzung herauszubringen, wie es der Manesse Verlag hier durch Melanie Walz vorlegt. Die Übersetzerin hat sich scheinbar nicht zur Aufgabe gemacht, den original Text lesbarer zu machen, was vermutlich ihre Vorgänger getan haben, und ist damit evtl. näher am Original geblieben. Reizvoll wäre es, verschiedene Übersetzungen vergleichend zu lesen, und so dem Werk besser auf die Spur zu kommen. Aber schlussendlich ist das auch eine Frage, wie tief man in die Materie eintauchen möchte. Die erste Lektüre bietet lediglich einen Überblick, der zu Vertiefung und näherer Beschäftigung mit dem Stoff einlädt.