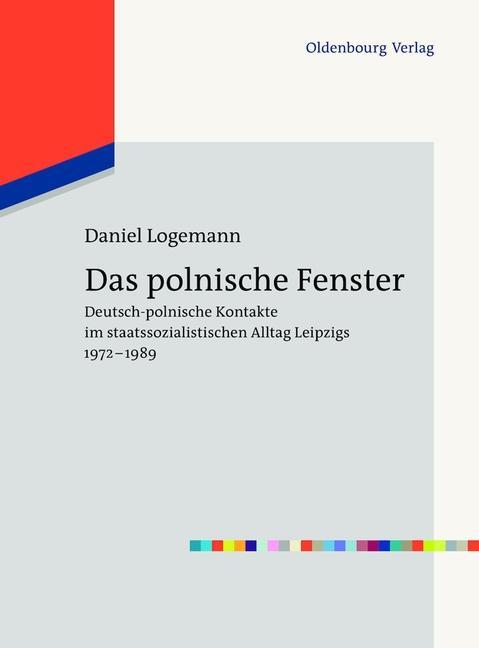
Sofort lieferbar (Download)
"Polnisches" übte im sozialistischen Alltag der DDR eine große Faszination aus. Am Beispiel der Bürger Leipzigs untersucht diese Studie das Verhältnis zum mal fernen, mal nahen Nachbarn Polen, der immer auch ein Stück Westen im Osten war und dessen Anziehungskraft von offizieller Seite deshalb stets misstrauisch beäugt wurde. Mit einem klaren Blick für den Mikrokosmos Alltag konturiert Daniel Logemann den "Eigen-Sinn" deutsch-polnischer Kontakte jenseits der Systemkonformität und beschreibt eine Welt zwischen polnischem Freiheitsversprechen einerseits, und Einkaufstourismus und Schleichhandel andererseits.
Inhaltsverzeichnis
1;Einleitung;7 2;1. Rahmenbedingungen deutsch-polnischer Kontakte in Leipzig;31 2.1;1.1. Auftakt. Faszination des Polnischen;31 2.2;1.2. Leipzig und Volkspolen. Völkerfreundschaft unter den Bedingungen des Staatssozialismus;40 2.2.1;1.2.1. Geschichtsbilder in der DDR und in Volkspolen und Aspekte der gegenseitigen Wahrnehmung;43 2.2.2;1.2.2. Die offene Grenze. Leipzig als Beispiel einer propagandistisch gewollten Partnerschaft;53 2.2.3;1.2.3. Die geschlossene Grenze. Die Gefahr aus Volkspolen und Leipziger Aufbauhilfe;63 2.3;1.3. Exkurs. Die Staatssicherheit als Garant der Macht und als Akteur im Alltag. Private deutsch-polnische Kontakte als Instrument der Stasi;75 3;2. Deutsch-polnisches Leben in Leipzig und polnische Erfahrungen von Leipzigern. Akteure und Kontakträume;95 3.1;2.1. Offiziell angebahnte Kontakte. Sozialistische Internationale und kleine Dienste unter Freunden;100 3.2;2.2. Polnische Vertragsarbeiter in Leipzig. Wirtschaftliche Notwendigkeit und private Aneignungen;107 3.2.1;2.2.1. Soziologische Faktoren und Rahmenbedingungen;110 3.2.2;2.2.2. Der Alltag polnischer Vertragsarbeiter in Leipzig;123 3.3;2.3. Polnisches Studentenleben in Leipzig;151 3.4;2.4. Deutsch-polnisches Leben in Leipzig;164 3.5;2.5. Eine Insel in Leipzig. Das Polnische Informations- und Kulturzentrum;179 3.5.1;2.5.1. Tätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit;182 3.5.2;2.5.2. Alltägliches und Informelles das PIKZ als Vermittler des Polnischen;195 3.5.3;2.5.3. Das PIKZ in den Augen der Staatssicherheit;199 3.6;2.6. Ergebnisse und Thesen: Deutsch-polnisches Leben in Leipzig und polnische Erfahrungen von Leipzigern;204 4;3. Reisen ins Nachbarland. Volkspolen zwischen Sehnsuchtsziel und sozialistischer Urlaubsidylle;207 4.1;3.1. Der Tourismus zwischen der DDR und Volkspolen;209 4.1.1;3.1.1. Reisen zur Zeit der offenen Grenzen;216 4.1.2;3.1.2. Organisierte Reisen in den achtziger Jahren;227 4.2;3.2. Kinder-, Jugend- und Studentenaustausch;251 4.3;3.3. Ergebnisse und Thesen: Reisen ins Nachbarl
and. Volkspolen zwischen Sehnsuchtsziel und sozialistischer Urlaubsidylle;269 5;4. Deutsch-polnischer Schleichhandel in Leipzig. Hamsterkäufe und Konsumkultur von unten;271 5.1;4.1. Einstellungen zum deutsch-polnischen Schleichhandel;278 5.2;4.2. Praktiken und Bekämpfung des Schleichhandels;295 5.2.1;4.2.1. Waren und Warenmenge;297 5.2.2;4.2.2. Die Praktiken des Schleichhandels;302 5.2.3;4.2.3. Bekämpfung des Schleichhandels durch die Staatsorgane;317 5.3;4.3. Der Schmugglerzug. Ein Beispiel der Verflechtung von Einstellungen und Praktiken;322 5.4;4.4. Ergebnisse und Thesen: Deutsch-polnischer Schleichhandel in Leipzig;338 6;Zusammenfassung;341 7;Danksagung;350 8;Abkürzungsverzeichnis;353 9;Quellen und Literatur;357 9.1;Quellen;357 9.2;Literatur;359 9.3;Register;375
and. Volkspolen zwischen Sehnsuchtsziel und sozialistischer Urlaubsidylle;269 5;4. Deutsch-polnischer Schleichhandel in Leipzig. Hamsterkäufe und Konsumkultur von unten;271 5.1;4.1. Einstellungen zum deutsch-polnischen Schleichhandel;278 5.2;4.2. Praktiken und Bekämpfung des Schleichhandels;295 5.2.1;4.2.1. Waren und Warenmenge;297 5.2.2;4.2.2. Die Praktiken des Schleichhandels;302 5.2.3;4.2.3. Bekämpfung des Schleichhandels durch die Staatsorgane;317 5.3;4.3. Der Schmugglerzug. Ein Beispiel der Verflechtung von Einstellungen und Praktiken;322 5.4;4.4. Ergebnisse und Thesen: Deutsch-polnischer Schleichhandel in Leipzig;338 6;Zusammenfassung;341 7;Danksagung;350 8;Abkürzungsverzeichnis;353 9;Quellen und Literatur;357 9.1;Quellen;357 9.2;Literatur;359 9.3;Register;375
Produktdetails
Erscheinungsdatum
30. Juni 2014
Sprache
deutsch
Untertitel
Deutsch-polnische Kontakte im staatssozialistischen Alltag Leipzigs 1972-1989.
Seitenanzahl
378
Reihe
Europas Osten im 20. Jahrhundert
Autor/Autorin
Daniel Logemann
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783486717259
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Das polnische Fenster" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









