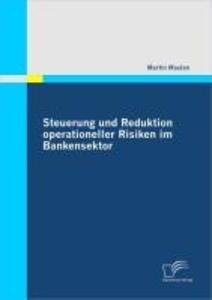
Sofort lieferbar (Download)
Die erheblichen Verlustfälle der letzten Jahrzehnte, deren Ursachen auf operationelle Risiken zurückzuführen sind, haben diese Risikokategorie ins Zentrum des Interesses verschoben. Es gibt zahlreiche Gründe, warum sich der Fokus der Banken als auch der Aufsichtsbehörden von anderen Risikoarten bis zu operationellen erweitert hat.
Der Autor zeigt diverse Möglichkeiten, wie die Banken operationelle Risiken identifizieren, quantifizieren und steuern können. Er erklärt die einzelnen Stufen des operationellen Risikomanagementprozesses und möchte darauf aufmerksam machen, dass der Anteil operationeller Risiken am Gesamtrisiko kontinuierlich steigt und deswegen ist derzeit ein unternehmensweit und proaktiv funktionierendes Risikomanagement sogar unerlässlich. Der Leser erfährt die Möglichkeiten zur Identifizierung und Steurung (je nach der gewählten Strategie - Akzeptanz, Verringerung, Transfer) der operationellen Risiken und gleichzeitig sollte es ihm klar sein, wie umfassend das verfügbare Instrumentarium ist. Das Ziel ist es, die steigende Wichtigkeit und Dominanz dieser Risikokategorie im Bankensektor zu betonen.
Das Buch umfasst neben der Einleitung und Zusammenfassung vier Kapitel. Im ersten Kapitel wird mit der Definition und Systematisierung der wichtigsten bankbetrieblichen Risiken angefangen. Nachdem die Grundlagen gelegt werden, wird anschließend die Risikokategorie "operationelle Risiken" ausführlicher erläutert. Das Kapitel schließt mit der Darstellung mehrerer Fallbeispielen aus der Praxis, in denen das operationelle Risiko erhebliche Verluste verursacht hat.
Im zweiten Kapitel werden die rechtlichen Rahmenbedingungen behandelt. Insbesondere alte und neue Basler Eigenkapitalverordnung mit ihren Schwächen sind Gegenstand dieser Ausführungen, wobei die aufsichtrechtliche Entwicklung der Kategorie "operationelle Risiken" den Schwerpunkt dieses Kapitels darstellt.
Der dritte Teil beschreibt die einzelnen Stufen des Risikomanagementprozesses mit zuständigen Instrumenten. Insbesondere die Risikoidentifikation, -messung und -steuerung werden detailiert analysiert. Darüber hinaus werden auch die praktisch gängigsten Tools zur operationellen Risikosteuerung aus der Sicht der basleren Risikoursachen erwähnt.
Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem Verlauf und den Instrumenten des Risikomanagementprozesses im Rahmen des größten Bankinstituts Deutschlands. Es werden konkrete Schritte zur Identifikation von Verlustereignissen in der Praxis veranschaulicht und auf übliche Maßnahmen zur Risikoverringerung und -transferierung eingegangen. Zum Inhalt des vierten Kapitels gehört auch der Teil, der sich mit der Eigenkapitalunterlegung von operationellen Risiken befasst und somit ihre steigende Bedeutung auf der praktischen Ebene bildet. Eine Zusammenfassung der Erkenntnisse und ein Ausblick über mögliche weitere Entwicklungen bezüglich der operationellen Risiken schließen diese Problematik ab.
Der Autor zeigt diverse Möglichkeiten, wie die Banken operationelle Risiken identifizieren, quantifizieren und steuern können. Er erklärt die einzelnen Stufen des operationellen Risikomanagementprozesses und möchte darauf aufmerksam machen, dass der Anteil operationeller Risiken am Gesamtrisiko kontinuierlich steigt und deswegen ist derzeit ein unternehmensweit und proaktiv funktionierendes Risikomanagement sogar unerlässlich. Der Leser erfährt die Möglichkeiten zur Identifizierung und Steurung (je nach der gewählten Strategie - Akzeptanz, Verringerung, Transfer) der operationellen Risiken und gleichzeitig sollte es ihm klar sein, wie umfassend das verfügbare Instrumentarium ist. Das Ziel ist es, die steigende Wichtigkeit und Dominanz dieser Risikokategorie im Bankensektor zu betonen.
Das Buch umfasst neben der Einleitung und Zusammenfassung vier Kapitel. Im ersten Kapitel wird mit der Definition und Systematisierung der wichtigsten bankbetrieblichen Risiken angefangen. Nachdem die Grundlagen gelegt werden, wird anschließend die Risikokategorie "operationelle Risiken" ausführlicher erläutert. Das Kapitel schließt mit der Darstellung mehrerer Fallbeispielen aus der Praxis, in denen das operationelle Risiko erhebliche Verluste verursacht hat.
Im zweiten Kapitel werden die rechtlichen Rahmenbedingungen behandelt. Insbesondere alte und neue Basler Eigenkapitalverordnung mit ihren Schwächen sind Gegenstand dieser Ausführungen, wobei die aufsichtrechtliche Entwicklung der Kategorie "operationelle Risiken" den Schwerpunkt dieses Kapitels darstellt.
Der dritte Teil beschreibt die einzelnen Stufen des Risikomanagementprozesses mit zuständigen Instrumenten. Insbesondere die Risikoidentifikation, -messung und -steuerung werden detailiert analysiert. Darüber hinaus werden auch die praktisch gängigsten Tools zur operationellen Risikosteuerung aus der Sicht der basleren Risikoursachen erwähnt.
Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem Verlauf und den Instrumenten des Risikomanagementprozesses im Rahmen des größten Bankinstituts Deutschlands. Es werden konkrete Schritte zur Identifikation von Verlustereignissen in der Praxis veranschaulicht und auf übliche Maßnahmen zur Risikoverringerung und -transferierung eingegangen. Zum Inhalt des vierten Kapitels gehört auch der Teil, der sich mit der Eigenkapitalunterlegung von operationellen Risiken befasst und somit ihre steigende Bedeutung auf der praktischen Ebene bildet. Eine Zusammenfassung der Erkenntnisse und ein Ausblick über mögliche weitere Entwicklungen bezüglich der operationellen Risiken schließen diese Problematik ab.
Inhaltsverzeichnis
1;Steuerung und Reduktion operationeller Risiken im Bankensektor;1 2;ABSTRAKT;3 3;INHALTSVERZEICHNIS;4 4;ABBILDUNGSVERZEICHNIS;6 5;TABELLENVERZEICHNIS;6 6;EINLEITUNG;7 7;1. THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND DEFINITION DER OPERATIONELLEN RISIKEN IN BANKEN;9 7.1;1.1 DEFINITION DES RISIKOS;9 7.1.1;1.1.1 WESENTLICHE RISIKOARTEN;9 7.1.2;1.1.2 DAS REPUTATIONSRISIKO;11 7.1.3;1.1.3 DEFINITION DER OPERATIONELLEN RISIKEN;12 7.2;1.2 ENTWICKLUNG VON OPERATIONELLEN RISIKEN;14 7.3;1.3 DIE URSACHEN VON OPERATIONELLEN RISIKEN;17 7.4;1.4 ABRENZUNG DES OPERATIONELLEN RISIKOS VON ANDEREN RISIKOKLASSEN;19 7.5;1.5 DIE FALLBEISPIELE AUS DER PRAXIS;21 7.5.1;1.5.1 DIE BARINGS BANK;21 7.5.2;1.5.2 DIE BANK OF NEW YORK;22 7.5.3;1.5.3 DER JÜRGEN SCHNEIDERS FALL IN DEUTSCHLAND;23 7.5.4;1.5.4 DIE BANK PARIBAS;23 8;2. GESETZLICHE UND RECHTLICHE REGELUNGEN VON OPERATIONELLEN RISIKEN;25 8.1;2.1 KAPITALANFORDERUNGEN NACH BASEL I;26 8.2;2.2 BASEL II NEUE KAPITALANFORDERUNGEN;26 8.2.1;2.2.1 ERSTE SÄULE : MINDESTANFORDERUNGEN;27 8.2.2;2.2.2 ZWEITE SÄULE : BANKENAUFSICHTLICHE ÜBERPRÜFUNG;27 8.2.3;2.2.3 DRITTE SÄULE : DIE MARKTDISZIPLIN;27 8.3;2.3 QUANTITATIVE BEMESSUNGSANSÄTZE VON BASEL II;28 8.4;2.4 NATIONALE UMSETZUNG;30 9;3. PROZESS DES MANAGEMENTS OPERATIONELLER RISIKEN UND INSTRUMENTE ( MAßNAHMEN) ZU DEREN STEUERUNG;33 9.1;3.1 RISIKOIDENTIFIKATION UND BEURTEILUNG (MESSUNG);35 9.1.1;3.1.1 SELF ASSESMENT (RISIKOINVENTUR);35 9.1.2;3.1.2 SZENARIOANALYSE;36 9.1.3;3.1.3 RISIKOINDIKATOREN UND SCORECARDANSATZ;37 9.1.4;3.1.4 GEWINNVOLATILITÄT;38 9.1.5;3.1.5 BENCHMARKMETHODE;39 9.1.6;3.1.6 KAUSALDIAGRAMME UND BAYESIANISCHE NETZWERKE;39 9.2;3.2. RISIKOSTEUERUNG (RISIKOBEWÄLTIGUNG);40 9.2.1;3.2.1 RISIKOVERMINDERUNG;40 9.2.2;3.2.2 RISIKOVERMEIDUNG;42 9.2.3;3.2.3 RISIKOAKZEPTANZ;43 9.2.4;3.2.4 RISIKOTRANSFER;43 9.2.5;3.2.5 MAßNAHMEN UND INSTRUMENTE AUS DER SICHT VON BASEL II;49 9.3;3.3 RISIKOÜBERWACHUNG UND BERICHTSWESEN;54 10;4. OPERATIONELLE RISIKEN UND DEREN STEUERUNG IM RAHMEN DES KONZERNS DEUTSCHE BANK;56 10.1;4.
1 ARTEN VON RISIKEN IM KONZERN;56 10.2;4.2 ORGANISATION UND STRUKTUR DES RISIKOMANAGEMENTS BEI DER DEUTSCHEN BANK;57 10.3;4.3 INSTRUMENTE UND OR-STEUERUNG IM DB KONZERN;58 10.3.1;4.3.1 OR-PROZESS UND OR-INSTRUMENTE DER DEUTSCHEN BANK;58 10.3.2;4.3.2 ALLGEMEINE STEUERUNGSINSTRUMENTE DES KONZERNS;60 10.4;4.4 CORPORATE INSURANCE / DEUKONA;66 10.5;4.5 OUTSOURCING DER DEUTSCHEN BANK AG;67 11;FAZIT UND AUSBLICK;69 12;LITERATURVERZEICHNIS;71 13;ANHANG;76 14;Autorenprofil;85
1 ARTEN VON RISIKEN IM KONZERN;56 10.2;4.2 ORGANISATION UND STRUKTUR DES RISIKOMANAGEMENTS BEI DER DEUTSCHEN BANK;57 10.3;4.3 INSTRUMENTE UND OR-STEUERUNG IM DB KONZERN;58 10.3.1;4.3.1 OR-PROZESS UND OR-INSTRUMENTE DER DEUTSCHEN BANK;58 10.3.2;4.3.2 ALLGEMEINE STEUERUNGSINSTRUMENTE DES KONZERNS;60 10.4;4.4 CORPORATE INSURANCE / DEUKONA;66 10.5;4.5 OUTSOURCING DER DEUTSCHEN BANK AG;67 11;FAZIT UND AUSBLICK;69 12;LITERATURVERZEICHNIS;71 13;ANHANG;76 14;Autorenprofil;85
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Juni 2010
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
92
Dateigröße
0,88 MB
Autor/Autorin
Martin Maslen
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
ohne Kopierschutz
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783836641302
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Steuerung und Reduktion operationeller Risiken im Bankensektor" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









