Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
Ihr Gutschein zum Schulstart: 15% Rabatt11 auf Kalender & Schreibwaren mit dem Code DATUM15
Jetzt einlösen
mehr erfahren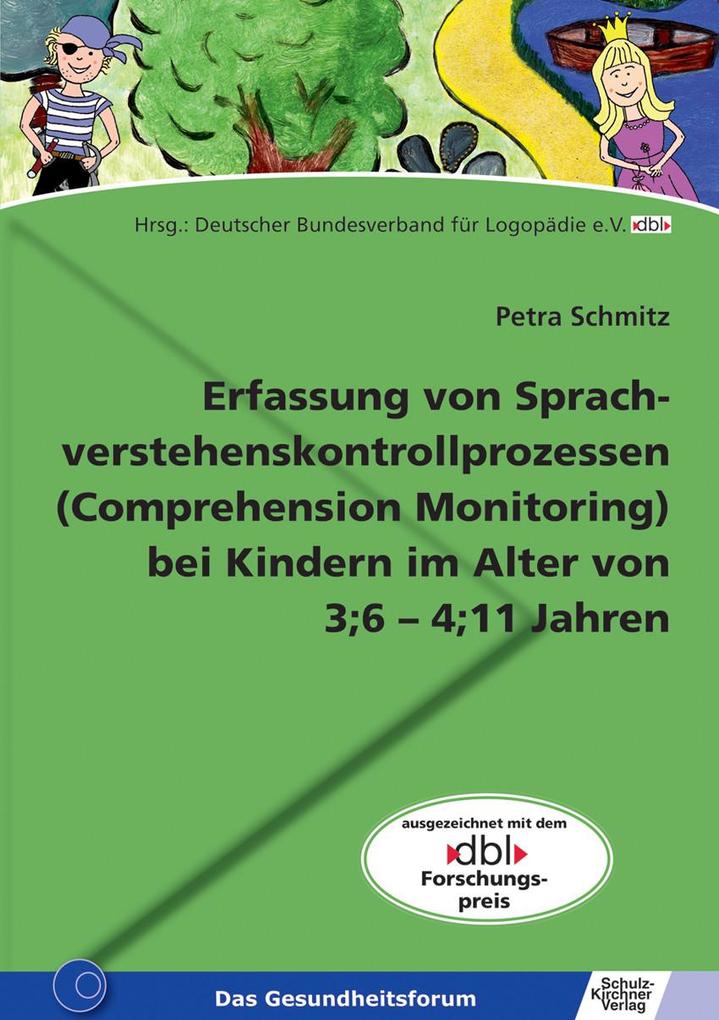
Sofort lieferbar (Download)
ausgezeichnet mit dem dbl-Forschungspreis Bemerkt ein Kind, wenn es Sprache nicht so genau versteht? Wie reagiert es darauf? Kindliche Sprachverstehenskontrollprozesse erfassen Gerade für sprachverstehensgestörte Kinder ist es wichtig, dass sie bemerken und nachfragen (lernen), wenn sie sprachliche Inhalte nicht verstehen. Das ermöglicht ihnen einen offensiven und aktiven Umgang mit ihrem Nichtverstehen und trägt im besten Falle zur Erweiterung ihres Sprachverstehens bei. Innerhalb der im Buch dargestellten Studie wurde ein Verfahren entwickelt, das derartige Prozesse der Sprachverstehenskontrolle (Comprehension Monitoring) erfasst. Bei der Durchführung des Verfahrens erhielt das Kind Anweisungen, die gezielt Sprachverstehensprobleme provozierten, z. B. indem das Kind mehrdeutige oder zu lange Anweisungen erhielt. So konnte beobachtet werden, ob und wie es auf Sprachverstehensprobleme reagiert. Um die Motivation der Kinder zu erhalten und Frustration weitgehend zu vermeiden, wurde die Untersuchung in eine Rahmenhandlung (Schatzsuche) eingebunden. Das Verfahren wurde an 37 Kindern im Alter von 3; 6 ? 4; 11 Jahren erprobt und es erfolgten erste Analysen zu psychometrischen Eigenschaften. Darüber hinaus wurde untersucht, welchen Einfluss die Faktoren: -Alter -Art des Sprachverstehensproblems -Geschlecht -elterliche Bildungsvariablen -primäre Sprachverstehensleistung des Kindes -kognitive Leistung des Kindes auf die jeweiligen Leistungen der Kinder hatten.
Petra Schmitz (M. Sc.) absolvierte ihre Logopädieausbildung 1992-1995 in Hamburg. 2005 schloss sie den Bachelorstudiengang in Hildesheim und 2010 den Masterstudiengang Lehr- und Forschungslogopädie an der RWTH Aachen ab. Nach langjähriger Praxistätigkeit begann sie 2001 ihre Lehrtätigkeit im Fachbereich Sprachentwicklungsstörung an der Schule für Logopädie in Köln. Seit 2009 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Fresenius im Studiengang für Logopädie Hamburg tätig. Für ihre Masterarbeit wurde sie 2011 mit dem dbl-Forschungspreis ausgezeichnet.
Petra Schmitz (M. Sc.) absolvierte ihre Logopädieausbildung 1992-1995 in Hamburg. 2005 schloss sie den Bachelorstudiengang in Hildesheim und 2010 den Masterstudiengang Lehr- und Forschungslogopädie an der RWTH Aachen ab. Nach langjähriger Praxistätigkeit begann sie 2001 ihre Lehrtätigkeit im Fachbereich Sprachentwicklungsstörung an der Schule für Logopädie in Köln. Seit 2009 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Fresenius im Studiengang für Logopädie Hamburg tätig. Für ihre Masterarbeit wurde sie 2011 mit dem dbl-Forschungspreis ausgezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
1;Inhalt;6 2;Vorwort des Herausgebers;8 3;DANKSAGUNG;10 4;1 EINLEITUNG;11 5;2 Comprehension Monitoring Sprachverstehenskontrolle (SVK);14 5.1;2.1 Definition und Begriffl ichkeit;14 5.2;2.2 Sprachverstehen und SVK;14 5.3;2.3 Prozesse der SVK;16 5.4;2.4 Entwicklung von SVK;18 5.5;2.5 Diagnostik von SVK;25 5.6;2.6 Ziele, Fragestellungen und Hypothesen;26 6;3 Verfahren zur Erfassung früher Sprachverstehenskontrollprozesse(VEF-SVK);29 6.1;3.1 Materialbeschreibung;29 6.1.1;3.1.1 Verwendete Aufgabentypen;29 6.1.2;3.1.2 Material zu Aufgabentyp 1;29 6.1.3;3.1.3 Stimuli zu Aufgabentyp 1;31 6.1.4;3.1.4 Material zu Aufgabentyp 2;35 6.1.5;3.1.5 Stimuli zu Aufgabentyp 2;36 6.2;3.2 Durchführung des VEF-SVK;39 6.2.1;3.2.1 Allgemeiner Ablauf;39 6.2.2;3.2.2 Aufgabentyp 1;39 6.2.3;3.2.3 Aufgabentyp 2;44 6.3;3.3 Auswertung des VEF-SVK;46 6.3.1;3.3.1 Aufgabentyp 1;46 6.3.2;3.3.2 Aufgabentyp 2;47 6.4;3.4 Pilotphase;48 7;4 Durchführung der empirischen Studie;50 7.1;4.1 Stichprobe;50 7.2;4.2 Durchführung Untersuchungsablauf;51 7.3;4.3 Material;52 7.4;4.4 Auswertung;52 7.4.1;4.4.1 Auswertung der Videos;52 7.4.2;4.4.2 Statistische und psychometrische Auswertung;53 8;5 Ergebnisse;60 8.1;5.1 Stichprobe;60 8.1.1;5.1.1 Geschlecht;60 8.1.2;5.1.2 Bildung der Eltern;60 8.1.3;5.1.3 Alter;62 8.2;5.2 Primäres Sprachverstehen bei der Durchführung desVEF-SVK;64 8.2.1;5.2.1 Aufgabentyp 1;64 8.2.2;5.2.2 Aufgabentyp 2;64 8.3;5.3 Psychometrische Eigenschaften des VEF-SVK;64 8.3.1;5.3.1 Itemanalyse: Deskription der Werteverteilung;64 8.3.2;5.3.2 Itemanalyse unter dem Aspekt der Reliabilität;67 8.3.3;5.3.3 Itemanalyse unter dem Aspekt der Konstruktvalidität;72 8.4;5.4 Einfl uss des Alters;81 8.4.1;5.4.1 In Bezug auf alle Kinder der Stichprobe;81 8.4.2;5.4.2 In Bezug auf die drei Altersgruppen der Stichprobe;82 8.5;5.5 Weitere beeinfl ussende Faktoren;85 8.5.1;5.5.1 Reihenfolge der Itempräsentation bei Aufgabentyp 1;85 8.5.2;5.5.2 Geschlecht;86 8.5.3;5.5.3 Bildung der Eltern;86 8.5.4;5.5.4 Primäres Sprachverst
ehen;87 8.5.5;5.5.5 Satzgedächtnis;89 8.5.6;5.5.6 Kognitive Fähigkeiten;89 8.6;5.6 Nicht gewertete Hinweise auf SVK beiAufgabentyp 2;90 9;6 Diskussion;91 9.1;6.1 Verfahren zur Erfassung früher Sprachverstehenskontrollprozesse;91 9.1.1;6.1.1 Anwendbarkeit;91 9.1.2;6.1.2 Psychometrische Eigenschaften;93 9.2;6.2 Erhobene Daten;99 9.2.1;6.2.1 Einfluss des Alters;99 9.2.2;6.2.2 Einfluss der Itemschwierigkeit bzw. des Itemtyps Aufgabentyp 1;102 9.2.3;6.2.3 Sonstige Einflussfaktoren;104 10;7 Zusammenfassung und Fazit;109 11;Literaturverzeichnis;112 12;Anhang;116 12.1;Anlage 1: Bedeutungskonstruktionszirkel (Schmitz & Beushausen, 2007);117 12.2;Anlage 2: Aufgabentyp 1: Items in randomisierter Reihenfolge;118 12.3;Anlage 3: Aufgabentyp 2: 1. Audiovorgabe und 2. Audiovorgabe mit Testitems;121 12.4;Anlage 4: Aufgabentyp 1: Vorgaben zur Anleitung und Untersucherreaktion aufdie Reaktion des Kindes;122 12.5;Anlage 5: Aufgabentyp 1: Protokollbogen (vorwärts 1. Seite);126 12.6;Anlage 6: Aufgabentyp 2: Vorgaben zur Anleitung und Untersucherreaktionauf die Reaktion des Kindes;127 12.7;Anlage 7: Aufgabentyp 1: Bewertungsvorgaben zur Differenzierungspezifi scher und nicht spezifi scher verbaler Hinweise auf SVK;129 12.8;Anlage 8: Aufgabentyp 2: Bewertungsvorgaben;132 12.9;Anlage 9: Aufgabentyp 1: Abweichende Reaktionen;133 12.10;Anlage 10: Stimuluskoordinaten der 3-dimensionalen Punktekonfi guration;141 12.11;Anlage 11: Zuordnungsübersichten Hierarchische Clusteranalysen;143 13;Abbildungsverzeichnis;146 14;Tabellenverzeichnis;146
ehen;87 8.5.5;5.5.5 Satzgedächtnis;89 8.5.6;5.5.6 Kognitive Fähigkeiten;89 8.6;5.6 Nicht gewertete Hinweise auf SVK beiAufgabentyp 2;90 9;6 Diskussion;91 9.1;6.1 Verfahren zur Erfassung früher Sprachverstehenskontrollprozesse;91 9.1.1;6.1.1 Anwendbarkeit;91 9.1.2;6.1.2 Psychometrische Eigenschaften;93 9.2;6.2 Erhobene Daten;99 9.2.1;6.2.1 Einfluss des Alters;99 9.2.2;6.2.2 Einfluss der Itemschwierigkeit bzw. des Itemtyps Aufgabentyp 1;102 9.2.3;6.2.3 Sonstige Einflussfaktoren;104 10;7 Zusammenfassung und Fazit;109 11;Literaturverzeichnis;112 12;Anhang;116 12.1;Anlage 1: Bedeutungskonstruktionszirkel (Schmitz & Beushausen, 2007);117 12.2;Anlage 2: Aufgabentyp 1: Items in randomisierter Reihenfolge;118 12.3;Anlage 3: Aufgabentyp 2: 1. Audiovorgabe und 2. Audiovorgabe mit Testitems;121 12.4;Anlage 4: Aufgabentyp 1: Vorgaben zur Anleitung und Untersucherreaktion aufdie Reaktion des Kindes;122 12.5;Anlage 5: Aufgabentyp 1: Protokollbogen (vorwärts 1. Seite);126 12.6;Anlage 6: Aufgabentyp 2: Vorgaben zur Anleitung und Untersucherreaktionauf die Reaktion des Kindes;127 12.7;Anlage 7: Aufgabentyp 1: Bewertungsvorgaben zur Differenzierungspezifi scher und nicht spezifi scher verbaler Hinweise auf SVK;129 12.8;Anlage 8: Aufgabentyp 2: Bewertungsvorgaben;132 12.9;Anlage 9: Aufgabentyp 1: Abweichende Reaktionen;133 12.10;Anlage 10: Stimuluskoordinaten der 3-dimensionalen Punktekonfi guration;141 12.11;Anlage 11: Zuordnungsübersichten Hierarchische Clusteranalysen;143 13;Abbildungsverzeichnis;146 14;Tabellenverzeichnis;146
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Januar 2012
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
148
Dateigröße
1,02 MB
Autor/Autorin
Petra Schmitz
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783824809202
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Erfassung von Sprachverstehenskontrollprozessen (Comprehension Monitoring) bei Kindern im Alter von 3;6-4;11 Jahren" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









